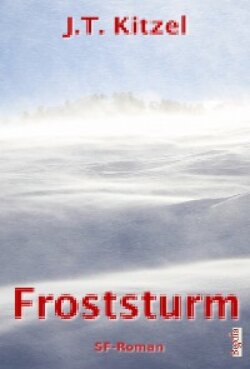Читать книгу Froststurm - Jan-Tobias Kitzel - Страница 9
Dreißig silberne Bytes für seinen Kopf
ОглавлениеEin muffiger Geruch lag in der Luft, gemischt mit dem bitteren Aroma von rostigem Metall und altem Öl. Regina spürte jede einzelne der altersschwachen Federn des Sofas, saß mit angezogenen Beinen einfach nur da und ließ die Tränen über ihr Gesicht laufen. Ben war weg. Lebensmittel besorgen, damit sie sich erst mal verkriechen konnten. Hier. Im Nirgendwo. Irgendein halbleeres Lagerhaus, irgendein Industriegebiet. Völlig egal. Ihre Existenz war weg, einfach davongewischt von den Ereignissen der letzten Stunden. Wie sie im Eiltempo zu ihren beiden Wohnungen gerast waren und das Nötigste zusammen gekratzt hatten. Immer einen Blick über die Schultern geworfen, ein kerniges »Stehenbleiben, Sie sind verhaftet« erwartend. Nichts dergleichen war passiert, aber untertauchen mussten sie trotzdem. Denn es war nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei ihre Namen und Adressen hatten, ihrem verlorenen Laptop sei Dank. Natürlich war sie eine brave IT-Frau gewesen und hatte ihr Laptop mit einer entsprechenden Verschlüsselung versehen. Aber wenn die Polizei es wirklich ernst meinte ... wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. Dass außerdem ihr Portemonnaie mit im Rucksack gewesen war, machte die Diskussion um den Laptop überflüssig. Und ein Foto von Ben mit Liebesschwur in Handschrift auf der Rückseite lag in der Vordertasche. Ein letztes sarkastisches Detail, ein letztes Puzzlestück, das endgültig jenes Bild ergab, dass das Schicksal sich eine Meinung über ihre Aktivitäten gebildet hatte. Und es war ihnen nicht mehr wohlgesonnen, sondern hatte ihnen stattdessen in die Kniekehlen getreten. Lege dich nicht mit Mächten an, die du nicht begreifst. Sie umschlang ihre Beine. Salzig warm lief ihr die Tränen über die Wangen.
Ihr fehlte Bobo. Aber Ben hatte recht. Einen Hund mit »auf die Flucht« zu nehmen, wäre eine bescheuerte Idee gewesen. Also hatte sie den Hund bei einer Nachbarin gelassen, die schon früher ab und zu mit ihm Gassi gegangen war. Bobo, der immer bei ihr im Bett geschlafen hatte und sie morgens so lange nervte, bis endlich Futter im Napf war. Ihr Schniefen hallte laut in dem halb leeren Büro der Lagerhalle nach, ein Weinkrampf schüttelte ihre Glieder und sie ließ sich von ihren Emotionen davontragen. Ihr Leben, wie sie es kannte, war vorbei.
Ben saß neben ihr auf der altersschwachen Couch. Sie schwiegen sich an. Draußen surrte ein Gabelstapler durch die halbleere Halle und Regina schreckte hoch.
»Keine Sorge. Das Büro wird nicht mehr gebraucht, wir können hier bleiben, hab ich abgeklärt.« Er legte seine Hand auf ihren Oberschenkel. Fast panisch wischte sie den Arm weg und stand auf.
»Spinnst du? Ich soll mir keine Sorgen machen? In so einem Mist wie dem hier hab ich noch nie gesteckt. Wir sind völlig am Arsch, Schatzi!« Regina verschränkte die Arme vor der Brust und schaute Ben direkt in die Augen. Am liebsten hätte sie ihm eine runtergehauen.
Ben breitete die Arme aus, ließ sie aber schnell wieder sinken, als sie ihn düster anfunkelte.
»Hey, komm schon. Ich weiß selbst nicht, was da gelaufen ist.«
»Ach nein, auf einmal weiß Mister Allwissend mal nicht weiter?! Ist ja was ganz Neues!« Das Blut stieg ihr in den Kopf.
Sein Mund blieb halb offen stehen, dann zogen sich seine Augenbrauen zusammen.
»Jetzt hör mal zu. Hätte ich dich besser den Bullen überlassen sollen, anstatt dich aus ihren Händen zu retten? Kannst du haben! Geh einfach zu ihnen. Dank deines Laptops und deines Rucksacks wissen sie ja auch gar nicht, wer du bist ...«
Sein Kopf flog nach links, die Ohrfeige hatte er nicht kommen sehen. Regina rannte in die andere Ecke des Raums, ließ sich an der Wand zu Boden sinken und vergrub ihren Kopf in den Armen.
Die Minuten verstrichen. Dann setzte sich Ben neben sie und legte den Arm um ihre Schulter. Erst versteifte sie sich, dann ließ sie ihn gewähren und die Tränen fließen.
Ben strich ihr sanft über den Kopf.
»Komm schon, wir schaffen das. Ich kenne Leute, die uns neue Identitäten besorgen können. Wir fangen einfach noch mal von vorne an. Und du kannst nicht gerade behaupten, dass du deinem Traumjob ewig hinterher trauern wirst«, und knuffte ihr in die Seite.
Sie lachte, wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Wie sie wohl aussah ... völlig egal in diesem Moment. Regina kuschelte sich an seinen Arm. Seinen starken Arm. Und schloss die Augen.
»Und wie geht es jetzt weiter?«
Ben küsste sie auf den Kopf und sagte: »Jetzt hören wir erst mal bei den anderen nach, wie sie aus der Scheiße herausgekommen sind. Oder ob wir vor unserem Besuch beim Türken noch zum Baumarkt müssen, um eine Metallsäge für die Gitter zu besorgen.«
»Du kannst auch nicht einen Moment ernst bleiben«, schalt sie ihn.
»Nein. Wenn du in meiner Nähe bist, verliert das Leben an Ernsthaftigkeit.«
»Alter Charmeur.«
Dann stand sie auf und reichte ihrem Adonis die Hand.
»Dann lass uns mal, bevor wir hier endgültig in Tränen versinken.«
Er lächelte zu ihr hoch, griff ihre Hand und ließ sich hochziehen. Sie umarmten und küssten sich.
Es musste einfach weitergehen. Und Ben hatte Recht. Wenn Sie es genau bedachte, war ihr altes Leben nichts, dem sie ewig hinterhertrauern würde. Teile davon würden ihr fehlen. Das Gros aber nicht. Aber konnte Sie als Flüchtling leben? Immer den Kopf unten halten, falsche Identitäten benutzen, immer den Atem der Verfolger im Nacken? Sie schüttelte innerlich den Kopf, alles war so kompliziert geworden. Ein Seitenblick zu ihrem Traummann, dessen Augen selbst in diesem Moment siegessicher strahlten. Hauptsache, er war bei ihr.
»Ischar ist nirgendwo aufzufinden«, sagte Mike und schüttelte den Kopf. Wie eine Klischee-Verschwörer Truppe standen Sie unter dem Bahnhofsvordach, in Reichweite von Taxistation, U-Bahn und mehreren Fluchtmöglichkeiten in alle Richtungen.
»Ich hab auch nichts von ihm gehört«, pflichtete Kevin bei und nippte an seinem Kamps-Kaffee.
Ben warf Regina eine Brötchentüte zu und gesellte sich zu der Truppe.
»Die Bullen haben ihn nicht, da sind meine Informanten absolut sicher.« Die letzten Worte gingen fast im Schmatzen unter, als Ben in sein Bulettenbrötchen biss. Das beste Essen seit Tagen.
Sie standen schweigend beisammen, Nieselregen zog Schlieren über die Welt. Der dumpfe, allgegenwärtige Verkehrslärm übertönte leisere Gespräche.
Mike brach als erster das Schweigen. »Ich sprech es ja nur ungern aus. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das mit den Bullen kein Zufall war. Unsere Truppe ist aufgeflogen.«
Er sprach den Fakt so kühl, fast berechnend aus. Regina schauderte, auch wenn sie Mike mittlerweile gut genug kennengelernt hatte, um zu wissen, dass er in Krisensituationen so reagierte. Ben nannte ihn manchmal »den Vulkanier«. Das passte – wenn es hart auf hart kam. Sonst war auch Mike ein Spaßvogel.
Ben nickte und auch von Kevin kam zwischen zwei Schlucken Kaffee ein zustimmendes Brummen. Wortkarg wie so oft.
»Also?«, fragte Regina in die Runde.
»Also?«, erwiderte Ben und zuckte mit den Achseln. »Wir machen weiter, oder?«
Mike schaute Ben an, zögerte einen Moment, nickte dann fast unmerklich.
»Die ganzen schlauen Sprüche hätten wir uns sparen können, wenn wir schon beim ersten wirklichen Ärger den Schwanz einziehen und zu den McDonalds-Jüngern desertieren.« Der Öko drückte einige hartnäckige Strähnen seines dunkelblonden Haares wieder unter die Norweger-Mütze, die er sich so weit wie möglich ins Gesicht zog. Im wärmsten Winter seit Menschengedenken. Sie sahen wirklich aus wie die Archetypen einer Verschwörergruppe. Warum riefen sie nicht gleich nach den Jungs in Grün?
Kevin nippte weiter an seinem Kaffee, die Sekunden verstrichen. Ein LKW fuhr brummend vorbei. Dann ließ er den Pappbecher sinken und schaute in die Runde. »Ich bin mir nicht sicher. Ganz ehrlich, Jungs. Wir werden eh in der nächsten Zeit die Köpfe unten halten müssen, bis die Bullen ihr Interesse an uns verloren haben. Wenn wir nicht unsere komplette Identität wechseln wollen samt neuem Ausweis und so, werden wir umziehen müssen. Da weiß ich nicht, ob wir uns den Ärger neuer Aktionen in dieser Zeit wirklich aufladen sollten.«
Regina hatte sich bei Ben eingehakt und spürte, wie er die Faust in der Tasche ballte.
»Du willst also die Umweltverschmutzer für ein ›paar Monate‹ gewähren lassen? Die Natur hat auch keinen Urlaub, Kevin!« Er spuckte den Namen fast aus, wie ein Schimpfwort.
Der Dürre zuckte zusammen, blickte schuldbewusst zu Boden.
»Ich sag doch nur für kurze Zeit. Nicht ewig. Dann machen wir natürlich weiter, egal ob hier oder woanders in Deutschland.«
Ben ging zu seinem Mitstreiter, hielt ihn an den Oberarmen fest und schaute ihm ins Gesicht.
»Ich brauche dich, Mann. Ohne dich können wir nicht weitermachen. Wir haben das hier zusammen angefangen, also müssen wir es auch gemeinsam zu Ende bringen. Dass wir in dieser beschissenen Welt des Kommerz und Politikbetrugs am Ende wohl kaum als strahlende Helden in den Sonnenuntergang reiten würden, war uns allen klar.«
Kevin konnte den Blick seines Anführers nicht aushalten und schaute zu Boden. Dann nickte auch er und aus der Umklammerung wurde ein Umarmen. Bens Laune machte einen 180-Grad-Turn und er lachte seinen Mitstreitern zu.
»Wir schaffen das, gemeinsam.«
Regina schluckte. Die letzten Worte ihres Adonis hatte sie sich so bisher nie klar gemacht. Wohin führte ihr Weg, wenn man ihn mal zu Ende dachte? Letztlich doch ins Gefängnis. Oder ein »ewiges«- und wahrscheinlich kurzes – Leben im Untergrund, dauernd auf der Flucht. War es das, was sie wollte? Gab es noch eine Abfahrt »normales Leben«?
Ben nahm sie am Arm, ging mit ihr und den anderen hinunter zur U-Bahn.
Er musste ihre Zweifel gespürt haben, jedenfalls setzte er sich in der U-Bahn mit einem Nicken zu den anderen allein mit ihr auf eine Bank. Ben verscheuchte ein paar Punks, die die restlichen beiden Sitzplätze in der Vierergruppe ergattern wollten und sich daraufhin vom Acker machten. So sicherte er ihnen den größtmöglichen Raum an Privatsphäre, den das moderne Reisen ohne Auto bieten konnte. Einen Einzelplatz in einer brechend vollen U-Bahn. Mitten im modernen Sprachen- und Geruchsgewirr, das über allem lag mit seiner Mischung aus Deo-, Achselschweiß- und Pommesgeruch.
»Willst du aussteigen, Schatz?« Er sah ihr tief in die Augen, strich ihr über die Wange. »Wenn es das ist, was dich glücklich macht, werde ich das möglich machen. Okay, anderer Name und andere Stadt, darum wirst du kaum herumkommen nach dem unerfreulichen Aufeinandertreffen mit den Grünen Männchen. Aber du könntest wieder halbwegs normal leben.«
Sie zuckte mit den Achseln, kämpfte mit den Tränen, blickte zu Boden. Sanft hob er ihr Kinn hoch und legte seine Stirn an ihre.
Die U-Bahn fuhr ratternd los, ihre Köpfe schaukelten.
»Hör mir zu, Baby. Du hast hinter den Vorhang geblickt. Gesehen, was in dieser Welt möglich ist, wenn man mit den lächerlichen Vorschriften der ach so aufgeklärten Beckmann-Jauch-Teletubby-Gesellschaft bricht.« Er ließ seinen Blick durch die prall gefüllte Bahn streifen.
»Willst du wirklich wieder zurück zu den Horden uninformierten Wahlviehs? Oder den Handzettel-Verteilern von Greenpeace?«
Ihr Kopf schwirrte. So viele Fragen, so schwerwiegende Entscheidungen. Regina schaute zu ihm hoch, ihre Blicke trafen sich. Und das Gefühl kehrte zurück, das wichtigste Gefühl in ihrem Leben. Das, das sie die letzten Wochen bereits begleitet hatte: Sicherheit. Sie spürte es tief in ihrem Inneren mit einer Vehemenz, die alles andere davonwischte. Mit ihm an ihrer Seite fühlte sie sich sicher. Sie gestand sich ein, dass es ihr letztlich relativ egal war, was sie da taten. Wenn sie ihn aufgefordert hätte, mit ihm als Schausteller über die Lande zu ziehen oder nach Australien auszuwandern um Straußenfarmer zu werden, sie hätte es genauso getan. Sie stand der grünen Sache nahe und gestand sich durchaus ein, dass ihre Aktionen in wenigen Wochen sicherlich mehr bewirkt hatten, als die lokale Greenpeace-Zelle in Jahren geschafft hatte. Richtig fühlten sich Sachbeschädigung, Einbruch und Diebstahl trotzdem nicht an. Dafür sein Blick, sein Geruch, den sie selbst hier, in dieser Geschmacksverwirrung von U-Bahn, riechen konnte. Es war völlig egal, wofür oder wogegen sie kämpften. Solange sie an seiner Seite war. Über das Ende, das irgendwann unausweichlich kommen musste und wahrscheinlich Knast hieß, wollte sie nicht nachdenken. Noch Jahrzehnte Lohnsklavin zu sein und irgendwann dankbar über ihre Einheitsrente auf der Couch im Altenheim zu sitzen und Quizshows zu schauen, konnte sie sich auch nicht vorstellen. Dann lieber wie eine Sternschnuppe leben: Schnell, hell und dann verglühen. Wenn es am schönsten war.