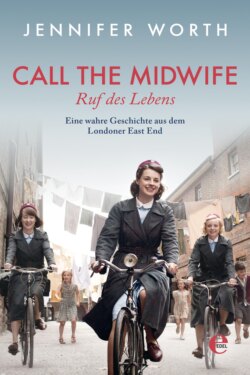Читать книгу Call the Midwife - Ruf des Lebens - Jennifer Worth - Страница 11
Molly
ОглавлениеAls ich Molly in ihrer Wohnung in den »kanadischen« Wohnblocks besuchen wollte, um die Möglichkeit einer Hausgeburt nachzukontrollieren, war sie nicht da. Ich musste zweimal wiederkommen, bis ich sie antraf. Beim ersten Mal dachte ich, ich hätte jemanden in der Wohnung gehört, und klopfte mehrmals an. Es war mit Sicherheit jemand da, doch die Tür war abgeschlossen und niemand öffnete.
Beim dritten Besuch kam Molly zur Tür. Sie sah schrecklich aus. Sie war erst neunzehn, aber sie wirkte blass und ausgezehrt. Strähniges, fettiges Haar hing an ihrem schmutzigen Gesicht herunter und die beiden verdreckten kleinen Jungen klammerten sich an ihr Kleid. Eine Woche war seit meinem ersten Besuch vergangen, bei dem ich den Streit gestört hatte, und ein Blick in das Zimmer genügte, um festzustellen, dass der Haushalt keineswegs in einem besseren, sondern in einem noch schlimmeren Zustand war. Ich sagte ihr, dass wir die Wohnung mit Blick auf eine Hausgeburt neu begutachteten und dass es vielleicht besser wäre, wenn sie zur Entbindung ins Krankenhaus ginge. Sie zuckte mit den Schultern, es schien ihr gleich. Ich erklärte ihr, dass es gefährlich werden könne, weil sie nicht zur Vorsorgesprechstunde gekommen war. Wieder zuckte sie mit den Schultern. So kam ich nicht weiter.
Ich sagte: »Wie kann es denn sein, dass die Hebammen vor vier Monaten Ihre Wohnung als zufriedenstellend für eine Hausgeburt beurteilt haben, und jetzt ist sie es nicht mehr?«
»Na, die Mutter is halt dagewesen un hat aufgeräumt.«
Wenigstens ein bisschen Kommunikation. Es gab also eine Mutter. Ich bat sie um ihre Adresse. Sie wohnte im Nachbarblock. Gut.
Für eine Geburt im Krankenhaus musste sich die werdende Mutter frühzeitig über ihren Arzt anmelden. Ich konnte mir keineswegs sicher sein, dass Molly das tat. Sie schien mir zu schlampig und apathisch, um sich über irgendetwas Gedanken zu machen. Wenn sie nicht zur Vorsorgesprechstunde geht, dann wird sie sich auch nicht die Mühe machen, die Entbindung neu zu planen, dachte ich, und ich konnte mir gut vorstellen, dass wir in zwei, drei Wochen um Mitternacht einen Anruf bekämen, auf den wir reagieren mussten. Ich beschloss, ihre Mutter zu besuchen und ihrem Arzt Bericht zu erstatten.
Die »kanadischen« Gebäude mit den Namen Ontario, Baffin, Hudson, Ottawa und so weiter waren sechs Wohnblocks zwischen Blackwall Tunnel und Blackwall Stairs, in denen die Menschen dicht an dicht lebten. Jeder Block hatte etwa sechs Stockwerke und war nur sehr dürftig mit je einem Wasserhahn und einer Toilette am Ende jeder Galerie ausgestattet. Es lag außerhalb meiner Vorstellungskraft, wie man dort leben und dabei Reinlichkeit und Selbstachtung bewahren konnte. Es hieß, dass um die fünftausend Menschen in den kanadischen Wohnblocks lebten.
Ich fand die Wohnung von Mollys Mutter Marjorie im Block »Ontario« und klopfte. Eine muntere Stimme rief: »Komm rein, Liebes.« Die typische Begrüßung der Bewohner des East Ends, ganz gleich, wer man war. Die Tür wurde aufgeschlossen. Ich trat ein und stand sofort im größten Zimmer der Wohnung. Als ich hineinkam, drehte sich Marjorie mit einem strahlenden Lächeln zu mir um. Doch das Lächeln verschwand, sobald sie mich sah, und sie ließ die Arme auf beiden Seiten hängen.
»Oh nein. Nein. Nich schon wieder. Sie kommen wegen unsrer Moll, nich wahr?« Sie setzte sich auf einen Stuhl, schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte.
Es war mir peinlich. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Manche Menschen sind gut im Umgang mit anderen und ihren Problemen, aber ich habe diese Gabe nicht. Je aufgewühlter die Leute sind, umso schlechter komme ich damit zurecht. Ich stellte meine Tasche auf einen Stuhl, setzte mich neben sie und schwieg. Ich nutzte die Gelegenheit, mich im Zimmer umzusehen.
Nachdem ich den Dreck in Mollys Wohnung gesehen hatte, hatte ich erwartet, dass es bei ihrer Mutter ähnlich aussah, doch der Unterschied konnte nicht größer sein. Das Zimmer war sauber und aufgeräumt und roch angenehm. Hübsche Vorhänge zierten geputzte Fenster. Auch die Teppiche waren gebürstet und ausgeklopft. Ein Kessel blubberte auf dem Gasherd. Marjorie trug ein sauberes Kleid mit Schürze, ihr Haar war gebürstet und gepflegt.
Beim Anblick des Kessels kam mir eine Idee, und als ihr Schluchzen langsam nachließ, sagte ich: »Wie wärs denn mit einer schönen Tasse Tee für uns beide. Ich bin völlig ausgedörrt.«
Ihr Gesicht erhellte sich und sie sagte mit der für Cockneys typischen Höflichkeit: »Tschuldigung, Schwester. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Das mit Moll regt mich immer arg auf, so is es halt.«
Sie stand auf und kochte Tee. Es half ihr, etwas zu tun zu haben, und so schniefte sie die Tränen weg. Während der nächsten zwanzig Minuten schüttete sie mir ihr Herz aus und erzählte mir von ihren Hoffnungen und Sorgen.
Molly war das jüngste von fünf Kindern. Sie hatte ihren Vater nie kennengelernt, denn er war während des Kriegs in Arnheim ums Leben gekommen. Die ganze Familie war nach Gloucestershire ausquartiert worden.
Marjorie erzählte: »Ich weiß nich, ob sie das aus der Bahn geworfen hat oder was, aber aus den andern is was geworden.«
Die Familie kehrte nach London zurück und zog im Block »Ontario« ein. Molly schien sich an die neue Umgebung und ihre neue Schule zu gewöhnen und brachte gute Noten nach Hause.
»Sie war so helle«, sagte Marjorie. »Immer bei den Klassenbesten. Sie hätt Sekritärin werden können und in nem Bürro oben im Westen arbeiten können, hätt se. Ach, ’s bricht mir das Herz, wenn ich da dran denk.«
Sie schluchzte und griff nach ihrem Taschentuch. »Sie war so vierzehn, als sie diesen Scheißkerl Richard kennengelernt hat. Dann blieb sie abends immer lang weg un hat gesagt, sie wär drüben im Jugendklub, aber ich hab gewusst, dass sie mich anlügt, also hab ich den Pfarrer gefragt un der sagt mir, dass Moll nich mal Mitglied war. Dann blieb sie die ganze Nacht lang weg. Ach, Schwester, Sie wissen ja gar nich, was das bei ner Mutter anrichtet.«
Die gepflegte kleine Person in ihrer geblümten Schürze schluchzte in sich hinein. »Jede Nacht bin ich durch die Straßen gelaufen un hab sie gesucht, nur gefunden hab ich sie nich. Natürlich nich. Am Morgen is sie immer nach Haus gekommen un hat mir ’n Haufen Lügen erzählt, als wär ich blöd, un dann is sie zur Schule. Als sie sechzehn war, hat sie gesagt, dass sie ihren Dick heiraten will. Ich hab gedacht, dass sie wahrscheinlich eh schwanger war, also hab ich gesagt: ›Das is das Beste, was du tun kannst, mein Liebes.‹«
Sie heirateten und zogen in zwei Zimmer im Block »Baffin«. Schon von Anfang an tat Molly nichts im Haushalt. Marjorie besuchte sie und versuchte ihrer Tochter zu zeigen, wie man eine Wohnung in Ordnung hält, doch ohne Erfolg. Bei ihrem nächsten Besuch war es wieder so schmutzig wie zuvor.
»Ich weiß nich, wo sie diese faule Art herhat«, sagte Marjorie.
Anfangs machten Dick und Molly einen glücklichen Eindruck, und obwohl Dick offenbar keiner regelmäßigen Arbeit nachging, erhoffte sich Marjorie das Beste für ihre Tochter. Das erste Baby kam zur Welt und Molly schien glücklich zu sein, doch schon bald ging es bergab. Marjorie bemerkte blaue Flecken am Hals und an den Armen ihrer Tochter, eine Wunde über dem Auge und einmal humpelte sie sogar. Jedes Mal erzählte Molly, sie sei hingefallen. In Marjorie regte sich ein Verdacht, doch ihre Beziehung zu Dick, die nie herzlich gewesen war, zerbrach allmählich ganz.
»Er hasst mich«, sagte sie, »und lässt mich gar nicht mehr zu ihr und den Jungs. Und ich kann nix machen. Ich weiß nich, was schlimmer is. Zu wissen, dass er meine Tochter schlägt, oder zu wissen, dass er die Kinder schlägt. Am besten wars, als er mal sechs Monate gesessen hat. Da hab ich gewusst, jetzt passiert ihnen nix.«
Wieder musste sie weinen und ich fragte sie, ob die Sozialarbeiter ihr irgendwie helfen könnten.
»Nein, nein. Sie sagt kein Wort gegen ihn, macht se nich. Er hat sie so im Griff, ich glaub, sie hat schon gar keinen eigenen Kopf mehr.«
Ich empfand großes Mitgefühl für die arme Frau und ihre unvernünftige Tochter. Am meisten bewegte mich jedoch das Schicksal der beiden kleinen Jungen, die ich damals, als ich während des Streits erschienen war, in einem so mitleiderregenden Zustand erlebt hatte. Und jetzt war ein drittes Kind unterwegs.
Ich sagte: »Der Hauptgrund für meinen Besuch bei Ihnen ist das Baby, das bald geboren wird. Molly ist für eine Hausgeburt angemeldet, aber ich glaube, dass das nur möglich war, weil Sie die Wohnung vor unserer Begehung aufgeräumt hatten.« Sie nickte. »Inzwischen glauben wir, dass eine Krankenhausgeburt das Beste wäre, aber dazu muss sie sich dort anmelden und sie muss zu den Vorsorgesprechstunden gehen. Ich glaube nicht, dass sie das tun wird. Können Sie helfen?«
Marjorie brach wieder in Tränen aus. »Alles auf der Welt würde ich für sie und die Kinder tun, aber der Scheißkerl lässt mich nicht zu ihnen. Was kann ich denn tun?«
Sie nagte an ihren Fingernägeln und putzte sich die Nase.
Die Lage war verzwickt. Ich überlegte, ob wir nicht einfach eine Hausgeburt ablehnen und stattdessen die Ärzte informieren sollten. Dann würde man Molly sagen, dass sie sofort nach Einsetzen der Wehen ins Krankenhaus gehen solle. Wenn sie eine pränatale Versorgung ablehnte, war es allein ihr eigenes Versäumnis.
Ich ließ Marjorie mit ihren traurigen Gedanken zurück und erstattete den Schwestern Bericht. Es wurde schließlich ohne Mollys aktives Einverständnis eine Krankenhausgeburt arrangiert und ich dachte, jetzt würden wir nichts weiter von ihr hören.
Doch so kam es nicht. Etwa drei Wochen später bekamen wir einen Anruf aus dem Krankenhaus von Poplar mit der Bitte, Molly zur Nachsorge zu besuchen, denn sie hatte sich selbst mit dem Baby am dritten Tag nach der Entbindung entlassen.
So etwas hatte man kaum je zuvor gehört. Damals galt für alle – für medizinisches Personal wie für Laien –, dass eine junge Mutter zwei Wochen lang im Bett blieb. Molly hingegen war wohl zu Fuß mit ihrem Baby nach Hause gegangen und das hielt man für sehr gefährlich. Schwester Bernadette machte sich sofort auf den Weg zu Block »Baffin«.
Anschließend berichtete sie, dass Molly dort sei. Sie war wohl wesentlich sauberer als zuvor, aber ebenso trübsinnig wie sonst. Dick war nicht zu Hause. Solange Molly im Krankenhaus gewesen war, hatte er offenbar auf die Kinder aufpassen sollen, doch ob er das getan hatte oder nicht, konnte niemand mit Sicherheit sagen. Marjorie hatte angeboten, sich um sie zu kümmern, doch Dick hatte sich geweigert, es seien ja schließlich seine Kinder und er habe nicht vor, diese alte Schachtel ihre Nase in seine Familienangelegenheiten stecken zu lassen.
In der Wohnung hatte es nichts zu essen gegeben. Vielleicht hatte Molly das geahnt und sich deswegen selbst entlassen. Sie hatte kein Geld bei sich, doch als sie mit dem Baby nach Hause ging, war sie bei der Fleischerei vorbeigegangen und hatte den Metzger angefleht, ein paar Fleischpasteten anschreiben lassen zu dürfen. Da dieser ihre Mutter kannte und schätzte, hatte er sie Molly gegeben. Als Schwester Bernadette angekommen war, hatten die beiden kleinen Jungen, die nichts als schmutzige Pullover trugen, auf dem Boden gesessen und gierig die Pasteten verschlungen.
Molly hatte kaum ein Wort gesagt, wie uns Schwester Bernadette erzählte. Sie hatte die Untersuchung über sich ergehen lassen und auch zugelassen, dass das Baby, ein kleines Mädchen, untersucht wurde, doch unterdessen war sie mürrisch und stumm geblieben. Schwester Bernadette hatte ihr gesagt, sie wolle Marjorie erzählen, dass ihre Tochter nun zu Hause sei.
»Wenn Sie meinen«, hatte sie nur zur Antwort gegeben.
Marjorie hatte von den jüngsten Ereignissen nichts mitbekommen und lief gleich hinüber zu Block »Baffin«. Unglücklicherweise kam Dick im gleichen Moment nach Hause zurück und sie begegneten einander auf dem Treppenabsatz. Betrunken ging er auf sie los, aber Marjorie wich ihm aus. Hätte er sie getroffen, sie wäre die Steinstufen hinabgestürzt. Danach traute sich die arme Frau nur noch, Lebensmittel zu kaufen und sie auf dem Absatz vor der Wohnungstür ihrer Tochter abzustellen.
Wir besuchten unsere Patientinnen üblicherweise bis zwei Wochen nach der Geburt zweimal täglich. Molly und das Baby waren rein medizinisch gesehen wohlauf, aber im Haushalt sah es so schlimm wie immer aus. Manchmal war Dick zu Hause, manchmal nicht. Die arme Marjorie bekamen wir nie dort zu Gesicht. Für Molly und die Kinder hätte ihre Anwesenheit einen riesigen Unterschied bedeutet. Ihre Fröhlichkeit allein hätte die Atmosphäre deutlich aufgehellt, doch sie durfte nicht zu ihnen. Sie musste damit zufrieden sein, sich im Nonnatus House bei den Schwestern zu erkundigen, wie es ihrer Tochter und ihren Enkelkindern gehe. Einmal gab sie uns eine Tasche mit Babykleidern, die wir bei unserem nächsten Besuch mitnehmen sollten. Sie sagte, sie wolle die Sachen nicht auf dem Absatz zurücklassen, sie könnten feucht werden.
Während der folgenden Tage bekam Molly Besuch von unterschiedlichen Schwestern, die alle von der gleichen beunruhigenden Lage berichteten. Eine sagte, sie sei kurz davor gewesen, sich zu übergeben, und habe raus an die frische Luft laufen müssen, um ihren Magen zu beruhigen. Am Abend des achten Tages besuchte ich Molly, doch auf mein Klopfen folgte keine Reaktion. Die Tür war abgeschlossen, also klopfte ich wieder – keine Antwort. Da es erst fünf Uhr war, beschloss ich, zuerst die anderen Besuche zu absolvieren und später wiederzukommen.
Es war etwa acht Uhr, als ich zum Block »Baffin« zurückkehrte. Ich war müde und der Aufstieg zum fünften Stock kam mir sehr lang vor. Ich war fast versucht, den Besuch auszulassen. Schließlich waren Molly und das Baby ja in einem medizinisch zufriedenstellenden Zustand, und dafür zu sorgen, war unsere eigentliche Aufgabe. Doch irgendetwas drängte mich, diesen Besuch nicht zu übergehen, also stieg ich erschöpft die Stufen hinauf.
Ich klopfte und wieder kam keine Antwort. Ich klopfte noch einmal, diesmal lauter – sie kann ja nicht immer noch beschäftigt sein, dachte ich. Eine der Nachbartüren auf der Galerie öffnete sich und eine Frau erschien.
»Die is nich da«, sagte sie. Eine Zigarettenkippe klebte an ihrer Unterlippe.
»Nicht da! Was soll das heißen? Sie hat doch gerade erst ein Baby bekommen.«
»Die is trotzdem nich da, wenn ichs Ihnen doch sag. Hab sie mit eignen Augen gehen sehn. Aufgetakelt wie sie war.«
»Wo ist sie denn hin?« Der Gedanke, dass sie zu ihrer Mutter gegangen sein könnte, schoss mir in den Sinn. »Hatte sie die drei Kinder dabei?«
Die Frau lachte schrill auf, dass ihre Kippe zu Boden fiel. Als sie sich bückte, um sie aufzuheben, klapperten ihre Lockenwickler.
»Was! Drei Kinder! Machen Sie Witze? Drei Kinder sin ja wohl ein bisschen viel für die, oder?«
Die Frau gefiel mir nicht. Etwas in der Art, wie sie mich wissend angrinste, war äußerst unangenehm. Ich wandte ihr den Rücken zu, klopfte noch einmal und rief durch den Briefkastenschlitz: »Lassen Sie mich doch bitte rein, ich bins, die Hebamme.«
Jetzt hörte ich ganz deutlich, dass sich drinnen jemand bewegte. Etwas verschämt, weil ich wusste, dass diese Frau mich angaffte, kniete ich mich hin und schaute durch den Briefkastenschlitz.
Ein Augenpaar dicht vor mir erwiderte meinen Blick. Es waren die Augen eines Kindes und sie starrten mich etwa zehn Sekunden ohne zu blinzeln an, dann verschwanden sie. So konnte ich in das Zimmer blicken.
Das schwache grünlich blaue Licht kam von einem unbewachten Ölofen. Daneben stand ein Kinderwagen, in dem vermutlich das Baby schlief. Ich sah, wie einer der Jungen durch das Zimmer lief. Der andere saß in einer Ecke.
Ich schnappte vor Schreck laut nach Luft. Die Frau musste es gehört haben. Sie sagte: »Na, glauben Sies mir jetzt? Ich hab Ihnen doch gesagt, die is nich da.«
Mir wurde klar, dass ich diese Frau ins Vertrauen ziehen musste. Vielleicht konnte sie ja helfen. »Wir können die drei Kinder da drin nicht allein lassen. Nicht mit dieser Ölheizung. Wenn eins sie umwirft, verbrennen sie alle. Wenn Molly nicht da ist, wo ist denn der Vater?«
Die Frau kam näher. Sie gefiel sich offenbar in der Rolle der Überbringerin schlechter Nachrichten. »Er is ein ganz Übler – dieser Dick, mein ich. Hör’n Sie mal gut zu. Mit dem wollen Sie bestimmt nix zu tun kriegen. Er behandelt sie schäbig, und ’s geschieht ihr ganz recht. Ach es is ne Schande, sag ich noch zu unsrer Betty, ne Schande, sag ich. Die armen kleinen Kinder. Die haben nich drum gebeten, auf die Welt zu kommen, oder? Ich sag immer nur …«
Ich unterbrach sie. »Diese Ölheizung ist eine Todesfalle. Ich rufe jetzt die Polizei. Wir müssen da rein.«
Ihre Augen leuchteten und sie schnalzte mit den Zähnen. Sie packte meinen Arm und sagte: »Sie holen jetzt wirklich die Polizei? Mannomann!«
Dann hastete sie die Galerie entlang und klopfte an die nächste Tür. Ich stellte mir vor, wie sie die Nachrichten im ganzen Block »Baffin« verbreitete, und wenn es die ganze Nacht dauerte. Meine Müdigkeit war vergangen, ich eilte die Treppen hinunter bis ins Erdgeschoss und rannte fast bis zur nächsten Telefonzelle. Der Polizist am anderen Ende hörte sich meine Geschichte besorgt an und sagte, es komme sofort jemand vorbei. Auch Marjorie musste informiert werden, befand ich. Also führte mich mein nächster Weg zum Block »Ontario«.
Die arme Frau. Als ich ihr erzählte, was geschehen war, brach sie zusammen, als hätte ich ihr in den Magen geschlagen.
»Oh nein, ich ertrags nich mehr«, stöhnte sie. »Hab ichs doch geahnt. Dann ist sie also anschaffen gegangen.«
Ich war ein solches Unschuldslamm, dass ich nicht wusste, wovon sie sprach.
»Anschaffen?«, fragte ich und dachte an Besorgungen machen oder so etwas.
Marjorie sah mich mitfühlend an. »Mach dir keine Gedanken, Liebchen. Davon musst du nix wissen. Ich muss los un nach den Kindern schaun.«
Wir gingen stumm nebeneinander her. Die Polizei war bereits an der Tür und beschäftigte sich mit dem Schloss. Ich hatte erwartet, dass die Polizisten einen Schlosser mitbringen, aber das war nicht nötig – die meisten sind selbst Experten im Schlösserknacken. Ob sie das in ihrer Ausbildung lernen?, fragte ich mich.
Eine Gruppe Menschen hatte sich auf der Galerie versammelt. Keiner wollte sich das entgehen lassen. Marjorie trat vor und sagte, sie sei die Großmutter, und als die Tür geöffnet wurde, war sie die Erste, die eintrat. Ich folgte gemeinsam mit der Polizei.
Es war stickig heiß in dem Zimmer und es stank nach Verfaultem. Die Kinder waren nicht zu sehen, nur das Baby schlief selig. Ich ging hinüber zu dem kleinen Mädchen. Es sah überraschend gut versorgt, sauber und wohlgenährt aus. Der Rest des Zimmers war in einem unbeschreiblichen Zustand. Vor allem war er voller Fliegen und in einem Haufen aus Exkrementen und schmutzigen Windeln krochen bereits die Maden.
Marjorie ging ins Schlafzimmer und rief sanft die Namen der beiden Jungen. Sie standen hinter dem Stuhl. Sie nahm sie in ihre Arme, die Tränen strömten ihr über das Gesicht.
»Alles ist gut, ihr Liebchen, Nanna is bei euch.«
Die Polizisten machten sich Notizen, und so überlegte ich, ob ich gehen und alles Weitere der Großmutter überlassen sollte. Doch in diesem Moment war ein Tumult von draußen zu hören und Dick erschien in der Tür. Er hatte offenbar nicht gewusst, dass Polizisten in seiner Wohnung waren. Kaum erblickte er sie, drehte er sich um, doch die Schaulustigen hinderten ihn am Davonlaufen. Sie hatten ihn hereingelassen, doch gehen lassen wollten sie ihn nicht. Vielleicht gab es noch eine Menge offener Rechnungen zwischen Dick und seinen Nachbarn. Man sagte ihm, dass er wegen Vernachlässigung dreier Kinder unter fünf Jahren verwarnt werde.
Er fluchte, spuckte aus und rief: »Was fehlt denen denn? Den Kindern gehts doch gut. Is doch nix passiert, soweit ich seh.«
»Sie haben Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Sie haben sie mit der brennenden Ölheizung unbeaufsichtigt gelassen. Wenn eines der Kinder sie umgestoßen hätte, hätte leicht ein Feuer ausbrechen können.«
Dick fing an zu jammern. »Das is doch nich mein Fehler. Ich hab die Heizung nich angemacht. Das war meine Frau. Ich hab nich gewusst, dass sie raus is un sie angelassen hat. Faules Luder. Ich werds ihr zeigen, wenn sie heimkommt.«
»Wo ist Ihre Frau?«, fragte der Polizist.
»Wie soll ich ’n das wissen?«
Marjorie schrie ihn an: »Du Schuft. Du weißt doch ganz genau, wo sie is. Un du hast sie auch losgeschickt, oder etwa nich? Du Schwein.«
Dick war die Unschuld selbst: »Was will die alte Kuh denn jetz wieder?«
Marjorie wollte ihm ihre Antwort entgegenschreien, doch der Polizist bremste sie. »Sie können Ihre Differenzen beilegen, wenn wir wieder weg sind. Wir haben aktenkundig gemacht, dass Sie verwarnt wurden, weil Sie Ihre Kinder unbeaufsichtigt gelassen haben, und das in einer gefährlichen Situation. Sollte das noch einmal vorkommen, müssen Sie mit einer Anzeige rechnen.«
Dick gab sich unterwürfig und charmant. »Sie können sich auf mein Wort verlassen, dass so etwas nicht wieder vorkommt, Officer. Ich möchte mich entschuldigen und ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder passiert.«
Die Polizisten wollten nun aufbrechen. Dick zeigte auf Marjorie und sagte: »Und die können Sie auch gleich mitnehmen.«
Sie stieß einen verzweifelten Schrei aus und drückte die beiden Jungen fester an sich. Dann flehte sie die Polizisten an: »Ich kann sie doch nicht hierlassen, das Baby und die Jungs. Verstehen Sie das denn nicht? So kann ich sie doch nicht hier zurücklassen.«
Dick sagte mit beschwichtigender, heiterer Stimme: »Mach dir nur keine Sorgen, Oma, ich kann auf meine Kinder aufpassen. Es gibt nix, weswegen man sich Sorgen machen muss.« Und zu dem Polizisten: »Bei mir sin sie sicher. Da geb ich Ihnen mein Wort drauf.«
Die Polizisten waren nicht blind und ließen sich keine Sekunde lang von dieser gestellten väterlichen Fürsorge täuschen. Doch alles, was in ihrer Macht stand, war, ihn zu verwarnen.
Einer wandte sich an Marjorie: »Sie können nur hierbleiben, wenn Sie eingeladen sind, und Sie können auf keinen Fall ohne das Einverständnis des Vaters die Kinder mitnehmen.«
Dick triumphierte. »Da hörst du’s. Du brauchst das Einverständnis des Vaters. Ich bin der Vater und ich bin nicht einverstanden, alles klar? Und jetzt raus mit dir.«
Nun meldete ich mich zu Wort: »Was ist denn mit dem Baby? Es ist erst acht Tage alt und es wird gestillt. Es wird bald aufwachen und Hunger haben. Wo ist Molly?«
Ich glaube, er hatte mich zuvor noch gar nicht bemerkt. Er drehte sich um und gaffte mich von oben bis unten an. Fast schien es mir, als zöge er mich in seiner Vorstellung aus. Er war ein widerlicher Typ, aber zweifelsohne hielt er sich für ein göttliches Geschenk für alle Frauen. Er kam zu mir herüber.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Schwesterchen. Die Frau wird sie schon stillen, wenn sie zurückkommt. Sie ist nur eben mal für ne Minute weg.«
Er nahm meine Hand in beide Hände und strich mir über das Handgelenk. Mit einem Ruck zog ich sie weg. Ich wollte ihm mitten in sein lüstern grinsendes Gesicht schlagen, das mir nun so nahe war, dass ich seinen üblen Atem riechen konnte. Vor Ekel drehte ich meinen Kopf weg. Er kam noch näher und seine Augen leuchteten vor gespieltem Interesse. Er senkte seine Stimme, sodass niemand sonst ihn hören konnte:
»Wir sind wohl was Feineres, ne? Ich weiß schon, wie ich dich auf den Boden zurückhole, Miss Etepetete.«
Ich wusste, wie man mit solchen Männern umgehen muss. Körpergröße macht viel aus, um sich auf Augenhöhe zu begegnen, und wir waren auf einer Höhe. Ich musste nichts sagen. Ich drehte meinen Kopf langsam zurück, sah ihm direkt in die Augen und behielt sie fest im Blick. Sein Grinsen verging allmählich und er drehte sich weg. Nur wenige Männer ertragen den verächtlichen Blick einer Frau.
Marjorie kniete hemmungslos weinend auf dem Boden und hielt die beiden kleinen Jungen umklammert. Der Polizist ging zu ihr, nahm ihren Arm, half ihr auf die Beine und sagte ruhig: »Kommen Sie, Mutter, hier können Sie nicht bleiben.«
Marjorie stand auf und die Kinder zogen sich still hinter den Stuhl im Schlafzimmer zurück. Sie stöhnte vor Verzweiflung und ließ sich von dem Polizisten zur Tür führen. Sie stolperte als gebrochene Frau hinaus und sah zwanzig Jahre älter aus als bei ihrem Eintreffen. Als man sie durch die Menschentraube an der Tür begleitete, hörte man viele mitleidige Stimmen.
»Ach, die Arme.«
»Es is eine Schande.«
»Da kann man nur Mitleid haben, nich?«
»Was is der für’n Schuft.«
»Es is ne echte Schande, aber ehrlich.«
Sie wurde bis zum Block »Ontario« begleitet, und ich kehrte zum Nonnatus House zurück, wo ich in der folgenden Nacht viel nachzudenken hatte.