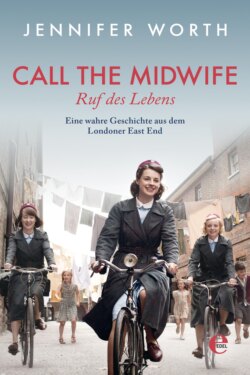Читать книгу Call the Midwife - Ruf des Lebens - Jennifer Worth - Страница 8
Nonnatus House
ОглавлениеHätte mir jemand zwei Jahre zuvor erzählt, dass ich in einem Kloster eine Ausbildung zur Hebamme machen würde, ich hätte Reißaus genommen. Ich war doch nicht so eine. Ein Kloster war etwas für kleine Heilige Marias, langweilig und bieder. Nichts für mich. Ich dachte, das Nonnatus House wäre ein kleines Privatkrankenhaus, so wie es sie damals im ganzen Land zu Hunderten gab.
An einem feuchten Oktoberabend kam ich mit Sack und Pack dort an. Ich kannte von London nur das West End. Der Bus aus Aldgate brachte mich in ein ganz anderes London: mit engen, unbeleuchteten Straßen, Trümmergeländen und schmutzigen, grauen Gebäuden. Mit einiger Mühe fand ich die Leyland Street und suchte das Krankenhaus. Es war nicht da. Vielleicht hatte ich die falsche Adresse.
Ich sprach eine Passantin an und fragte nach den Hebammen des Heiligen Raymund Nonnatus. Die Dame stellte ihr Einkaufsnetz ab und strahlte mich fröhlich an. Die fehlenden Schneidezähne betonten die Herzlichkeit ihres Ausdrucks. Ihre metallenen Lockenwickler glänzten in der Dunkelheit. Sie nahm die Zigarette aus dem Mund und sagte etwas, das klang wie: »Du wisch schum Nonnatuns Aursch, wa, Schätzsch’n?« Ich starrte sie an und versuchte herauszubekommen, was sie meinte. Ich hatte nichts davon gesagt, irgendetwas zu »wischen«, vor allem nicht irgendjemandes »Aursch«.
»Nein, ich suche die Hebammen des Heiligen Raymund Nonnatus.«
»Yeah. Hab isch doch gesacht, Häschen. Die Nonnatuns. Da drü’m, Schätzsch’n. Das isch ihr Aursch.«
Sie tätschelte mir beruhigend den Arm, wies auf das Gebäude, steckte die Zigarette zurück in den Mund und watschelte davon, wobei ihre Pantoffeln über das Pflaster schlappten.
An diesem Punkt meiner Geschichte muss ich dem erstaunten Leser etwas zum Cockneydialekt sagen. Reines Cockney ist für Außenstehende zunächst unverständlich, doch das Ohr gewöhnt sich allmählich an die Vokale und Konsonanten, die Flexion und die Redeweise und nach einer Weile begreift man alles. Während ich über die Menschen der Docklands schreibe, höre ich ihre Stimmen in meinem Kopf, doch der Versuch, ihren Dialekt zu Papier zu bringen, stellt eine gewisse Herausforderung dar.
Doch ich schweife ab.
Ich betrachtete skeptisch das Gebäude: Ich sah einen schmutzig roten Ziegelbau, viktorianische Bögen und Türmchen, eiserne Geländer, kein Licht und all das gleich neben einem Trümmergrundstück. Wohin um alles in der Welt hat es mich hier verschlagen?, fragte ich mich. Das ist doch kein Krankenhaus.
Ich zog am Klingelknauf und ein tiefes Läuten war von drinnen zu hören. Kurz darauf hörte ich Schritte. Die Tür wurde von einer Frau in seltsamen Kleidern geöffnet – sie war weder wie eine Krankenschwester gekleidet noch so recht wie eine Nonne. Sie war groß und dünn und sehr, sehr alt. Sie sah mich mindestens eine Minute lang geradeheraus an, ohne etwas zu sagen, dann lehnte sie sich vor und nahm meine Hand. Sie sah sich in alle Richtungen um, zog mich in die Eingangshalle und flüsterte verschwörerisch: »Die Pole treiben auseinander, meine Liebe.«
Vor lauter Verwunderung fand ich keine Worte, doch zum Glück wartete sie gar nicht auf meine Reaktion und fuhr in fast atemloser Begeisterung fort: »Ja, und Mars und Venus sind in Konjunktion. Sie wissen sicher, was das bedeutet?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Oh, meine Liebe, die statischen Kräfte, die Konvergenz des Flüssigen mit dem Festen, das Hexagon senkt sich und durchquert den Äther. Ganz besondere Zeiten erleben wir. Wie aufregend. Die kleinen Engel klatschen schon mit den Flügeln.«
Sie lachte, klatschte in ihre knochigen Hände und vollführte ein kleines Tänzchen.
»Aber kommen Sie herein, kommen Sie, meine Liebe. Sie müssen einen Tee trinken und ein Stück Kuchen essen. Der Kuchen ist sehr lecker. Mögen Sie Kuchen?«
Ich nickte.
»Ich auch. Essen wir zusammen ein Stück, meine Liebe, und dann müssen Sie mir Ihre Meinung zu der Theorie verraten, dass die Tiefen des Universums durch die Schwerkraft beständig zusammengezogen werden, um neue Himmelskörper zu bilden.«
Sie drehte sich um und marschierte geschwind einen mit Steinfliesen ausgelegten Flur hinunter, umweht von ihrem weißen Schleier. Ich zweifelte noch, ob ich ihr folgen sollte, denn ich war überzeugt, an der falschen Adresse zu sein, doch sie schien zu erwarten, dass ich direkt hinter ihr blieb, sie redete die ganze Zeit und stellte Fragen, auf die sie offenkundig keine Antwort erwartete.
Sie betrat eine riesige viktorianisch anmutende Küche mit einem Steinboden, einer steinernen Spüle und Abtropfgestellen, Tischen und Schränken aus Holz. Außerdem erkannte ich in dem Raum einen altmodischen Gasherd und darüber hölzerne Tellerregale, einen großen Boiler von Ascot über der Spüle und Bleirohre an der Wand. Ein riesiger Koksofen stand in einer Ecke, dessen Abzugsrohr oben in der Decke verschwand.
»Kommen wir also zum Kuchen«, sagte meine Begleiterin. »Mrs B. hat ihn heute Morgen gebacken. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Wo haben sie ihn hingestellt? Schauen Sie doch auch mal nach, meine Liebe.«
Das falsche Haus zu betreten, ist so eine Sache, aber eine fremde Küche zu durchstöbern, ging dann doch zu weit. Ich fand meine Stimme wieder: »Ist das hier das Nonnatus House?«
Die alte Frau hob ihre Hände in einer dramatischen Geste und rief mit klarer, heller Stimme: »Nicht geboren und doch im Tode geboren. Zu Großem geboren. Geboren zu führen und zu begeistern.« Sie richtete ihre Augen zur Decke und senkte die Stimme zu einem fesselnden Flüsterton: »Geboren, um die Weihe zu empfangen!«
War sie verrückt? Ich starrte sie sprachlos und wie gelähmt an. Dann wiederholte ich meine Frage. »Ja sicher, aber ist das hier das Nonnatus House?«
»Oh, meine Liebe, gleich, als ich Sie sah, wusste ich, dass Sie verstehen. Die Wolkendecke bleibt geschlossen. Jugend wird mit vollen Händen verteilt, die Glocken singen von traurigem Indigo und tiefdunklem Rot. Lassen Sie uns so gut wir können einen Sinn darin erkennen. Setzen Sie den Kessel auf, meine Liebe. Stehen Sie nicht einfach so herum.«
Es schien unergiebig, meine Frage zu wiederholen, also füllte ich den Kessel. Die Wasserleitungen in der ganzen Küche rappelten und wackelten und verursachten einen furchterregenden Lärm, als ich den Hahn aufdrehte. Die alte Frau stöberte umher, öffnete Schränke und Dosen und schwatzte die ganze Zeit etwas von kosmischen Strahlen und dem Zusammenfluss des Äthers. Plötzlich stieß sie einen kleinen Freudenschrei aus. »Der Kuchen! Der Kuchen! Ich wusste, dass ich ihn finde.«
Sie drehte sich zu mir um und flüsterte mit keckem Glanz in den Augen: »Sie glauben, sie können Sachen vor Schwester Monica Joan verstecken, aber sie sind nicht schlau genug, meine Liebe. Ob lahm oder geschwind, Gelächter oder Verzweiflung, nichts kann sich verstecken, alles kommt ans Licht. Holen Sie zwei Teller und ein Messer. Wo bleibt der Tee?«
Wir setzten uns an den riesigen hölzernen Tisch. Ich schenkte Tee ein und Schwester Monica Joan schnitt zwei breite Kuchenstücke ab. Sie zerbröselte ihres zu winzigen Stückchen, die sie mit langen, knochigen Fingern auf ihrem Teller umherschob. Mit ekstatisch freudigem Gemurmel aß sie und blinzelte mir zu, während sie die Krümel in sich hineinmampfte. Der Kuchen war hervorragend und wir bildeten eine verschworene Gemeinschaft, indem wir beschlossen, dass es noch ein Stück sein dürfe.
»Sie werden es nie erfahren, meine Liebe. Sie werden glauben, dass Fred ihn gegessen hat oder der arme Kerl, der immer auf den Stufen sitzt und seine belegten Brote isst.«
Sie schaute aus dem Fenster. »Da ist ein Lichtschein am Himmel. Glauben Sie, dass da gerade ein Planet explodiert, oder landet ein Außerirdischer?«
Ich dachte eher an ein Flugzeug, entschied mich jedoch für den explodierenden Planeten und fragte sie anschließend: »Noch etwas Tee?«
»Wollte ich gerade vorschlagen, und wie wärs mit noch einem Stück Kuchen? Vor sieben werden sie nicht zurück sein.«
Sie schwatzte weiter. Ich hatte keine Ahnung, was sie mir sagen wollte, aber sie war ganz zauberhaft. Je länger ich sie betrachtete, umso deutlicher entdeckte ich fragile Schönheit in ihren hohen Wangenknochen, ihren strahlenden Augen, ihrer runzligen, blass elfenbeinfarbenen Haut und der Ausgewogenheit ihres Kopfes, der auf ihrem langen, schmalen Hals ruhte. Ihre ausdrucksvollen Hände mit langen Fingern waren ständig in Bewegung wie ein Ballett aus zehn Tänzern und entfalteten eine hypnotische Kraft. Ich spürte, wie ich ihrem Zauber erlag.
Es fiel uns nicht schwer, den Kuchen ganz zu vertilgen, nachdem wir beschlossen hatten, dass das leere Blech weniger Verdacht erregen würde als ein einzelnes übrig gelassenes Stück auf einem Teller. Sie blinzelte verschmitzt und kicherte. »Unsere liebe Freundin Schwester Evangelina wird es als Erste bemerken. Sie sollten sie mal sehen, meine Liebe, wenn sie sauer wird. Oh, die schreckliche alte Schachtel. Ihr Gesicht wird noch röter als ohnehin und ihre Nase fängt an zu laufen. Ja wirklich, sie läuft! Ich habe es gesehen.« Sie warf ihren Kopf geringschätzig zurück. »Aber was bedeutet das für mich? Das Geheimnis des Beweises, dass es ein Bewusstsein gibt, ist ein Haus zu einer bestimmten Zeit, eine Funktion und ein Ereignis in einem, und nur wenige bilden die Elite, fürwahr, wer kann diese Erkenntnis schon willkommen heißen. Aber still. Was war das? Beeilen Sie sich.«
Sie sprang auf, streute dabei Kuchenkrümel quer über den Tisch, den Boden und sich selbst, schnappte sich das Blech und eilte damit zur Speisekammer. Dann nahm sie wieder Platz und setzte eine übertriebene Unschuldsmiene auf.
Schritte auf dem Steinboden der Eingangshalle näherten sich, begleitet von weiblichen Stimmen. Drei Nonnen betraten die Küche und redeten über Einläufe, Verstopfung und Krampfadern. Ich schloss daraus, dass ich entgegen meiner Erwartung doch am richtigen Ort sein musste.
Eine von ihnen blieb stehen und wandte sich an mich: »Sie müssen Schwester Lee sein. Wir haben Sie schon erwartet. Herzlich willkommen im Nonnatus House. Ich bin Schwester Julienne, die leitende Schwester. Nach dem Abendessen können wir uns in meinem Büro ja ein bisschen unterhalten. Haben Sie schon gegessen?«
Ihr Gesicht und ihre Stimme waren so offen und ehrlich und die Frage so frei von jedem Hintergedanken, dass ich nicht antworten konnte. Ich spürte den Kuchen schwer im Magen und murmelte nur: »Ja, vielen Dank«, dabei wischte ich mir wieder und wieder denselben Krümel vom Rock.
»Nun, Sie werden entschuldigen, wenn wir eine Kleinigkeit essen. Wir machen uns für gewöhnlich unser Abendessen selbst, weil wir alle zu unterschiedlichen Zeiten zurückkommen.«
Die Schwestern wirbelten umher, holten Teller, Messer, Käse, Cracker und andere Sachen aus der Speisekammer und deckten damit den Küchentisch. Dann hörte man hinter der Tür einen Schrei und eine Nonne kam roten Gesichts mit dem leeren Kuchenblech heraus.
»Er ist weg. Das Blech ist leer. Wo ist Mrs B.s Kuchen? Sie hat ihn erst heute Morgen gebacken.«
Das musste Schwester Evangelina sein. Ihr Gesicht wurde immer röter, während sie umherblickte.
Niemand sagte etwas. Die drei Schwestern sahen einander an. Schwester Monica Joan saß unbeteiligt mit geschlossenen Augen da, als sei sie über jeden Vorwurf erhaben. Der Kuchen begann in meinem Darm zu rumoren und ich wusste, dass sich mein Vergehen in seiner Tragweite nicht verheimlichen ließ. Meine Stimme war rau, als ich flüsterte: »Ich habe ein Stückchen gegessen.«
Das rote Gesicht mit der dazugehörigen massigen Gestalt näherte sich Schwester Monica Joan. »Und sie den Rest. Schaut sie euch an, überall Kuchenkrümel. Es ist widerlich. Oh, dieser Gierschlund! Von nichts kann sie ihre Finger lassen. Der Kuchen war für uns alle gedacht. Du … Du …«
Schwester Evangelina bebte vor Zorn, als sie sich über Schwester Monica Joan beugte, die sich nicht rührte und die Augen geschlossen hielt, als habe sie kein Wort gehört. Sie wirkte zerbrechlich und aristokratisch. Ich konnte es nicht ertragen und fand meine Stimme wieder: »Nein, Sie haben das falsch verstanden. Schwester Monica Joan hat ein Stück gegessen und ich den Rest.«
Die drei Nonnen starrten mich verwundert an. Ich spürte, wie ich rot anlief. Wäre ich ein Hund gewesen, den man mit dem Sonntagsbraten erwischt hatte, ich wäre mit eingeklemmtem Schwanz unter den Tisch gekrochen. Ein fremdes Haus zu betreten und den größten Teil eines Kuchens zu verspeisen, ohne Einverständnis oder Kenntnis seiner Besitzer, war ein Vergehen gegen die gute Sitte, das nach ernsten Konsequenzen verlangte. Ich konnte nur murmeln: »Es tut mir leid. Ich hatte Hunger. Ich werde es nie wieder tun.«
Schwester Evangelina schnaubte und knallte das Blech auf den Tisch.
Schwester Monica Joan, die den Kopf immer noch abgewendet und die Augen geschlossen hielt, löste sich aus ihrer Starre. Sie zog ein Taschentuch hervor, hielt es mit Daumen und Zeigefinger an einem Zipfel und reichte es Schwester Evangelina, die übrigen Finger vornehm abgespreizt. »Vielleicht ist es angebracht, ein wenig aufzuwischen, meine Liebe«, sagte sie zärtlich.
Der Zorn kochte noch stärker hoch. Die Röte in Schwester Evangelinas Zügen wendete sich ins Violette und es sammelte sich Feuchtigkeit um ihre Nasenlöcher.
»Nein danke, meine Liebe, ich habe mein eigenes«, zischte sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch.
Schwester Monica Joan machte einen affektierten kleinen Hüpfer, tupfte ihr Gesicht elegant mit dem Taschentuch ab und murmelte wie zu sich selbst: »Mich deucht, es regnet. Regen kann ich nicht ertragen. Ich ziehe mich zurück. Bitte entschuldigt mich, Schwestern. Wir sehen uns beim Komplet.«
Sie lächelte die drei Schwestern freundlich an, wandte sich zu mir und blinzelte mir so frech zu, wie ich es nie wieder erlebt habe. Dann schwebte sie erhobenen Hauptes aus der Küche.
Ich wand mich vor Scham, als die Tür sich schloss und ich mit den drei Nonnen allein zurückblieb. Ich wollte im Boden versinken oder davonlaufen. Schwester Julienne sagte mir, ich solle meinen Koffer ins Obergeschoss tragen. Dort sei ein Zimmer, an deren Tür mein Name stehe. Ich hatte mit drückender Stille und drei mir stumm nachblickenden Augenpaaren gerechnet, doch Schwester Julienne begann von einer alten Dame zu erzählen, die sie gerade besucht hatte und deren Katze offenbar im Kamin stecken geblieben war. Alle lachten und zu meiner riesigen Erleichterung war die Stimmung schnell wieder gelöst.
In der Eingangshalle dachte ich ernsthaft darüber nach, ob ich gleich wieder flüchten sollte. Dass ich in so etwas wie einem Kloster und nicht in einem Krankenhaus gelandet war, fand ich einfach lachhaft, und die ganze Affäre um den Kuchen war entwürdigend. Ich hätte nun einfach meinen Koffer nehmen und wieder in der Dunkelheit verschwinden können. Es war verlockend. Ich hätte es sogar fast getan, wenn sich nicht die Eingangstür in diesem Moment geöffnet hätte und zwei lachende Mädchen erschienen wären. Ihre Gesichter waren von der Nachtluft rosig und erfrischt und ihr Haar vom Wind zerzaust. Auf ihren langen Regenmänteln glitzerten ein paar Tropfen. Sie waren etwa in meinem Alter und wirkten glücklich und voller Leben.
»Hallo!«, sagte eine tiefe, gemächliche Stimme. »Du bist bestimmt Jenny Lee. Wie nett. Hier gefällts dir sicher. Wir sind nicht gerade viele. Ich bin Cynthia und das ist Trixie.«
Aber Trixie war schon im Gang zur Küche verschwunden: »Ich sterbe vor Hunger. Bis später.«
Cynthia hatte eine ganz erstaunliche Stimme: weich, tief und etwas rau. Außerdem sprach sie extrem langsam und in ihrem Tonfall lag immer die Spur eines Lachens. Bei einer anderen Sorte Mädchen wäre es eine sorgsam kultivierte Stimme gewesen, die sexy und verführerisch wirken sollte. Von dieser Sorte hatte ich in meinen vier Jahren in der Krankenpflege viele kennengelernt, aber Cynthia gehörte nicht zu diesem Schlag. Ihre Stimme war ganz natürlich. Sie konnte gar nicht anders sprechen. Mein Gefühl des Unbehagens und der Unentschlossenheit war wie weggeblasen, wir grinsten einander an und waren bereits Freundinnen. Ich beschloss zu bleiben.
Später am Abend wurde ich in Schwester Juliennes Büro gerufen. Mit Angst im Bauch ging ich zu ihr, denn ich erwartete, dass sie mir wegen des Kuchens gehörig den Kopf waschen würde. Nachdem ich vier Jahre lang die Tyrannei der Krankenhaushierarchie ertragen hatte, rechnete ich mit dem Schlimmsten und biss bereits die Zähne zusammen.
Schwester Julienne war klein und rundlich. Sie hatte an diesem Tag wahrscheinlich bereits fünfzehn, sechzehn Stunden gearbeitet, aber sie wirkte frisch wie der Tau. Ihr strahlendes Lächeln gab mir Selbstvertrauen und vertrieb meine Angst. Ihre ersten Worte waren: »Über den Kuchen wollen wir kein Wort mehr verlieren.«
Ich atmete vor Erleichterung tief durch und Schwester Julienne lachte laut auf. »Jede von uns hat in Gesellschaft von Schwester Monica Joan bereits seltsame Dinge erlebt. Aber ganz sicher wird niemand die Sache je wieder erwähnen. Nicht einmal Schwester Evangelina.«
Sie betonte die letzten Worte und so begann auch ich zu lachen. Sie hatte mich völlig überzeugt und ich war froh, nicht überstürzt weggelaufen zu sein.
Ihre nächsten Worte überraschten mich: »Welchem Glauben gehören Sie an, Schwester?«
»Also … äh … keiner … also … äh, methodistisch – glaube ich.«
Die Frage schien mir erstaunlich, unerheblich, ja fast schon dumm. Dass sie mich zu meiner Schullaufbahn, zu meiner Ausbildung, zu meiner Krankenpflegeerfahrung und meinen Zukunftsplänen befragte – all das hätte ich erwartet. Aber mein Glaube? Was hatte Religion mit all dem zu tun?
Sie wurde sehr ernst und sagte dann sanft: »Jesus Christus ist unsere Stärke und unser Vorbild. Vielleicht kommen Sie ja gelegentlich dazu, wenn wir sonntags Gottesdienst feiern.«
Anschließend erläuterte mir Schwester Julienne meine bevorstehende Ausbildung und den Tagesablauf im Nonnatus House. Ich sollte drei Wochen lang bei allen Besuchen unter der Aufsicht einer ausgebildeten Hebamme stehen und dann selbst Aufgaben in der prä- und postnatalen Pflege übernehmen. Bei allen Geburten würde mir eine Hebamme auf die Finger schauen. Unterricht im Klassenzimmer fand einmal pro Woche abends nach der Arbeit statt. Lernen und Wiederholen konnten wir in unserer Freizeit.
Sie saß ruhig auf ihrem Stuhl und erläuterte weitere Einzelheiten, die mir fast alle zum einen Ohr herein- und zum anderen wieder hinausgingen. Ich hörte nicht richtig zu, sondern dachte über sie nach und warum ich mich in ihrer Gesellschaft so wohl und glücklich fühlte.
Eine Glocke läutete. Sie lächelte. »Zeit zum Komplet. Ich muss gehen. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht.«
Der Eindruck, den Schwester Julienne auf mich machte – und wie ich herausfand, ging es den meisten ähnlich –, stand in keinem Verhältnis zu ihrem Erscheinungsbild oder dem, was sie sagte. Sie trat nicht eindrucksvoll, bestimmend oder auf irgendeine Art fesselnd auf. Sie war noch nicht einmal außergewöhnlich schlau. Doch irgendetwas strahlte sie aus und ich konnte mir noch so sehr den Kopf zerbrechen, ich begriff nicht, was es war. Damals kam mir nicht in den Sinn, dass zu ihrer Ausstrahlung eine spirituelle Seite gehörte, die nichts mit der diesseitigen Welt zu tun hatte.