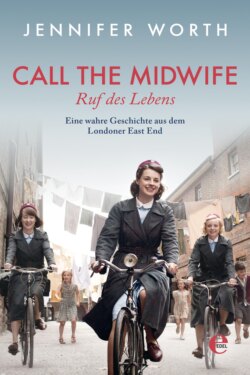Читать книгу Call the Midwife - Ruf des Lebens - Jennifer Worth - Страница 9
Morgenbesuche
ОглавлениеAls ich nach Muriels Entbindung gegen sechs Uhr morgens wieder im Nonnatus House ankam, hatte ich einen Bärenhunger. Nichts bereitet einem jungen Menschen solchen Appetit wie eine durchgearbeitete Nacht und sechs oder acht Meilen auf dem Fahrrad. Im Haus war alles still, als ich hineinging. Die Nonnen waren in der Kapelle und das Laienpersonal war noch nicht aufgestanden. Ich war müde, aber mir war klar, dass ich noch meine Entbindungstasche aufräumen, meine Instrumente abwaschen und sterilisieren, meine Aufzeichnungen vervollständigen und sie auf den Schreibtisch im Büro legen musste, bevor ich essen durfte.
Im Speisesaal stand Frühstück bereit und ich wollte zuerst essen und mich dann für ein paar Stunden hinlegen. Ich räuberte die Speisekammer aus. Eine Kanne Tee, gekochte Eier, selbst gemachte Stachelbeermarmelade, Cornflakes, selbst gemachter Joghurt und Scones. Das Paradies! Wie ich entdeckt hatte, gibt es bei Nonnen immer viele selbst gemachte Lebensmittel. Die eingemachten Sachen kamen von den vielen Basaren in der Gemeinde und wurden offenbar das ganze Jahr über verkauft. Die köstlichen Kuchen, Plätzchen und das knusprige Brot wurden von den Nonnen oder von den vielen Frauen des Stadtteils gebacken, die im Nonnatus House arbeiteten. Wer wegen eines Einsatzes eine Mahlzeit verpasste, durfte sich in der Speisekammer bedienen. Ich wusste diese Freiheit sehr zu schätzen; aus dem Krankenhaus, wo man um etwas zu essen betteln musste, wenn man aus irgendeinem Grund eine Mahlzeit verpasst hatte, kannte ich es ganz anders.
Es war ein königliches Festmahl. Ich hinterließ einen Zettel, auf dem ich darum bat, gegen halb zwölf mittags geweckt zu werden, und überredete meine müden Beine, mich nach oben in mein Zimmer zu tragen. Ich schlief wie ein Baby, und als mich jemand mit einer Tasse Tee weckte, wusste ich nicht mehr, wo ich war. Der Tee erinnerte mich wieder daran. Nur die netten Schwestern brachten einer Hebamme, die die ganze Nacht lang gearbeitet hatte, eine Tasse Tee. Im Krankenhaus hätte es einmal laut an die Tür geklopft und das wäre es schon gewesen.
Unten schaute ich ins Buch mit dem Tagesplan. Nur drei Besuche bis zum Mittagessen. Eine der Patientinnen war Muriel, die anderen beiden lebten in den Wohnblocks, an denen ich unterwegs vorbeikäme. Die vier Stunden Schlaf hatten mich völlig erfrischt, ich holte mein Fahrrad und radelte in bester Laune durch den sonnigen Tag.
Die Wohnblocks sahen immer trist aus, bei jedem Wetter. Sie waren als Gebäudekomplex mit vier Seiten angelegt. Alle Wohnungen waren nach innen ausgerichtet. Die Gebäude waren etwa sechs Stockwerke hoch, sodass kaum Licht in den Innenhof fiel, den gemeinschaftlichen Treffpunkt der Bewohner. Im Innenhof waren die Wäscheleinen angebracht, und da es Hunderte von Wohnungen in jedem Block gab, hingen sie immer bis zum Rand voller Wäsche, die im Wind flatterte. Auch die Mülltonnen standen im Innenhof.
In der Zeit, über die ich schreibe, in den 1950er-Jahren, gab es eine Toilette und fließend kaltes Wasser in jeder Wohnung. Bevor diese Annehmlichkeiten installiert wurden, waren die Toiletten und Wasserhähne im Innenhof und jeder musste nach unten gehen, um sie zu benutzen. In manchen Wohnblocks blieben die Toilettenschuppen stehen, die man nun als Unterstand für Fahrräder und Motorräder verwendete. Es waren nicht viele – höchstens drei Dutzend – und ich wunderte mich, wie es nur genug Toiletten für alle Bewohner der rund fünfhundert Wohnungen gegeben haben konnte.
Ich bahnte mir meinen Weg durch die Wäsche und kam zu der gesuchten Treppe. Alle Aufgänge lagen außen, bestanden aus Steinstufen und führten zu einer nach innen offenen Galerie, die rings um das ganze Gebäude führte. Jede Wohnung hatte ihren Zugang über diese Galerie. Während der Innenhof das soziale Zentrum war, stellten die Galerien die Verkehrsadern dar. Überall sprudelte das Leben und es wurde getratscht. Was für die Bewohner der Reihenhäuser die Straßen waren, waren für die Frauen aus den Wohnblocks die Galerien. Die Menschen lebten auf so engem Raum, dass wohl niemals jemand, der etwas ausgefressen hatte, ungeschoren davonkam, weil die Nachbarn immer über alles Bescheid wussten. Die Welt außerhalb war für die Menschen des East Ends nie von sonderlichem Interesse, daher war das Leben der anderen das wichtigste Gesprächsthema – für die meisten war es das einzige von Interesse und das einzige Freizeitvergnügen. Es verwundert nicht, dass in den Wohnblocks häufig wilde Prügeleien ausgetragen wurden.
Die Wohnblocks sahen im Licht der Mittagssonne ungewohnt heiter aus, als ich an diesem Tag ankam. Ich bahnte mir meinen Weg durch den Abfall, die Mülltonnen und die Wäsche im Innenhof. Kleine Kinder sammelten sich um mich. Die Entbindungstasche einer Hebamme ist ein äußerst interessantes Objekt – sie dachten, dass wir darin die Babys transportieren.
Ich fand den richtigen Aufgang und stieg bis in den fünften Stock zu der Wohnung, die ich besuchen wollte.
Alle Wohnungen waren ähnlich aufgebaut: zwei oder drei Räume, die untereinander verbunden waren. Eine Steinspüle in einer Ecke des Hauptraums, ein Gasherd und ein Schrank bildeten die Küche. Die Toiletten mussten, als man sie einbaute, nahe der Wasserleitung installiert werden, also lagen sie in einer Ecke bei der Spüle. Die Installation der Toiletten war in hygienischer Hinsicht ein großer Fortschritt, denn es verbesserte die Bedingungen in den Innenhöfen. Außerdem waren nun die Nachttöpfe unnötig geworden, die die Bewohner zuvor täglich hatten leeren müssen. Die Frauen hatten sie nach unten gebracht und in Tröge ausgeleert. Der Gestank in den Innenhöfen war damals abscheulich, wie man mir erzählt.
Die Wohnblocks des Londoner East Ends wurden in den 1850er-Jahren als Wohnraum für die Werftarbeiter und ihre Familien errichtet. Damals hatte man sie wahrscheinlich als angemessene Behausung betrachtet. Mit Sicherheit waren sie eine deutliche Verbesserung gegenüber den Lehmhütten, an deren Stelle sie traten und die einer Familie kaum Schutz vor Wind und Wetter geboten hatten. Die Wohnblocks bestanden aus Ziegelmauern und einem Schieferdach, durch das kein Regen drang. Ich zweifle nicht, dass sie zu ihrer Zeit als luxuriös galten. Eine Familie aus zehn, zwölf Personen in zwei oder drei Zimmern, das hätte man nicht als beengt empfunden. Schließlich hat die Menschheit im Lauf der Geschichte überwiegend in ähnlichen Verhältnissen gelebt.
Doch die Zeiten ändern sich und in den 1950er-Jahren galten die Wohnblocks als Elendsviertel. Die Mieten waren weit niedriger als in den Reihenhäusern und so zogen nur die ärmsten Familien, die es im Leben am schwersten hatten, hier ein. Es scheint eine Art Gesetzmäßigkeit zu sein, dass oft die ärmsten Familien die meisten Kinder hervorbringen, und auch in den Wohnblocks waren sie überall. Infektionen verbreiteten sich wie Flächenbrände und mit Schädlingen und Parasiten war es ähnlich: Es gab Flöhe, Kopfläuse, Zecken, die Krätze, Filzläuse, Mäuse, Ratten und Kakerlaken. Die Kammerjäger der Stadtverwaltung hatten alle Hände voll zu tun. Schließlich wurden die Wohnblocks zu ungeeigneten Behausungen erklärt und in den Sechzigerjahren mussten alle Bewohner dort ausziehen. Die Gebäude standen mehr als zehn Jahre leer, bis sie 1982 schließlich abgerissen wurden.
Edith war klein und drahtig und zäh wie ein alter Stiefel. Sie sah viel älter aus als vierzig und hatte sechs Kinder großgezogen. Während des Kriegs war ihre Familie, die in einem Reihenhaus gelebt hatte, ausgebombt worden, aber da es kein direkter Treffer gewesen war, hatten alle überlebt. Die Kinder wurden anschließend evakuiert. Ihr Mann war Werftarbeiter, sie hatte eine Stelle in einer Munitionsfabrik. Nach dem Bombenangriff zog sie mit ihrem Mann in einen Wohnblock, wo die Miete billiger war. Beide überlebten weitere Bombardements, denn wie durch ein Wunder wurden die Wohnblocks, wo damals die Bevölkerungsdichte am größten war, nicht getroffen. Ihre Kinder sah Edith fünf Jahre lang nicht, doch 1945 war die Familie wieder vereint. Wegen der niedrigen Miete und weil sie sich an die Verhältnisse gewöhnt hatten, blieben sie im Wohnblock. Wie irgendjemand mit sechs heranwachsenden Kindern in zwei Zimmern zurechtkommt, war immer jenseits meiner Vorstellungskraft, aber sie schafften es und dachten sich nichts dabei.
Sie hatte sich nicht gefreut, als sie wieder schwanger geworden war, ja, sie war sogar wütend, aber wie die meisten Frauen, die spät noch einmal ein Kind bekommen, war sie völlig vernarrt in das kleine Wesen, als es zur Welt kam, und hörte nicht auf, ihm etwas vorzusummen. Die ganze Wohnung hing voller Windeln – Wegwerfwindeln waren damals noch nicht erfunden – und der Kinderwagen nahm in dem ohnehin vollgestellten Zimmer noch zusätzlich Platz weg.
Edith war aufgestanden und kümmerte sich um den Haushalt. In dieser Zeit verordneten wir den Müttern nach der Entbindung noch eine längere Bettruhe – sie verbrachten zehn bis vierzehn Tage im »Wochenbett«. Aus medizinischer Sicht ist das nicht empfehlenswert, denn es ist viel besser, wenn eine Frau so bald wie möglich wieder aufsteht und sich bewegt, weil so das Risiko von Thrombosen oder ähnlichen Beschwerden geringer ist. Doch damals wusste man das noch nicht und es war gängige Praxis, dass die Frau nach der Geburt das Bett hütete. Der große Vorteil war, dass sie so ein wenig wohlverdiente Ruhe genießen konnte. Andere kümmerten sich um den Haushalt und für kurze Zeit konnte sie sich ein wenig Müßiggang gönnen. Sie musste wieder zu Kräften kommen, denn sobald sie auf den Beinen war, war sie wieder für alles verantwortlich. Wenn man sich vor Augen führt, wie körperlich anstrengend es war, alle Einkäufe die Treppen hinaufzutragen – im Winter dazu noch Kohle und Holz und Öl für den Ofen –, und dass der Müll wieder zu den Tonnen im Innenhof gebracht werden musste; und wenn man bedenkt, dass man, um mit dem Baby das Haus zu verlassen, den Kinderwagen Stufe für Stufe die Treppen hinuntermanövrieren musste, nur um ihn bei der Rückkehr auf die gleiche Weise nach oben zu bugsieren, neben dem Baby häufig noch beladen mit Lebensmitteln, dann kann man erahnen, wie zäh diese Frauen sein mussten. Fast jedes Mal, wenn ich die Wohnblocks aufsuchte, konnte ich beobachten, wie eine Frau mit einem großen Kinderwagen die Treppen hinunter- oder hinaufholperte. Wenn sie im obersten Stockwerk lebte, waren das an die siebzig Stufen in jeder Richtung. Die Wagen hatten große Räder, mit denen das überhaupt erst möglich war, und sie waren gut gefedert, sodass die Babys arg durchgeschüttelt wurden. Sie liebten es, lachten und quietschten vor Vergnügen. Doch bei glatten Stufen war es auch gefährlich, denn gelenkt werden konnte allein mit dem Handgriff, sodass der Wagen mit dem Baby, falls die Mutter aus Versehen ins Leere trat oder aus irgendeinem anderen Grund losließ, die ganze restliche Treppe hinunterstürzte. Wenn ich eine Frau mit ihrem Kinderwagen sah, half ich ihr immer, indem ich ihn an der anderen Seite hochhob und die Hälfte des Gewichts trug, was bereits eine beträchtliche Last war. Das volle Gewicht muss für eine Frau allein enorm gewesen sein.
Edith begrüßte mich in einem schmutzigen Bademantel, ausgelatschten Pantoffeln und Lockenwicklern. Sie stillte ihr Baby und rauchte dabei. Aus dem Radio plärrte Popmusik. Sie wirkte vollkommen glücklich. Sie hatte eine gesündere Gesichtsfarbe und sah jünger aus als noch einige Monate zuvor. Die Ruhe hatte ihr offenbar gutgetan.
»Hallo Liebes, komm rein. Wie wärs mit’m schönen Tässchen Tee?«
Ich erklärte, dass ich noch weitere Besuche vor mir hatte, und lehnte den Tee dankend ab. Ich konnte sehen, welche Fortschritte sie beim Stillen machte. Das Baby saugte gierig, doch mir fiel gleich auf, dass Ediths flache, kleine Brüste wahrscheinlich nicht genug Milch produzierten. Dennoch war das wesentlich besser, als wenn sie dem Baby sofort Milch aus Milchpulver gegeben hätte, also sagte ich nichts dazu. Sollte das Baby nicht zunehmen oder echte Anzeichen von Hunger zeigen, dann kann man immer noch darüber reden, dachte ich. Wir besuchten jede Patientin nach der Entbindung mindestens zwei Wochen lang jeden Tag, also sahen wir sie sehr häufig.
In dieser Zeit wurde es allmählich modern, die Babys mit künstlicher Säuglingsnahrung zu füttern und es der Mutter zu empfehlen, da es das Beste für das Baby sei. Doch die Hebammen des Heiligen Nonnatus schlossen sich dieser Ansicht nicht an. Wir rieten allen unseren Patientinnen, ihren Kindern so lange wie möglich die Brust zu geben, und halfen ihnen dabei. Zwei Wochen Bettruhe wirkten dabei unterstützend, denn die Mutter ermüdete nicht so rasch vor lauter Geschäftigkeit und ihr Körper konnte all seine Kraft darauf verwenden, Milch für das Baby zu produzieren.
Während ich mich in dem vollgestellten Zimmer mit der spartanisch eingerichteten Kochecke umsah und bemerkte, wie sehr es am Nötigsten fehlte, wurde mir schlagartig klar, dass künstliche Milch für das Baby fatal wäre. Wo sollte Edith die Fläschchen und die Milchpulverdosen aufbewahren, wie sie sterilisieren? Würde sie sich diese Mühe machen? Würde sie sie überhaupt sauber halten, von Sterilisieren ganz zu schweigen? Es gab keinen Kühlschrank und ich konnte mir gut die halb ausgetrunkenen Fläschchen vorstellen, wie sie im Zimmer umherlagen, bis man sie dem Baby ein zweites oder drittes Mal gab, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass sich Bakterien im Nu in abgekühlter Milch ausbreiten, wenn man sie wieder aufwärmt. Nein, es war viel sicherer, wenn das Baby weiter die Brust bekam, selbst wenn die Milch nicht ganz ausreichte.
Ich erinnere mich gut an den Unterricht über die Vorteile des Fläschchens während des ersten Teils meiner Ausbildung als Hebamme. Das klang alles sehr überzeugend. Als ich dann bei den Hebammen des Heiligen Nonnatus zu arbeiten begann, hielt ich sie für sehr altmodisch, weil sie stets die Brust empfahlen. Damals hatte ich noch nicht bedacht, unter welchen Umständen die Menschen lebten, für die die Schwestern da waren. Die Dozentinnen wussten nichts vom wirklichen Leben. Für sie war es Unterrichtsstoff und sie dachten an ein Idealbild junger Mütter aus der gebildeten Mittelschicht, das nur in ihrer Vorstellung existierte; Frauen, die alle Regeln beachteten und alles taten, was man ihnen sagte. Die Expertinnen in Schulwissen lebten in einer ganz anderen Welt, in der es keine dummen jungen Frauen gab, die das Milchpulver verwechselten, die falsche Menge nahmen, das Wasser nicht abkochten, unfähig waren, die Fläschchen und Sauger zu sterilisieren oder die Flaschen auch nur auszuwaschen. Theoretiker konnten sich nicht vorstellen, dass jemand eine halb leere Flasche vierundzwanzig Stunden liegen ließ und dann dem Baby gab, oder dass ein Fläschchen über den Boden rollte, wo Katzenhaare und anderer Dreck an ihm hängen blieben. Unsere Dozentinnen erwähnten nie die Möglichkeit, dass das Milchpulver mit etwas anderem versetzt sein konnte, etwa Zucker, Honig, Reis, Sirup, Kondensmilch, Grieß, Alkohol, Aspirin, Getränkepulver oder Ovomaltine. So etwas war den Verfassern der Lehrbücher womöglich nie untergekommen. Doch die Nonnen des Heiligen Nonnatus hatten es oft genug erlebt.
Edith und ihr Baby wirkten glücklich und zufrieden, also wollte ich sie nicht weiter stören. Ich sagte, dass wir am nächsten Tag wieder vorbeikämen, um das Baby zu wiegen und sie zu untersuchen.
Ich musste jetzt noch eine Patientin besuchen: Molly Pearce, ein neunzehn Jahre altes Mädchen, das ihr drittes Baby erwartete und seit drei Monaten nicht zur Vorsorgesprechstunde erschienen war. Da der Geburtstermin näher rückte, mussten wir nachsehen, wie es um sie stand.
Als ich mich der Tür näherte, hörte ich hinter ihr Lärm. Es klang wie ein Streit. Ich hatte schon immer eine heftige Abneigung gegen jede Art von Streit oder Kampf, und so wich ich instinktiv zurück. Doch ich hatte eine Aufgabe, also klopfte ich an. Sofort herrschte Stille. Es blieb ein paar Minuten lang ruhig und die Stille wurde bedrohlicher als der Lärm zuvor. Wieder klopfte ich. Immer noch Ruhe, dann wurde ein Riegel zurückgeschoben und ein Schlüssel drehte sich im Schloss – es war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen ich im East End eine Tür verschlossen vorgefunden habe.
Das unrasierte Gesicht eines mürrischen Mannes starrte mich argwöhnisch durch den Türspalt an. Dann stieß er einen obszönen Fluch aus, spuckte mir vor die Füße und machte sich über die Galerie in Richtung der nächsten Treppe davon. Das Mädchen kam zur Tür. Molly sah mit ihren roten Wangen erhitzt aus und keuchte leicht. »Keiner vermisst dich!«, rief sie dem Mann hinterher und trat gegen den Türrahmen.
Man sah ihr an, dass sie im neunten Monat war, und ich musste daran denken, dass ein solch heftiger Streit Wehen auslösen konnte, besonders wenn Gewalt im Spiel war. Doch dafür gab es noch keine Anzeichen. Ich bat sie, sich untersuchen zu lassen, da sie nicht zur Vorsorgesprechstunde gekommen war. Zögerlich stimmte sie zu und ließ mich in die Wohnung.
Der Gestank warf mich fast um. Es war eine üble Mischung aus Schweiß, Urin, Kot, Zigaretten, Alkohol, Heizöl, abgestandenem Essen, saurer Milch und ungewaschenen Kleidern. Molly ließ ihre Wohnung offenbar völlig verkommen. Fast alle Frauen, die ich kennenlernte, waren stolz auf sich und ihre Wohnungen und gaben sich größte Mühe. Doch Molly war anders. Sie hatte keine Ader dafür, sich ein Nest zu schaffen.
Sie führte mich ins Schlafzimmer, wo es dunkel war. Das Bett war völlig verdreckt. Es gab kein Bettzeug, nur eine nackte Matratze und Kissen ohne Bezüge. Ein paar graue Decken aus Armeebeständen lagen auf dem Bett und eine hölzerne Wiege stand in der Ecke. Das ist kein Ort für eine Entbindung, dachte ich sofort. Einige Monate zuvor hatte eine Hebamme die Wohnung noch als ausreichend eingestuft, doch seitdem waren die häuslichen Verhältnisse offenbar dramatisch ins Wanken geraten. Ich musste es den Schwestern melden.
Ich bat Molly, ihre Kleidung zu lockern und sich hinzulegen. Dabei fiel mir ein großer blauer Fleck auf ihrem Brustkorb auf. Ich fragte, was passiert sei. Sie knurrte und deutete mit dem Kopf in Richtung der Tür: »Er«, sagte sie und spuckte auf den Boden. Vielleicht hat sie mein unerwartetes Eintreffen ja vor dem nächsten Schlag bewahrt, dachte ich.
Ich untersuchte sie. Der Kopf des Babys lag schön weit unten, die Lage schien normal und ich konnte spüren, wie es sich bewegte. Ich horchte das Herz des Fötus ab. Es hatte einen gleichmäßigen Puls von 126 Schlägen pro Minute. Allen Umständen zum Trotz schienen Mutter und Baby in normalem, gesundem Zustand zu sein.
Erst dann bemerkte ich die Kinder. Ich hörte aus einer Ecke des dunklen Schlafzimmers ein Geräusch und fuhr zusammen. Ich dachte, es sei eine Ratte. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich zwei kleine Gesichter, die hinter einem Stuhl hervorschauten. Molly hatte gehört, wie mir vor Schreck der Atem gestockt hatte, und sagte: »Alles is gut, Tom, komm her.«
Natürlich mussten hier kleine Kinder sein, dachte ich. Immerhin war es ihre dritte Schwangerschaft und sie war erst neunzehn, also gingen sie wohl kaum schon zur Schule. Warum nur hatte ich sie vorher nicht gesehen?
Zwei kleine Jungen, etwa zwei, drei Jahre alt, kamen hinter dem Stuhl hervor. Sie waren völlig still. Jungen in diesem Alter rennen für gewöhnlich umher und machen einen Riesenlärm, aber diese beiden nicht. Es war geradezu unnatürlich, dass sie so still waren. Ihre riesigen Augen waren voller Angst, als sie einen Schritt vorwärts machten und sich aneinanderklammerten, als wollten sie sich gegenseitig beschützen, dann wichen sie wieder hinter den Stuhl zurück.
»Es is alles gut, Kinder, es is nur die Schwester. Die tut euch nix. Kommt her.«
Sie kamen wieder hervor. Zwei schmutzige kleine Jungen, rotz- und tränenverschmiert. Sie trugen nichts als Pullover, was ich in Poplar oft gesehen habe, und diese Angewohnheit fand ich irgendwie besonders abstoßend. Kleinkindern zog man nur Oberkleidung an und ließ sie unterhalb der Hüfte nackt. Besonders bei kleinen Jungen schien das weit verbreitet. Ich hörte, dass die Frauen sich auf diese Weise das Wäschewaschen sparten. Das Kind konnte, bis es trocken war, überall urinieren, daher gab es weder Windeln noch Kleider zu waschen. Kinder rannten so oft den ganzen Tag über auf den Galerien und in den Innenhöfen umher.
Tom und sein kleiner Bruder krochen aus ihrer Ecke und rannten zu ihrer Mutter. Ihre Angst schien zu verfliegen. Liebevoll streckte sie einen Arm aus und sie kuschelten sich an sie. Zumindest hat sie einen gewissen Mutterinstinkt, dachte ich. Ich fragte mich, wie oft die beiden Kleinen sich hinter ihrem Stuhl versteckten, wenn ihr Vater zu Hause war.
Doch ich war weder Gesundheitsbeauftragte noch Sozialarbeiterin und es nützte nichts, über solche Dinge zu spekulieren. Ich nahm mir vor, den Schwestern von meinen Beobachtungen zu berichten, und sagte Molly, ich käme in der gleichen Woche noch einmal vorbei, um mich zu versichern, dass für eine Hausgeburt alles bereit sei.
Nun musste ich noch Muriel besuchen. Erleichtert verließ ich die stinkende Wohnung.
Das helle, klare Wetter und das Radfahren hinunter zur Isle of Dogs weckten meine Lebensgeister wieder und so trat ich in die Pedale.
»Hallo Liebes, wie gehts?«, war ein Gruß, den mir Frauen wiederholt entgegenriefen, ganz gleich, ob ich sie kannte oder nicht. Es war der übliche Gruß, der vom Bürgersteig hinüberschallte. »Wunderbar, danke, un selber?«, antwortete ich immer. Es fiel mir schwer, nicht selbst in den Cockneydialekt zu verfallen.
Ich glaubs nicht, sagte ich zu mir selbst, als ich in Muriels Straße einbog, sie kann nicht jetzt schon hier sein. Doch da war sie, Mrs Jenkins mit ihrem Stock und ihrem Einkaufsnetz und dem Tuch über ihren Lockenwicklern und ihrem alten, langen, schimmeligen Mantel, den sie im Sommer wie im Winter trug. Sie redete mit einer Frau, die an der Straße stand, und hing geradezu an ihren Lippen. Sie sah, wie ich bremste, kam mir entgegen und krallte sich mit ihren schmutzigen Händen mit den langen Fingernägeln in meinen Ärmel.
»Wie gehts ihr denn, und dem Klein’n?«, krächzte sie.
Ungeduldig zog ich meinen Arm weg. Mrs Jenkins tauchte bei jeder Entbindung auf. Ganz gleich, wie weit weg, wie schlecht das Wetter, wie früh oder wie spät es war, Mrs Jenkins lungerte immer irgendwo auf der Straße herum. Niemand wusste, wo sie wohnte, woher sie ihre Informationen bekam, wie sie es schaffte, manchmal drei oder vier Meilen weit zu dem Haus zu laufen, wo gerade ein Baby zur Welt gekommen war. Aber sie war immer da.
Ich ärgerte mich und ließ sie stehen, ohne ein Wort zu sagen. Für mich war sie einfach nur eine lästige, neugierige Alte. Ich war jung – noch zu jung, um etwas zu ahnen. Zu jung, um den Schmerz in ihren Augen zu erkennen und die qualvolle Dringlichkeit in ihrer Stimme wahrzunehmen.
»Wie gehts ihr? Un dem Klein’n. Wie gehts dem Klein’n?«
Ich ging gleich ins Haus, ohne auch nur zu klopfen, und gleich kam Muriels Mutter geschäftig und lächelnd auf mich zu. Die Mütter der älteren Generation wussten, dass sie in solchen Situationen unentbehrlich waren. Das erfüllte sie und sie spürten, dass ihr Leben auch weiterhin einen Sinn hatte. Sie war voller Energie und hatte Neuigkeiten. »Sie is gleich eingeschlafen, als du gegangen bist. Sie war auf der Toilette und hat Wasser gelassen. Sie hat ein bisschen Tee getrunken und jetzt mach ich ihr ein schönes Stück Fisch. ’s Baby war schon an der Brust, da hab ich mich drum gekümmert, aber es kommt noch keine Milch.«
Ich dankte ihr und ging hinauf. Das Schlafzimmer wirkte sauber, frisch und hell, und auf der Kommode standen Blumen. Verglichen mit dem Dreck in Mollys Wohnung war es das Paradies.
Muriel war wach, aber müde. Das Erste, was sie zu mir sagte, war: »Ich will jetz kein’n Fisch. Kannst du meiner Mum das sagen? Mir is nich danach, aber sie hört mir nich zu. Vielleicht hört sie auf dich.«
Hier gab es offenbar eine Meinungsverschiedenheit zwischen Mutter und Tochter. Doch ich wollte mich nicht einmischen. Ich maß ihren Puls und ihren Blutdruck – alles normal. Ich bemerkte etwas Wochenfluss, aber nicht in größeren Mengen und die Gebärmutter fühlte sich normal an. Ich untersuchte ihre Brüste. Es floss ein wenig Kolostrum, aber keine Milch, wie ihre Mutter es schon angekündigt hatte. Ich wollte das Baby dazu bringen zu trinken, denn das war der Hauptgrund meines Besuchs.
Es schlief friedlich in seiner Wiege. Von der runzligen Haut, verfärbt von dem Stress und dem Trauma der Geburt, von den ängstlichen Schreien und der Furcht beim Eintritt in die Welt war keine Spur mehr zu erkennen. Der Kleine war ganz entspannt und lag warm und friedlich da. Nahezu jeder, der einmal ein neugeborenes Baby gesehen hat, berichtet von dem besonderen Eindruck, den es auf ihn macht. Die Skala reicht von Ehrfurcht bis Erstaunen. Die Hilflosigkeit eines neugeborenen Menschen hat auch mich immer beeindruckt. Alle anderen Säugetiere haben bei ihrer Geburt schon ein gewisses Maß an Selbstständigkeit. Viele Tiere können innerhalb der ersten ein bis zwei Stunden stehen und laufen. Andere finden zumindest eine Zitze und beginnen zu saugen. Doch menschliche Babys können noch nicht einmal das. Würde man ihnen nicht die Brustwarze oder einen Sauger zum Mund führen und sie zum Saugen ermuntern, würden sie verhungern. Ich habe meine eigene Theorie, dass die Menschen eigentlich alle zu früh auf die Welt kommen. Wenn man sich die Lebenszeit eines Menschen vor Augen führt – etwa siebzig Jahre –, dann müsste die Tragzeit, verglichen mit der anderer Tiere, die ähnlich lange leben, etwa zwei Jahre betragen. Doch im Alter von zwei Jahren ist der Kopf eines Menschen so groß, dass keine Frau ihn mehr gebären könnte. Und deshalb werden unsere Babys so früh geboren, wenn sie noch völlig hilflos sind.
Ich hob das winzige Wesen aus seiner Wiege und brachte es Muriel. Sie wusste, was zu tun war, und hatte bereits ein wenig Kolostrum aus der Brustwarze gedrückt. Wir strichen etwas davon auf die Lippen des Babys. Es interessierte sich nicht dafür, wand sich und drehte den Kopf zur Seite. Wir versuchten es noch einmal, aber die Reaktion war die gleiche. Wir brauchten mindestens eine Viertelstunde und viel Geduld, um das Baby dazu zu bringen, seinen Mund weit genug zu öffnen, dass wir ihm die Brustwarze hineinstecken konnten. Der Kleine saugte etwa dreimal und schlief wieder ein. Er schlief tief, als sei er von all der Anstrengung erschöpft. Muriel und ich mussten lachen.
»Man denkt ja fast, dass er die ganze Arbeit gemacht hat«, sagte sie, »und nicht wir beide, was, Schwester?«
Wir waren beide der Meinung, es fürs Erste dabei bewenden zu lassen. Ich wollte am Abend wiederkommen und sie konnte es am Nachmittag wieder versuchen, wenn sie mochte.
Als ich die Treppe hinunterkam, roch ich, dass gekocht wurde. Es mochte nicht nach Muriels Geschmack sein, aber meine Magensäfte zeigten sich begeistert. Ich war hungrig wie ein Wolf und im Nonnatus House erwartete mich ein leckeres Mittagessen. Ich sagte Auf Wiedersehen und ging zu meinem Fahrrad. Mrs Jenkins stand gleich daneben, als bewache sie es. Wie werde ich sie bloß los?, dachte ich. Ich wollte nicht mit ihr reden. Ich wollte nur zu meinem Mittagessen, doch sie hielt das Rad am Sattel fest. Sie wollte mich offenbar nicht fortlassen, ohne dass ich ihr Informationen gegeben hatte.
»Wie gehts ihr? Un dem Klein’n. Wie gehts dem Klein’n?«, zischte sie mich an, ohne dabei auch nur zu blinzeln.
Obsessives Verhalten hat immer etwas Abstoßendes an sich. Bei Mrs Jenkins war es noch schlimmer. Ich fand sie widerlich. Sie war etwa siebzig Jahre alt, winzig und krumm und ihre schwarzen Augen durchbohrten mich geradezu und wischten jeden angenehmen Gedanken ans Mittagessen beiseite. Sie war hässlich und hatte keine Zähne und in meiner arroganten Art nahm ich nur ihre verdreckten, klauenartigen Finger wahr, die meinen Arm hinunterkrochen, bis sie meinen Handgelenken unangenehm nahe kamen. Ich richtete mich zu voller Größe auf und wurde so fast doppelt so groß wie sie. Dann sagte ich in kühlem, sachlichem Ton: »Mrs Smith ist von einem gesunden kleinen Jungen entbunden worden. Mutter und Baby sind beide wohlauf. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss los.«
»Gott sei Dank«, sagte sie und ließ meinen Ärmel und mein Fahrrad los. Sonst sagte sie nichts.
Verrückte alte Schachtel, dachte ich verärgert, als ich losfuhr. Man sollte sie überhaupt nicht mehr rauslassen.
Erst ein knappes Jahr später, als ich in der Bezirkskrankenpflege arbeitete, erfuhr ich mehr über Mrs Jenkins … und lernte, etwas demütiger zu sein.