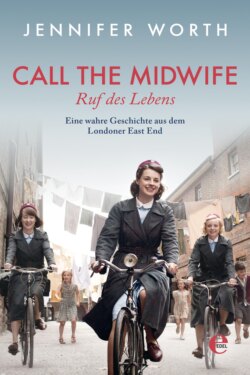Читать книгу Call the Midwife - Ruf des Lebens - Jennifer Worth - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеDas Nonnatus House lag im Herzen der Londoner Docklands. Seine Praxis kümmerte sich um Stepney, Limehouse, Millwall, die Isle of Dogs, Cubitt Town, Poplar, Bow, Mile End und Whitechapel. Die Gegend war dicht bevölkert, die meisten Familien lebten bereits seit Generationen dort und kaum jemand zog je weiter als ein, zwei Straßen von seinem Geburtsort weg. Das Leben spielte sich auf engstem Raum ab, die Kinder wurden von einer Großfamilie aus Tanten, Großeltern, Cousins, Cousinen und älteren Geschwistern aufgezogen, die alle nur wenige Häuser oder höchstens ein paar Straßen entfernt wohnten. Kinder rannten ständig von einem Haus ins andere und ich kann mich aus der Zeit, als ich dort lebte und arbeitete, nicht erinnern, dass außer bei Nacht je eine Tür verschlossen war.
Überall waren Kinder, und die Straßen waren ihr Spielplatz. In den 1950er-Jahren fuhren keine Autos durch die Seitenstraßen, denn niemand hatte ein Auto, daher war es völlig ungefährlich, dort zu spielen. Auf den Hauptstraßen, besonders auf den Zufahrtswegen der Docks, gab es Schwerlastverkehr, doch die kleinen Sträßchen waren vom Autoverkehr frei.
Die Trümmergelände waren Abenteuerspielplätze. Es gab viele davon, sie waren schreckliche Andenken an den Krieg und die heftige Bombardierung der Docklands nur zehn Jahre zuvor. Riesige Stücke waren aus den Häuserreihen herausgerissen, jedes etwa zwei oder drei Straßenzüge breit. Das Gebiet war grob mit Bretterwänden abgesperrt, die die Wüste aus Schutt mit einzelnen halb stehenden, halb umgestürzten Mauerresten nur zum Teil verbargen. Vielleicht nagelte einer irgendwo ein Schild an, auf dem VORSICHT – BETRETEN VERBOTEN stand, doch das war für jeden aufgeweckten Jungen über sechs oder sieben wie ein rotes Tuch für den Stier, und bei jedem zerbombten Grundstück gab es geheime Eingänge, wo jemand vorsichtig Bretter entfernt hatte, sodass sich ein kleiner Körper durchquetschen konnte. Offiziell war niemandem der Zutritt gestattet, aber alle, auch die Polizei, drückten offenbar ein Auge zu.
Es war ohne Zweifel eine raue Gegend. Messerstechereien waren üblich. Straßenkämpfe waren üblich. Streit und Prügeleien in den Pubs waren alltägliche Ereignisse. In den kleinen Häusern lebten die Menschen beengt und häusliche Gewalt war an der Tagesordnung. Doch ich habe nie etwas über Gewalt an Kindern oder älteren Menschen gehört; Schwachen gegenüber gab es eine gewisse Form des Respekts. Es war die Zeit der Brüder Kray, eine Zeit der Bandenkriege, von Vergeltung, organisierter Kriminalität und erbitterter Rivalität. Die Polizei war überall und kein Polizist ging allein auf Streife. Doch ich habe nie davon gehört, dass man eine alte Frau niedergeschlagen und ihr die Rente gestohlen oder dass man ein Kind entführt und ermordet hätte.
Die überwiegende Mehrheit der Männer, die in der Gegend lebten, arbeitete in den Docks.
Die meisten hatten Arbeit, doch die Löhne waren niedrig und die Arbeitstage lang. Die Männer, die einer qualifizierten Tätigkeit nachgingen, wurden relativ gut bezahlt und hatten regelmäßige Arbeitszeiten. Wer einen solchen Arbeitsplatz hatte, tat alles, um ihn zu behalten. Die Fertigkeiten blieben innerhalb der Familie, man gab sie vom Vater an die Söhne oder an die Neffen weiter. Für die ungelernten Arbeiter jedoch muss das Leben die Hölle gewesen sein. Wenn keine Schiffe zu entladen waren, gab es keine Arbeit, dann lungerten die Männer den ganzen Tag bei den Toren herum, rauchten und stritten sich. Wenn allerdings ein Schiff entladen werden musste, bedeutete das vierzehn oder sogar achtzehn Stunden pausenloser körperlicher Arbeit. Morgens um fünf fingen sie an und arbeiteten bis zehn Uhr abends. Kein Wunder, dass sie anschließend nur noch in die Pubs taumelten und sich hemmungslos betranken. Jungen begannen mit fünfzehn Jahren in den Docks zu arbeiten und man nahm sie genauso hart ran wie die Männer. Alle Arbeiter mussten in der Gewerkschaft sein, die Gewerkschaften bemühten sich um faire Bezahlung und Arbeitszeiten, doch das System mit seiner Mitgliedspflicht war eine beständige Quelle des Ärgers und schien ebenso sehr für Konflikte und Missgunst zwischen den Arbeitern zu sorgen, wie es ihnen Nutzen brachte. Ohne die Gewerkschaften jedoch wäre die Ausbeutung der Arbeiter mit Sicherheit 1950 noch so schlimm gewesen wie 1850.
Man heiratete in der Regel früh. Unter den ehrbaren Bewohnern des East Ends gab es ausgeprägte Vorstellungen zur Sexualmoral bis hin zur Prüderie. Unverheiratete Paare gab es nicht und kein Mädchen wäre je bei seinem Freund eingezogen. Wer es versuchte, bekam es mit seiner Familie zu tun. Über das, was auf den Trümmergrundstücken oder hinter den Schuppen für die Mülltonnen vor sich ging, wurde nicht gesprochen. Wenn ein Mädchen schwanger wurde, machte man dem jungen Mann so großen Druck, es zu heiraten, dass sich nur wenige verweigerten. Die Familien waren groß, häufig sehr groß, und nur selten wurde eine Ehe geschieden. Oft kam es zu heftigem, handgreiflichem Familienstreit, dennoch hielten Mann und Frau meist zusammen.
Nur wenige Frauen gingen arbeiten. Mädchen hatten natürlich noch einen Beruf, doch sobald eine junge Frau verheiratet war, hätte man sie schief angesehen, wäre sie arbeiten gegangen. Und sobald die ersten Kinder kamen, war es unmöglich: Ihr Los war dann ein endloser Tageslauf aus Kinder großziehen, putzen, waschen, einkaufen und kochen. Ich habe mich oft gefragt, wie diese Frauen in Familien mit bis zu dreizehn, vierzehn Kindern in einem kleinen Haus mit nur zwei oder drei Schlafzimmern ihren Alltag bewältigt haben. Manche Familien dieser Größe lebten in Wohnungen, die oft nur aus zwei Zimmern mit einer winzigen Küche bestanden.
Verhütungsmaßnahmen, wenn man überhaupt welche traf, waren unzuverlässig. Sie waren allein Sache der Frauen, die endlos über sichere Zeiträume, Rote Ulme, Gin mit Ingwer, heiße Duschen und weitere Hausmittel debattierten, doch nur wenige besuchten Kurse über Geburtenkontrolle, und soweit ich gehört habe, weigerten sich die meisten Männer schlicht, Kondome zu benutzen.
Wäsche waschen, aufhängen und bügeln nahm den größten Teil des Arbeitstags einer Frau ein. Waschmaschinen waren weitgehend unbekannt und der Trockner war noch nicht erfunden. Die Höfe waren immer voll von wahren Girlanden aus trocknenden Kleidern, und wir Hebammen mussten uns oft unseren Weg durch einen Wald aus flatternder Bettwäsche bahnen, um zu unseren Patientinnen zu gelangen. Auch im Haus oder der Wohnung musste man sich noch unter der Wäsche durchducken oder sich im Flur, auf der Treppe, in der Küche, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer an ihr vorbeidrücken. Waschsalons kamen erst in den 1960er-Jahren auf und so musste noch alles per Hand zu Hause gewaschen werden.
In den 1950ern hatten die meisten Häuser fließend kaltes Wasser und eine Toilette mit Spülung draußen im Hof. Manche hatten sogar ein Badezimmer. In den meisten Wohnblocks gab es jedoch keins und so waren die öffentlichen Waschhäuser immer noch in regem Gebrauch. Einmal pro Woche wurden brummige Jungen von ihren zupackenden Müttern dorthin gebracht, um gebadet zu werden. Die Männer vollzogen dort, wohl auf Anweisung ihrer Frauen, die gleichen Waschungen. Meist sah man sie am Samstagnachmittag auf dem Weg zum Badehaus mit einem kleinen Handtuch, einem Stück Seife und einem finsteren Blick, der von der allwöchentlich ausgetragenen und wieder einmal verlorenen Debatte zeugte.
In den meisten Häusern gab es ein Radio, aber ich habe während meiner gesamten Zeit im East End keinen einzigen Fernseher gesehen, was durchaus mit ein Grund für die großen Familien gewesen sein mag. Die Pubs, die Männerklubs, Tanzabende, Kino, Music-Hall und Hunderennen waren die wichtigsten Freizeitvergnügungen. Für viele junge Leute war überraschenderweise die Kirche Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens und jede Kirche bot an jedem Abend der Woche eine Reihe von Jugendklubs und Freizeitaktivitäten an. Die All Saints Church an der East India Dock Road, eine riesige viktorianische Kirche, hatte einen Jugendklub mit mehreren Hundert Mitgliedern, der von ihrem Pfarrer und nicht weniger als sieben tatkräftigen, jungen Kaplanen geleitet wurde. Und sie brauchten auch ihre ganze jugendliche Tatkraft, um sich Abend für Abend etwas für fünf-, sechshundert junge Menschen einfallen zu lassen.
Die Seeleute aller Nationalitäten, die in den Docks zu Tausenden an Land gingen, schienen keinen großen Einfluss auf die Menschen zu haben, die dort lebten. »Wir bleiben lieber unter uns«, war die vorherrschende Meinung, und das bedeutete, dass es keinen Kontakt gab. Töchter wurden mit Umsicht beschützt: Es gab genug Bordelle, um den Drang der Seeleute zu befriedigen. Während meiner Arbeit musste ich zwei, drei von ihnen aufsuchen, und ich fand es gruselig, dort zu sein.
Ich sah die Prostituierten, wie sie sich an den Hauptstraßen anboten, aber in den Nebenstraßen standen überhaupt keine, nicht einmal auf der Isle of Dogs, wo die meisten Seeleute ankamen. Erfahrene Professionelle verschwendeten ihre Zeit nicht in einer solch wenig aussichtsreichen Gegend, und hätte es eine begeisterte Amateurin unbedacht dort versucht, sie wäre sicher schnell von entrüsteten Anwohnern beiderlei Geschlechts vertrieben worden, vermutlich mit Gewalt. Die Bordelle waren bekannt und immer voll. Sie wurden wahrscheinlich illegal betrieben und von Zeit zu Zeit gab es Razzien der Polizei, doch das schien das Geschäft nicht zu beeinträchtigen. Ihre Existenz sorgte auf jeden Fall dafür, dass die Straßen sauber blieben.
In den vergangenen fünfzig Jahren hat sich das Leben unwiderruflich verändert. Meine Erinnerungen an die Docklands haben nichts mit der Gegend gemeinsam, wie man sie heute kennt. Das Leben der Familien und der Gesellschaft ist völlig in die Brüche gegangen, denn innerhalb eines Jahrzehnts kamen drei Dinge zusammen, die für eine jahrhundertealte Tradition das Ende bedeuteten: die Schließung der Docks, die Räumung der Slums und die Pille.
Die Räumung der Slums begann in den späten Fünfzigerjahren, noch während ich in der Gegend arbeitete. Natürlich waren die Häuser ziemlich schäbig, aber sie waren das Zuhause der Menschen, die sehr an ihnen hingen. Ich kann mich an viele, viele junge und alte Leute erinnern, Männer und Frauen, die einen Brief der Stadtverwaltung in Händen hielten, in dem man ihnen mitteilte, dass ihre Häuser oder Wohnungen abgerissen werden sollten und dass man sie umsiedeln wolle. Die meisten heulten. Sie kannten nichts anderes, und an einen Ort vier Meilen entfernt umzuziehen, erschien ihnen, wie ans Ende der Welt zu fahren. Der Umzug riss die Großfamilie auseinander, darunter litten die Kinder. Die Veränderung bedeutete für viele ältere Leute ganz wörtlich den Tod, denn sie konnten sich nicht mehr eingewöhnen. Was hat man von einer blitzsauberen neuen Wohnung mit Zentralheizung und Bad, wenn man die Enkel nicht mehr besuchen kann, niemanden zum Reden hat und das Lokal, in dem es das beste Bier Londons gab, nun vier Meilen weit weg ist?
Als die Pille in den frühen Sechzigerjahren auf den Markt kam, war das die Geburtsstunde der modernen Frau. Sie war nicht länger an den Kreislauf immer neuer Babys gebunden; sie wurde unabhängig. Mit der Pille kam, was wir heute die sexuelle Revolution nennen. Frauen konnten zum ersten Mal in der Geschichte leben wie die Männer und Sex um seiner selbst willen genießen. In den späten Fünfzigerjahren verzeichneten wir in unseren Büchern zwischen achtzig und hundert Geburten pro Monat. Bis 1963 war diese Zahl auf vier bis fünf pro Monat gefallen. Das ist mal ein gesellschaftlicher Wandel!
Die Schließung der Docks zog sich über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren hin, doch etwa 1980 war die Zeit der Handelsschiffe endgültig vorbei. Die Männer klammerten sich an ihre Arbeit, die Gewerkschaft versuchte, für sie einzustehen, und während der Siebzigerjahre gab es zahlreiche Streiks der Dockarbeiter, aber die Zeichen der Zeit waren deutlich. In Wirklichkeit sorgten die Streiks keineswegs für die Erhaltung der Jobs, sie beschleunigten vielmehr die Schließungen. Für die Männer der Gegend bedeuteten die Docks mehr als nur ihre Arbeit, mehr sogar als ihre Lebensart – sie waren das Leben an sich. Und für diese Männer brach die Welt zusammen. Die Häfen, die jahrhundertelang Englands wichtigste Lebensadern gewesen waren, wurden nicht mehr gebraucht. Daher wurden auch die Männer nicht mehr gebraucht. Das war das Ende der Docklands, wie ich sie gekannt habe.
In der viktorianischen Zeit war eine Welle sozialer Reformen durch das Land gerollt. Zum ersten Mal konnte man von Missständen lesen, die nie zuvor offengelegt worden waren, und das Gewissen der Öffentlichkeit wurde geweckt. Im Rahmen dieser Reformen wurde vielen vorausschauenden, gebildeten Frauen bewusst, welcher Bedarf an guter Pflege in den Krankenhäusern herrschte. Krankenpflege und Geburtshilfe waren in einem bedauernswerten Zustand. Beide galten nicht als angesehene Beschäftigung für eine gebildete Frau und so schlossen die ungebildeten die Lücke. Die karikaturartigen Figuren Sairey Gamp und Betsy Prig – ahnungslose, schmutzige, Gin schlürfende Frauen, wie wir sie aus den Werken von Charles Dickens kennen – mögen uns beim Lesen urkomisch vorkommen, doch überhaupt nicht komisch wäre es gewesen, hätten wir ihnen aufgrund unserer Armut unser Leben anvertrauen müssen.
Florence Nightingale ist unsere berühmteste Krankenschwester, ihr dynamisches Organisationstalent hat die Krankenpflege auf ewig geprägt. Doch sie war nicht allein, denn die Geschichte berichtet von vielen Gruppen engagierter Frauen, die es sich zur Aufgabe machten, das Niveau der Pflege zu heben. Zu ihnen gehörten die Hebammen des Heiligen Raymund Nonnatus*. Sie waren ein Orden anglikanischer Nonnen, die sich besseren Geburtsbedingungen für Arme verschrieben hatten. Sie gründeten Häuser im Londoner East End und in vielen Armenvierteln der großen britischen Industriestädte.
Im neunzehnten Jahrhundert (und natürlich auch davor) konnten arme Frauen es sich nicht leisten, einen Arzt zu bezahlen, der ihr Baby zur Welt brachte. Sie mussten sich daher auf die Dienste einer Hebamme oder »handywoman«, wie man sie oft nannte, verlassen, die sich alles selbst beigebracht hatte. Manche waren wahrscheinlich durchaus erfahrene Geburtshelferinnen, andere hatten eine erschütternde Sterblichkeitsbilanz. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts lag die Sterblichkeit der Mütter in den ärmsten Gesellschaftsschichten bei etwa 35 – 40 Prozent und die Kindersterblichkeit bei rund 60 Prozent. Eklampsie, Blutungen oder Lageanomalien bedeuteten unweigerlich den Tod der Mutter. Manchmal überließen diese Frauen ihre Patientinnen dem Todeskampf, wenn während der Geburt Komplikationen eintraten. Ohne Zweifel waren ihre Arbeitsmethoden, gelinde gesagt, nicht hygienisch, wodurch sie Infektionen und Krankheiten verbreiteten, die oft zum Tod führten.
Nicht allein dass es keine Ausbildung gab, es gab auch keinerlei Angaben über die Anzahl dieser handywomen und ihre Erfahrung. Die Hebammen des Heiligen Raymund erkannten, dass man diesem gesellschaftlichen Missstand nur durch eine ordentliche Ausbildung für Hebammen und die Regelung ihrer Arbeit durch Gesetze begegnen konnte.
Bei diesem Ringen um eine Gesetzgebung stießen die entschlossenen Nonnen und ihre Unterstützer auf die entschiedenste Gegenwehr. Der Kampf tobte ab etwa 1870: Man nannte sie »absurd«, »Zeitverschwender«, »ein Kuriosum« und »eine unangenehme Ansammlung von Wichtigtuerinnen«. Man warf ihnen alles Mögliche von Perversion bis Profitsucht vor. Doch die Nonnen des Nonnatus ließen sich nicht unterkriegen.
Der Kampf dauerte dreißig Jahre an, schließlich wurde 1902 das erste Gesetz zum Berufsstand der Hebammen verabschiedet und das Royal College of Midwives wurde geboren.
Die Arbeit der Hebammen des Heiligen Raymund Nonnatus basierte auf einem Fundament religiöser Disziplin. Ich zweifle nicht daran, dass das damals nötig war, denn die Arbeitsbedingungen waren so abscheulich und die Arbeit selbst so anstrengend, dass man sich von Gott berufen fühlen musste, um den Wunsch zu verspüren, sich dieser Aufgabe zu widmen. Florence Nightingale berichtet, dass ihr mit Anfang zwanzig Christus erschienen sei und ihr gesagt habe, ihr Leben sei für diese Aufgabe vorgesehen.
In den Elendsvierteln der Londoner Docklands arbeiteten die Hebammen des Heiligen Raymund inmitten der Ärmsten der Armen, und etwa bis zur Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts waren sie die einzigen verlässlichen Hebammen dort. Sie waren unermüdlich in ihrer Arbeit und überstanden Cholera-, Typhus-, Polio- und Tuberkuloseepidemien. Im frühen zwanzigsten Jahrhundert bewältigten sie zwei Weltkriege. In den Vierzigerjahren blieben sie in London und litten unter dem Luftkrieg mit seinen massiven Bombenangriffen auf die Docks. Sie brachten Babys in Luftschutzbunkern und Kellerlöchern, in Krypten von Kirchen und in U-Bahn-Stationen zur Welt. Diesem unermüdlichen, selbstlosen Einsatz hatten sie ihr Leben geweiht und die Menschen überall in den Docklands kannten, respektierten und bewunderten sie. Jeder sprach mit tief empfundener Liebe von ihnen.
Das waren die Hebammen des Heiligen Raymund Nonnatus, als ich sie kennenlernte: ein Orden von Nonnen, die ihr Gelübde abgelegt und sich damit einem Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam verschrieben hatten, die aber zugleich ausgebildete Krankenschwestern und Hebammen waren, und genau deswegen kam ich zu ihnen. Ich hatte nicht damit gerechnet, aber es sollte die wichtigste Erfahrung meines Lebens werden.
* Die Hebammen des Heiligen Raymund Nonnatus sind ein Pseudonym. Den Namen habe ich von St. Raymund Nonnatus übernommen, dem Schutzpatron der Hebammen und Geburtsmediziner, der schwangeren Frauen, der Geburt und der Neugeborenen. Er kam 1204 in Katalonien, einem Teil Spaniens, per Kaiserschnitt zur Welt (»non natus« ist Lateinisch für »nicht geboren«). Seine Mutter starb kaum verwunderlich bei seiner Geburt. Er wurde Priester und starb 1240.