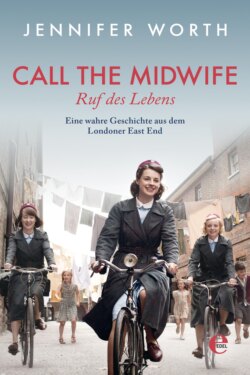Читать книгу Call the Midwife - Ruf des Lebens - Jennifer Worth - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorsorgesprechstunde
ОглавлениеWahrscheinlich gibt es an jedem Beruf Seiten, die man nicht mag. Ich mochte die Vorsorge nicht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich die Vorsorgesprechstunden hasste und dass mir jede Woche vor Dienstagnachmittag graute. Es war nicht nur die harte Arbeit – obwohl sie allein schon genügte. Die Hebammen versuchten ihren Tag so zu planen, dass wir unsere Morgenbesuche bis zwölf Uhr abgeschlossen haben konnten. Wir aßen früh zu Mittag und um halb zwei begannen wir, alles für die Untersuchungen vorzubereiten, sodass wir um zwei die Praxis öffnen konnten. Dann arbeiteten wir durch, bis wir fertig waren, und das war oft erst um sechs oder sieben Uhr. Anschließend mussten wir noch unsere Abendbesuche erledigen.
Das machte mir nichts aus – harte Arbeit hat mir noch nie etwas ausgemacht. Was mich wirklich fertigmachte, war, glaube ich, die schiere Menge ungewaschener weiblicher Körper, die ausströmende Wärme und Feuchtigkeit, das endlose Geplapper und vor allem der Geruch. Ich konnte anschließend noch so oft baden und mich umziehen – immer dauerte es ein paar Tage, bis ich den Übelkeit erregenden Geruch von vaginalem Ausfluss, Urin, kaltem Schweiß und ungewaschener Kleidung wieder loswurde. All diese Düfte vermischten sich zu einem heißen, klebrigen Dampf, der alles durchdrang: Kleider, Haare und Haut. Oft war ich während der regelmäßigen Vorsorgesprechstunden so weit, dass ich an die frische Luft gehen musste, wo ich mich würgend über das Geländer an der Tür lehnte, um den Brechreiz niederzuringen.
Doch jede von uns ist anders und ich habe nicht eine einzige Hebamme kennengelernt, die ähnlich zu leiden hatte. Wenn ich davon erzählte, war die Überraschung immer groß: »Was für ein Geruch?«, oder: »Na ja, es wird schon manchmal etwas heiß.« Also redete ich nicht weiter über meine Empfindungen. Ständig führte ich mir vor Augen, wie überaus wichtig die Vorsorgemaßnahmen waren, die so entscheidend dazu beigetragen hatten, dass die Zahl der Todesfälle unter Gebärenden stark gesunken war. Der Gedanke an die Geburtshilfe in früherer Zeit und das endlose Leid von Frauen unter der Geburt gab mir neue Kraft, wenn ich gerade wieder glaubte, ich könne die Untersuchung auch nur einer einzigen weiteren Frau nicht mehr ertragen.
In früheren Zeiten war es normal, dass Frauen während ihrer Schwangerschaft und der Geburt völlig auf sich gestellt waren. In vielen ursprünglichen Gesellschaftsformen galten Menstruierende, Schwangere, Gebärende und stillende Mütter als unrein. Die Frau wurde isoliert und durfte häufig nicht berührt werden, noch nicht einmal von einer anderen Frau. Sie musste all ihre Qualen allein durchstehen. Daher überlebten nur die Gesündesten, und durch die Prozesse der Mutation und der Anpassung wurden erbliche Anomalitäten wie etwa ein Missverhältnis zwischen der Größe des Beckens und dem Kopfumfang des Kindes behoben, vor allem in entlegenen Gegenden der Welt, und so wurde das Entbinden allmählich leichter.
In der westlichen Gesellschaft, die wir Zivilisation nennen, geschah das nicht, und mehr als ein Dutzend mögliche Komplikationen, von denen einige tödlich endeten, kamen zu den natürlichen Gefahrenquellen hinzu: übergroße Bevölkerungsdichte; Infektionen durch Staphylokokken und Streptokokken, andere Infektionskrankheiten wie Cholera, Scharlach, Typhus und Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, Rachitis; viele Schwangerschaften in schneller Folge oder die Gefahren infizierten Wassers. Bedenkt man, dass zu all dem noch Vernachlässigung und Gleichgültigkeit gegenüber Schwangerschaft und Geburt kamen, so wird klar, wieso das Kinderkriegen »Evas Fluch« genannt wurde und Frauen häufig mit dem eigenen Tod rechnen mussten, wenn sie neues Leben schenkten.
Die Hebammen des Heiligen Raymund Nonnatus boten ihre Vorsorgesprechstunde in einer alten Kirche an. Heute würde jeder bei dem Gedanken, dass Vorsorgeuntersuchungen mit allem, was dazugehört, in einer alten, entweihten Kirche stattfinden, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Hygienekontrolleure, Gesundheitskontrolleure und alle möglichen anderen Kontrolleure dieser Welt hätten entschieden etwas dagegen. Doch in den 1950er-Jahren sprach sich niemand dagegen aus, ja, die Nonnen erhielten sogar höchstes Lob für ihren Einfall und die Initiative, die Kirche einem neuen Zweck zuzuführen. Außer der Installation einer Toilette mit fließendem Wasser waren keine Umbaumaßnahmen vorgenommen worden. Heißes Wasser kam aus einem Boiler an der Wand.
Als Heizung diente ein großer Koksofen aus schwarzem Gusseisen, der bereits am Vormittag von Heizer Fred angefacht werden musste. Solche Öfen waren damals weit verbreitet, ich habe sie sogar in Krankenhäusern auf Station gesehen. (Ich erinnere mich an eine Station, wo wir unsere Spritzen und Nadeln sterilisierten, indem wir sie in einem Topf auf dem Ofen auskochten.) Die Öfen waren sehr solide, hatten eine flache Oberseite und man füllte sie, indem man einen kreisförmigen Deckel öffnete und Koks aus einer eisernen Schütte hineingab. Dazu brauchte man Kraft in den Armen. Der Ofen stand in der Mitte des Raums, sodass die Hitze in alle Richtungen ausstrahlen konnte. Der Abzug führte senkrecht nach oben durch das Dach.
Es gab eine Reihe von Untersuchungstischen, bewegliche Paravents schirmten die Patientinnen ab und wir saßen auf Stühlen an hölzernen Tischen, wenn wir unsere Patientinnenakten führten. Ein langer Tisch mit Marmorplatte stand neben der Spüle, auf ihm legten wir unsere Instrumente und die übrige Ausrüstung ab. Außerdem stand dort ein Gaskocher, daneben lag eine Schachtel Streichhölzer. Dieser Kocher mit einer einzigen Flamme war ständig im Gebrauch, um Urin zum Kochen zu bringen. Ich habe den Geruch noch heute in der Nase – nach fünfzig Jahren!
Eine solche Untersuchungspraxis, wie es sie in ähnlicher Form im ganzen Land gab, mag nach heutigen Begriffen primitiv wirken, doch sie hat Tausenden Müttern und Babys das Leben gerettet. Diese Hebammenpraxis war bis 1948 die einzige in der Gegend, dann wurde eine kleine Geburtshilfestation mit acht Betten im Krankenhaus von Poplar eröffnet. Davor hatte es im Krankenhaus keine solche Station gegeben, obwohl Poplar eine Bevölkerungsdichte von fünfzigtausend Einwohnern pro Quadratmeile gehabt haben soll. Als man nach dem Krieg beschloss, in dem Krankenhaus eine eigene Station einzurichten, gab es keine besonderen Vorkehrungen. Es wurden einfach zwei kleine Stationen der Geburtsmedizin zugewiesen – eine für die Zeit des Wochenbetts und die andere für Entbindungen. Dort fand auch die Vorsorge statt. Es war zwar unzureichend, aber es war besser als nichts. Unterbringung, Ausrüstung und Technik waren nicht entscheidend. Entscheidend waren Wissen, Können und Erfahrung der Hebammen.
Vor den klinischen Untersuchungen hatte ich die größte Abneigung. Es kann nicht wieder so schlimm werden wie letzte Woche, dachte ich, als ich die Türen öffnete. Mich schauderte noch im Nachhinein, als ich mich daran erinnerte. Gott sei Dank habe ich Handschuhe getragen, dachte ich. Was wäre andernfalls wohl passiert?
Während der ganzen vergangenen Woche hatte ich immer wieder an sie denken müssen. Sie war gegen sechs Uhr in Pantoffeln in die Praxis geschlurft, Lockenwickler im Haar. Eine Kippe hing an ihrer Unterlippe und sie hatte fünf Kinder dabei, alle jünger als sieben. Ihr Termin war um drei gewesen. Ich war gerade nach einem nicht besonders anstrengenden Nachmittag beim Aufräumen. Zwei der Hebammenschülerinnen waren schon gegangen und die dritte hatte ihre letzte Patientin. Von den Schwestern war nur noch Novizin Ruth anwesend (Novizin war sie nur in kirchlicher Hinsicht, nicht jedoch als Hebamme). Sie bat mich, Lil Hoskin zu untersuchen.
Es war Lils erste pränatale Untersuchung, obwohl sie bereits seit fünf Monaten keine Periode mehr gehabt hatte. Das wird jetzt sicher noch einmal eine halbe Stunde dauern, seufzte ich im Stillen, als ich mir die Akte nahm. Ich überflog sie kurz: dreizehnte Schwangerschaft, zehn Lebendgeburten, bisher keine Geschlechtskrankheiten, kein Rheumaanfall oder Herzleiden, keine Tuberkuloseinfektion bislang, Blasenerkrankungen ja, aber keine Anzeichen einer Nierenentzündung, Brustdrüsenentzündungen nach dem dritten und dem siebten Baby, alle übrigen Babys wurden gestillt.
Die geburtsmedizinische Anamnese konnte ich zum größten Teil ihrer Akte entnehmen, aber ich musste einige Fragen zu ihrer derzeitigen Schwangerschaft stellen.
»Hatten Sie Blutungen?«
»Nö.«
»Vaginaler Ausfluss?«
»’n bisschen.«
»Welche Farbe?«
»Meistens gelblich.«
»Waren die Knöchel mal geschwollen?«
»Nö.«
»Atemnot irgendwann?«
»Nö.«
»Mussten Sie sich übergeben?«
»’n bisschen. War aber nich viel.«
»Verstopfung?«
»Jau, ganz ordentlich.«
»Sind Sie sicher, dass Sie schwanger sind? Sie sind ja nicht untersucht oder getestet worden.«
»Ich muss es ja wohl wissen«, sagte sie bedeutungsvoll und lachte schrill auf.
Die Kinder liefen derweil wild durch den ganzen Raum. Die alte Kirche war riesig, stand so gut wie leer und war daher ein fabelhafter Spielplatz. Mir machte es nichts aus – kein gesundes Kind kann solch großen Räumen widerstehen und der Bewegungsdrang von Fünfjährigen ist stark. Doch Lil glaubte ihre Autorität unter Beweis stellen zu müssen. Sie packte eines der Kinder am Arm und zog den Jungen zu sich hin. Sie schlug ihm kräftig auf Wange und Ohr und schrie ihn an.
»Jetzt sei still und benimm dich, du kleiner Scheißer. Und das gilt für euch alle, klar?«
Der Junge heulte vor Schmerz, aber auch wegen der Ungerechtigkeit laut auf. Er entfernte sich etwa zehn Meter von seiner Mutter und schrie und stampfte, bis er kaum noch Luft bekam. Dann hielt er inne, atmete tief ein und heulte wieder los. Die anderen Kinder waren stehen geblieben, einige begannen zu wimmern. Aus dem fröhlichen, wenn auch lärmenden Spiel war von jetzt auf gleich ein Kampf geworden, und das nur wegen dieser dummen Frau. Von da an hasste ich sie.
Ruth, die Novizin, ging zu dem Jungen hin und versuchte ihn zu trösten, doch er schob sie weg und warf sich auf den Boden, wo er schrie und um sich trat. Lil grinste und sagte zu mir: »Lassen Sie ihn nur, er wirds schon verkraften.« Dann rief sie zu dem Kind hinüber: »Halts Maul oder du fängst dir noch eine ein.«
Ich konnte es nicht mehr ertragen, und damit sie nicht noch mehr Schaden anrichtete, sagte ich ihr, dass ich ihren Urin untersuchen müsse, gab ihr ein Töpfchen und bat sie, zur Toilette zu gehen und mir eine Probe zu bringen. Anschließend, so erklärte ich ihr, wolle ich sie untersuchen, daher solle sie sich bitte unterhalb der Taille frei machen und sich auf eine der Liegen legen.
Ihre Pantoffeln klatschten auf den Holzboden, als sie zur Toilette ging. Sie kam kichernd zurück und gab mir die Probe, dann schlappte sie hinüber zu den Liegen. Ich biss die Zähne zusammen. Was hat sie bloß so zu kichern, dachte ich. Das Kind lag immer noch auf dem Boden, doch es weinte nicht mehr so sehr. Die anderen Kinder schauten verdrossen drein und hatten das Spielen aufgegeben.
Ich ging hinüber zu der Arbeitsfläche, um den Urin zu testen. Das Lackmuspapier wurde rot und zeigte damit einen normalen sauren pH-Wert an. Der Urin war trüb und hatte eine hohe spezifische Dichte. Ich wollte seinen Zuckergehalt prüfen und zündete die Gasflamme an. Ich füllte ein Reagenzglas zur Hälfte mit Urin, gab ein paar Tropfen Fehling’sche Lösung hinzu und brachte den Inhalt des Glases zum Kochen. Es war kein Zucker nachweisbar. Zum Schluss musste ich den Urin noch auf Eiweiß prüfen, indem ich das Reagenzglas wieder füllte, diesmal aber nur die obere Hälfte zum Kochen brachte. Er wurde nicht weiß oder dickflüssig, was bewies, dass keine Albuminurie vorlag.
Ich brauchte etwa fünf Minuten für diese Tests. Unterdessen hatte das Kind aufgehört zu weinen. Der Junge saß nun auf dem Boden und Novizin Ruth spielte mit ihm. Sie rollten sich kleine Bälle zu. Ihre feinen, zarten Gesichtszüge wurden durch ihren weißen Musselinschleier noch betont, doch als sie sich vorbeugte, rutschte er herunter. Der Junge schnappte ihn sich und zog. Die anderen Kinder lachten. Sie schienen wieder glücklich. Trotz ihrer groben, brutalen Mutter, dachte ich, als ich zu Lil zurückging, die nun auf der Liege lag.
Sie war fett, ihre wabbelige Haut war schmutzig und feucht vor Schweiß. Ihr Körper roch muffig und ungewaschen. Muss ich sie wirklich anfassen?, dachte ich, als ich näher kam. Ich versuchte mir vor Augen zu führen, dass sie wahrscheinlich mit ihrem Mann und allen Kindern in zwei oder drei Zimmern ohne Bad oder auch nur fließend heißem Wasser lebte, doch das ließ meinen Ekel nicht verfliegen. Hätte sie ihr Kind nicht so herzlos geschlagen, dann wäre meine Abneigung gegen sie vielleicht geringer gewesen.
Ich zog sterile Handschuhe über und bedeckte Lil von der Hüfte abwärts mit einem Tuch, denn ich wollte ihre Brüste untersuchen. Ich bat sie, ihren Pullover hochzuziehen. Sie kicherte und alles an ihr schwabbelte, als sie ihn hochzog. Als ihre Achselhöhlen zum Vorschein kamen, wurde der Gestank intensiver. Zwei große hängende Brüste rutschten links und rechts heraus, und die Adern, die sich zu den riesigen, fast schwarzen Brustwarzen hinzogen, zeichneten sich deutlich ab. Diese Adern waren ein verlässliches Anzeichen einer Schwangerschaft. Ein wenig Flüssigkeit ließ sich aus den Brustwarzen herausdrücken. Das reicht für eine Diagnose, dachte ich. Ich teilte es ihr mit.
Sie lachte schreiend auf. »Habs Ihnen doch gesagt, oder nich?«
Dann maß ich ihren Blutdruck. Er war recht hoch. Sie braucht mehr Ruhe, dachte ich, aber ich bezweifle, dass sie sie bekommt. Die Kinder hatten ihre gute Laune wiedergefunden und rannten erneut umher.
Ich zog ihren Pullover wieder herunter und entblößte ihren dicken Bauch, dessen Haut über und über mit Schwangerschaftsstreifen bedeckt war. Schon bei dem geringsten Druck meiner Hand spürte ich deutlich den Fundus der Gebärmutter über dem Nabel.
»Wann war Ihre letzte Periode?«
»Keine Ahnung. Letztes Jahr irgendwann, glaub ich.« Sie giggelte und ihr Bauch wabbelte auf und ab.
»Haben Sie schon Bewegungen gespürt?«
»Nö.«
»Dann werde ich jetzt die Herztöne des Babys suchen.«
Ich nahm mein Pinard-Stethoskop, ein kleines trompetenförmiges Instrument aus Metall, das man mit dem breiteren Ende auf den Bauch der Patientin drückt, um dann sein Ohr an das schmalere, flache Ende zu halten. Normalerweise hörte man das gleichmäßige Pochen des Herzens recht deutlich. Ich versuchte es an verschiedenen Stellen, doch ich hörte nichts. Ich rief Novizin Ruth, denn ich wollte mir sicher sein und außerdem ihre Meinung zum Status der Schwangerschaft einholen. Auch sie konnte keine Herztöne hören, war jedoch der Ansicht, dass andere Anzeichen für eine Schwangerschaft sprachen. Sie bat mich, eine vaginale Untersuchung durchzuführen, die das bestätigen sollte.
Das hatte ich erwartet und befürchtet. Ich bat Lil, die Beine anzuwinkeln und zu spreizen. Als sie meiner Bitte nachkam, waberte mir der schale Geruch von Urin, Scheidenausfluss und Schweiß entgegen. Ich musste gegen aufkommende Übelkeit ankämpfen. Ich darf mich jetzt nicht übergeben, war alles, was ich in dem Moment denken konnte. Ihr Schamhaar klebte vor Dreck und Feuchtigkeit büschelweise zusammen. Vielleicht hat sie ja Filzläuse, dachte ich. Novizin Ruth hatte mich genau im Blick. Vielleicht verstand sie ja, wie es mir ging – die Nonnen waren sehr empfindsam –, doch sie sagte nur wenig. Ich befeuchtete einen Wattebausch, um die bläulich aussehende Scheide zu reinigen, und während ich sie säuberte, bemerkte ich die zahlreichen Ödeme auf der einen Seite. Sie war vor eingelagerter Flüssigkeit angeschwollen, die andere hingegen nicht. Ich öffnete die Scheide vorsichtig mit zwei Fingern und dabei spürte ich mit einem Finger eine harte, kleine Erhebung an der ödemischen Seite. Ich strich mit dem Finger einige Male darüber. Sie war deutlich spürbar. Bei harten Stellen in weichem Gewebe muss man unwillkürlich an Krebs denken.
Ich spürte, wie mich Novizin Ruth während der ganzen Zeit aufmerksam beobachtete. Ich hob den Kopf und sah sie fragend an. Sie sagte: »Ich hole mir eben ein Paar Handschuhe. Machen Sie mal einen Moment Pause, Schwester.«
Einige Sekunden später war sie zurück und nahm meinen Platz ein. Sie sagte kein Wort, bis sie ihre Untersuchung beendet und Lil wieder zugedeckt hatte.
»Sie können Ihre Beine nun wieder ablegen, Lil, aber bleiben Sie bitte noch einen Augenblick liegen, denn wir möchten Sie gleich noch weiter untersuchen. Kommen Sie bitte einmal kurz mit mir zum Schreibtisch, Schwester.«
Am Schreibtisch auf der anderen Seite des Raumes sagte sie ganz ruhig zu mir: »Ich glaube, dieser Knoten ist ein syphilitisches Geschwür. Ich werde jetzt sofort Dr. Turner anrufen und ihn fragen, ob er sie untersuchen kommen kann, solange sie noch hier ist. Wenn wir sie jetzt mit der Anweisung wegschicken, zum Arzt zu gehen, dann wird sie es sehr wahrscheinlich nicht tun. Der Syphiliserreger Spirochaeta pallida kann die Plazenta durchdringen und den Fötus infizieren. Der Schanker ist jedoch noch im ersten Stadium, und wenn die Krankheit früh diagnostiziert und behandelt wird, stehen die Chancen auf Genesung gut und das Baby bleibt verschont.«
Ich wurde fast ohnmächtig und erinnere mich noch genau, dass ich mich an den Tisch klammern musste, bevor ich mich setzen konnte. Ich hatte sie angefasst – diese widerliche Person – und ihr syphilitisches Geschwür. Ich konnte nichts sagen, doch Novizin Ruth sagte aufmunternd: »Mach dir keine Sorgen. Du hast Handschuhe getragen. Du hast dich sicher nicht angesteckt.«
Sie ging zum Nonnatus House, um den Arzt anzurufen. Ich konnte mich nicht rühren. Ich saß fünf Minuten lang auf meinem Platz und musste eine Übelkeitswelle nach der anderen niederkämpfen, während es mir kalt über den Rücken lief. Die Kinder spielten glücklich und zufrieden um mich her. Nichts regte sich hinter dem Paravent, dann drang das tiefe, gleichmäßige Geräusch zufriedenen Schnarchens an mein Ohr. Lil war eingeschlafen.
Der Arzt kam nach einer Viertelstunde und Novizin Ruth bat mich, ihn zu begleiten. Ich muss blass ausgesehen haben, denn sie fragte mich: »Gehts dir gut? Bekommst du das hin?«
Ich nickte stumm. Ich konnte nicht Nein sagen. Immerhin war ich ausgebildete Krankenschwester, die an kritische Situationen gewöhnt war. Doch selbst nach fünf Jahren im Krankenhaus – Notaufnahme, OP, Krebspatienten, Amputationen, Sterben und Tod – hatte nichts und niemand so tiefe Abscheu in mir erregt wie diese Frau namens Lil.
Der Arzt untersuchte sie und entnahm eine Gewebeprobe des Geschwürs für das Pathologielabor. Außerdem nahm er eine Blutprobe für einen Wassermann-Test. Dann sagte er zu Lil: »Ich glaube, Sie haben eine Geschlechtskrankheit in einem sehr frühen Stadium. Wir …«
Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da lachte sie schallend laut auf. »Oh Goott! Nich schon wieder! Is doch ’n Witz, oder!?«
Der Arzt blickte wie versteinert. Er sagte: »Wir haben es früh erkannt. Ich werde Ihnen jetzt Penizillin geben und Sie müssen von nun an zehn Tage lang jeden Tag eine Spritze bekommen. Wir müssen Ihr Baby schützen.«
»Wie Sie wollen«, kicherte sie, »mir egal«, und zwinkerte ihm zu.
Er zeigte keine Regung, als er eine riesige Dosis Penizillin aufzog und in ihren Oberschenkel injizierte. Wir ließen sie sich anziehen und gingen zurück zum Schreibtisch.
»Wir werden zwar noch die Laborergebnisse für Blut und Serum abwarten«, sagte er zu Novizin Ruth, »aber ich denke, es gibt keinen Zweifel an der Diagnose. Würden Sie bitte tägliche Hausbesuche für die Injektionen veranlassen, Schwestern? Wenn wir sie bitten, in die Praxis zu kommen, wird sie sicher zu faul sein oder es vergessen. Wenn der Fötus noch lebt, müssen wir alles tun, was in unserer Macht steht.«
Es war nun weit nach sieben Uhr. Lil hatte sich wieder angezogen und schrie ihre Kinder an mitzukommen. Sie zündete sich noch eine Kippe an und rief fröhlich: »Ja dann tschüss zusammen!«
Sie blickte Novizin Ruth bedeutungsvoll an und sagte mit anzüglichem Grinsen: »Bleiben Sie sauber.« Dann schrie sie vor Lachen.
Ich teilte ihr mit, wir kämen sie nun jeden Tag besuchen, um ihr die nächste Injektion zu geben. »Wie Sie wollen«, sagte sie mit einem Schulterzucken und ging.
Jetzt musste ich noch alles aufräumen. Ich fühlte mich so müde, dass ich kaum ein Bein vor das andere brachte. Der moralische und emotionale Schock mussten ihren Teil zu der Müdigkeit beigetragen haben.
Novizin Ruth grinste mich freundlich an: »Man muss sie in diesem Leben alle mal kennengelernt haben. Also, hast du denn noch Abendbesuche zu machen?«
Ich nickte. »Drei postnatale. Einer davon oben in Bow.«
»Dann geh jetzt los. Ich mache hier sauber.«
Als ich die Praxis verließ, dankte ich ihr von ganzem Herzen. Die frische Luft gab mir neuen Schwung und das Fahrradfahren vertrieb meine Müdigkeit.
Am folgenden Morgen sah ich mir den Tagesplan an und las, dass ich Lil Hoskin in den Peabody-Wohnblocks ihre Penizillininjektion verabreichen musste. Ich stöhnte innerlich auf. Ich hatte gewusst, dass es an mir hängen blieb. Laut Anweisung sollte es mein letzter Besuch vor dem Mittagessen werden, Spritze und Nadel sollte ich getrennt von der Hebammentasche transportieren und ich musste Handschuhe tragen. Das hätte man mir nicht extra sagen müssen.
Die Peabody-Wohnblocks in Stepney waren berüchtigt. Sie waren bereits seit fünfzehn Jahren zum Abriss freigegeben, doch noch standen sie und boten Familien eine Behausung. Sie gehörten zur schlimmsten Sorte Wohnblocks, denn es gab nur einen einzigen Wasserhahn am Ende jeder Galerie und dort war auch die einzige Toilette. In den Wohnungen gab es kein fließendes Wasser. Ich begann meine Ansichten über Lil zu überdenken. Vielleicht wäre ich ja wie sie, müsste ich unter solchen Bedingungen leben.
Die Tür stand offen, ich klopfte trotzdem.
»Komm rein, Liebes, ich erwarte dich schon. Ich hab Wasser für dich vorbereitet.«
Wie nett. Sie musste eine Menge Aufwand betrieben haben, um Wasser zu besorgen und es warm zu machen. Die Wohnung war dreckig und es stank. Kaum ein Quadratzentimeter des Bodens war zu sehen und überall stolperten kleine Kinder umher, die von der Hüfte abwärts nackt waren.
In ihren eigenen vier Wänden wirkte Lil ganz anders. Vielleicht hatte die Sprechstunde sie irgendwie eingeschüchtert, und so hatte sie sich durch Angeberei behaupten wollen. In ihrer eigenen Wohnung benahm sie sich nicht so laut und schrill. Das irritierende Kichern, so merkte ich jetzt, war nichts als der Ausdruck ihrer beständigen, unbezwingbaren guten Laune. Zwar schubste sie ihre Kinder herum, doch sie wurde nie ruppig dabei.
»Geh mal aus’m Weg, du kleiner Scheißer. Die Schwester kommt nich durch.« Sie drehte sich zu mir um. »Bitteschön. Da kannst du dein Zeug hinlegen.«
Sie hatte sich die Mühe gemacht, eine Ecke des Tischs frei zu räumen und eine Waschschüssel, Seife und ein schmutziges Handtuch danebengelegt.
»Dachte, du brauchst vielleicht ’n nettes, sauberes Handtuch, was, Liebes?«
Alles ist relativ.
Ich stellte meine Tasche auf den Tisch, nahm jedoch nur Spritze, Nadel, Ampulle, Handschuhe und einen Wattetupfer heraus, der in Alkohol getränkt war. Die Kinder waren wie gebannt.
»Weg da oder es gibt eins hinter die Ohren«, rief Lil fröhlich. Und dann zu mir: »Willste mein Bein oder meinen Arsch?«
»Das ist egal. Wie es dir lieber ist.«
Sie hob ihren Rock hoch und beugte sich vor. Der riesige, runde Hintern wirkte wie ein eindeutiges Zeichen der Solidarität. Die Kinder rissen die Augen auf und drängten näher heran. Mit einem schrillen Lachen trat Lil aus wie ein Pferd.
»Scheiße, habt ihr so was etwa noch nie gesehn?«
Sie brüllte vor Lachen und der Hintern wackelte so sehr, dass eine Injektion unmöglich war.
»Stopp, jetzt bitte mal auf die Stuhllehne stützen und einmal kurz stillhalten.« Auch ich musste lachen.
Sie hielt still und nach nicht einmal einer Minute war die Injektion erledigt. Ich rieb fest über die ganze Hautfläche, um die Flüssigkeit gut zu verteilen, denn die Dosis war sehr stark. Ich legte alles in eine braune Papiertüte, um die Instrumente separat zu transportieren. Dann wusch ich mir die Hände und trocknete sie an ihrem Handtuch ab, nur um ihr einen Gefallen zu tun. Wir hatten immer unser eigenes Handtuch dabei, aber ich dachte, dass es zu benutzen eine allzu offensichtliche Zurückweisung wäre.
Sie brachte mich zur Tür und alle Kinder kamen mit uns auf die Galerie. »Bis morgen dann. Ich freu mich, dass du kommst. Ich mach dir ne schöne Tasse Tee.«
Ich radelte davon und musste über vieles nachdenken. In ihrer eigenen Umgebung war Lil keine widerliche alte Schlampe, sondern eine Heldin. Sie hielt die Familie in grässlichen Lebensumständen beisammen und trotz allem wirkten die Kinder glücklich. Sie war heiter und beklagte sich nicht. Wie sie sich mit der Syphilis angesteckt hatte, ging mich nichts an. Ich war dazu da, die Krankheit zu behandeln, und nicht, über Lil zu richten.
Bei meinem Besuch am nächsten Tag war ich so sehr damit beschäftigt zu überlegen, wie ich den angebotenen Tee ablehnen könnte, dass ich blöde und perplex vor mich hin starrte, als die Tür aufging und dort eine Lil stand, die nicht Lil war. Sie sah ein wenig kleiner und dicker aus, es waren die gleichen Pantoffeln, die gleichen Lockenwickler, die gleiche Kippe – aber irgendetwas war anders.
Ein vertrautes schrilles Lachen brachte einen zahnlosen Mund zum Vorschein. Sie pikste mir in den Bauch. »Sie denken jetz, ich wär Lil, was? Alle denken das. Ich bin ihre Mum. Wir sehn aus wie Zwillinge. Lil hat ne Fehlgeburt gehabt un liegt im Krankenhaus. Gut so, find ich. Sie hat mit zehn schon genug, un er is ja auch immer weg.«
Durch ein paar Fragen bekam ich die ganze Geschichte heraus. Lil hatte sich, kurz nachdem ich am Tag zuvor gegangen war, krank gefühlt und sich später übergeben. Sie hatte sich ins Bett gelegt und eines der Kinder losgeschickt, um die Oma zu holen. Wehen hatten eingesetzt und sie hatte sich noch einmal übergeben. Dann muss sie ohnmächtig geworden sein.
Die Oma sagte zu mir: »Mit ner Fehlgeburt komm ich noch klar, aber nich mit ner toten Frau. Nee, Leute!«
Sie hatte einen Arzt gerufen und Lil war sofort ins London Hospital eingeliefert worden. Später erfuhren wir, dass man einen mazerierten Fötus entfernt hatte. Er war wahrscheinlich bereits seit drei oder vier Tagen tot gewesen.