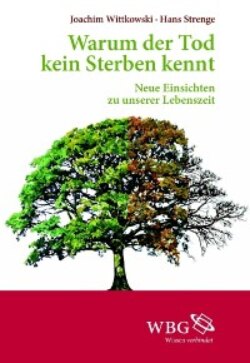Читать книгу Warum der Tod kein Sterben kennt - Joachim Wittkowski - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Allgemeine Kennzeichen des modernen Weltbildes
ОглавлениеWenn wir im Folgenden den Begriff der »Moderne« verwenden, so meinen wir damit die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der jüngeren Vergangenheit, also etwa der letzten hundert Jahre. Wir verwenden diesen Terminus also anders, als es in Literatur- und Kunstgeschichte üblich ist. Dabei wollen wir auf die begriffliche Unterscheidung in »Postmoderne« einerseits und die von GIDDENS (1991) propagierte »Hoch-« bzw. »Spätmoderne« andererseits nicht eingehen. In unserem Verständnis umfasst die Moderne jene kulturgeschichtlichen Strömungen, die sich deutlich von traditionellen Auffassungen und Praktiken abheben und die sich in fünf Merkmalen manifestieren (Giddens 1995; Gronemeyer 1993; Walter 1994).
(1) Entfremdung des Menschen von Gott und Natur: Das erste hervorstechende Merkmal der Moderne ist das Schwinden religiöser Orientierungen und die nachlassende Bindung des Menschen an Gott. Anders als in früheren Epochen wird Gott nicht mehr als Herr über Leben und Tod gesehen. Indem Zweifel am Status Gottes als Schöpfer der Natur einschließlich des Menschen aufkommen, wird auch die Zuständigkeit Gottes für den Lebensweg des Menschen infrage gestellt, und dies bewirkt Unsicherheit. Die säkularisierte und zugleich individualisierte Lebensweise erzeugte eine »neue metaphysische Verlorenheit« (Gronemeyer 2007, S. 48) des Menschen.
(2) Individualisierung: Dieses Kennzeichen der Moderne ist eng mit der Entfremdung des Menschen von Gott und Natur verflochten. Den von Descartes ausgehenden »Entschluß zu vernunftgemäßer Weltveränderung« bezeichnet GRONEMEYER (1993, S. 5) treffend als »Grundgebärde der Neuzeit«. Die Idee der Beherrschung der Natur konnte aber nur Platz greifen, nachdem sich das Verhältnis zwischen Gott und der Natur und damit zwangsläufig auch zwischen Gott und dem Menschen gelockert hatte (siehe oben). Der moderne Mensch ist bestimmt vom Bewusstsein seiner eigenen Individualität und seiner eigenen Gestaltungsmöglichkeiten – im Hinblick auf die Natur, aber auch bezüglich seines eigenen Lebens, das ihm zum »Projekt« wird. Die einzige Autorität ist das Selbst, Autonomie und Selbstverwirklichung sind die zentralen Werte. Diese Emanzipation von Gott und Glaubenslehre hat den Preis, dass der vormals selbstverständlich vorhandene Sinn des Lebens verloren ging.
»Der auf seine Vernunft pochende neuzeitliche Mensch gewinnt ohne eigenes Zutun, durch sein bloßes Dasein keine Existenz als Individuum. Er muß sich vielmehr selbst erschaffen […]. Er befreit sich von der göttlichen Vorsehung und unternimmt es, seinem Dasein selbst Sinn und Richtung zu geben. […] Nur in dem Maße, in dem er seine Eigenart und seinen Eigensinn entfaltet, gewinnt der Mensch Lebenssinn« (Gronemeyer 1993, S. 22).
Eine weitere Begleiterscheinung der Individualisierung des modernen Menschen ist das Bewusstsein seiner Verantwortung für sein eigenes einmaliges und einzigartiges Leben. Er hat nur einen Versuch, und es liegt an ihm, ob er gelingt oder misslingt. Er selbst ist seines Glückes Schmied. »Der Anspruch auf Einzigartigkeit macht das individuelle Leben unerhört kostbar und unersetzbar« (ebd., S. 23). Indem aber das (eigene) Leben an Wert gewinnt, wächst auch die Angst, es zu verlieren. »Wenn das Leben die einzige Gelegenheit ist, dann steigert sich die Verlustangst ins Unerträgliche« (ebd., 1993, S. 24).
(3) Beschleunigung: Die Moderne hat eine bisher ungekannte Dynamik entfaltet, die GIDDENS (1995, S. 173 f. u. 187 ff.) mit dem Bild des Dschagannath-Wagens umschreibt: ein viele Tonnen schwerer indischer Prozessionswagen, ein äußerst leistungsstarkes Gefährt, das die Menschen bis zu einem gewissen Grad zu steuern vermögen, das sich aber schließlich ihrer Kontrolle zu entziehen droht und Gefahr läuft, sich selbst zu zerstören. Die technischen Entwicklungen der letzten 50 Jahre im Bereich von Verkehr, Nachrichtenwesen und Telekommunikation, aber auch die Beschleunigung des sozialen Wandels und des allgemeinen Lebenstempos (Rosa 2005), die vielfach unter dem Schlagwort »Globalisierung« subsumiert werden, haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Ein Kennzeichen des gegenwärtig hohen Lebenstempos ist das Bemühen um eine Intensivierung des Lebens dadurch, dass man sich mehr Erlebnisinhalte pro Zeiteinheit zu verschaffen versucht. Dies wiederum ergibt sich aus der wahrgenommenen Diskrepanz zwischen der eigenen Lebenszeit und all den Möglichkeiten, welche die Welt zu bieten scheint (Gronemeyer 1993, S. 102 ff.). Angesichts der vielen Genussmöglichkeiten erscheint das eigene Leben zu kurz. Die daraus resultierende »Versäumnisangst« (ebd., S. 126) bewirkt eine hektische Suche nach immer mehr Genuss in immer kürzerer Zeit (etwa indem man gleichzeitig Musik hört, Kunstwerke betrachtet und exquisite Speisen zu sich nimmt, sich also Genuss in drei Sinnesmodalitäten verschafft).
(4) Ökonomisierung: Damit ist die Tendenz gemeint, alle Lebensbereiche unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten zu betrachten und überall eine Optimierung dieser Relation anzustreben. Dies gilt nicht nur für den Bereich der Unternehmensführung, wo es um größtmögliche Profitabilität eines Unternehmens im Sinne seiner Bilanz und seines Börsenwertes geht, sondern auch für den Bereich immaterieller Werte. So werden auch zwischenmenschliche Beziehungen zunehmend von der mehr oder weniger bewusst gestellten Frage bestimmt: Rechnet sich das für mich? Stehen meine Investitionen in diese Beziehung in einem günstigen Verhältnis zu dem Gewinn, den ich daraus ziehe? Der Einwand, ein Abwägen von Vor- und Nachteilen im Sinne von Wert-Erwartungs-Theorien sei eine genuin menschliche Eigenart und daher nicht typisch für die Moderne, ist berechtigt. Kennzeichen der Moderne ist allerdings das Ausmaß, welches diese Haltung angenommen hat. Auch die Tendenz zu Professionalisierung und Expertentum kann man als Ausfluss der Ökonomisierung sehen. Begreiflicherweise möchte jeder die bestmögliche Dienstleistung für sein Geld erhalten, und die ist mit größter Wahrscheinlichkeit von Spezialisten zu bekommen.
(5) Reflexivität: Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gab es eine solche Verwobenheit von Individuum und globalisierter Gesellschaft wie heute. Nicht nur, dass die Menschen in einem bestimmten Land in einem bisher ungekannten Ausmaß Informationen über Vorgänge in anderen Teilen der Welt erhalten; innerhalb eines gegebenen Lebensraums wirken die Lebensäußerungen der Menschen auf die Angehörigen dieser Population zurück. Wenn eine Mutter sich, etwa im Rahmen einer Talkshow, im Fernsehen über die Erziehung ihrer Kinder äußert, hat dies Einfluss auf die Einstellungen der Zuschauer zur Kindererziehung. Wenn in allgemein verständlicher Form in Zeitungen über die Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschung (z. B. über die Wirkung von Unterrichtsmethoden in der Schule) berichtet wird, so kann dies das Verhalten von Lehrern, von Eltern (auch als Wähler) sowie von politischen Entscheidungsträgern beeinflussen.
Dieses neue Phänomen der heutigen Zeit wird von GIDDENS (1991; 1995) als »institutionelle Reflexivität« bezeichnet (siehe auch Walter 1994, S. 44 ff.). Das Selbst wird zum »reflexiven Projekt«, indem der Mensch sein Selbstbild durch reflexive Aneignung von Wissen ständig verändert. NESSEHI und WEBER (1989, S. 324) sprechen davon, dass der moderne Mensch »sich [seiner] selbst gleichsam ›selbstreferentiell‹, aus sich selbst heraus, vergewissern kann und muß.« Transmissionsriemen dieses Prozesses sind die modernen Informations- und Kommunikationskanäle, in erster Linie Fernsehen und Internet inklusive elektronischen Briefverkehrs (E-Mail). Durch diese Medien ist es möglich geworden, dass Katastrophen von weltweiter Bedeutung wie die Anschläge vom 11. September 2001, der Tsunami im Dezember 2004, das Erdbeben auf Haiti im Januar 2010 oder das Begräbnis eines Papstes von Menschen in allen Teilen der Erde unmittelbar miterlebt werden können. Die Übertragung öffentlicher Trauerbekundungen der Londoner Bevölkerung nach dem Tod von Prinzessin Diana dürften die Vorstellungen vom Trauern mindestens in weiten Teilen Europas beeinflusst haben.
In Abschnitt 1.2 haben wir das Konzept der Bindung eingeführt, um das Verhältnis des mittelalterlichen Menschen zu Gott und zur Welt zu kennzeichnen. Wenn wir dies hier aufgreifen und auch auf den Menschen der Moderne anwenden, können wir die Ausführungen dieses Abschnitts auf einen griffigen Nenner bringen. Der heutige Mensch hat eine schwache Bindung an Gott und eine enge und positive Bindung an sein eigenes Leben und dasjenige seiner Bezugspersonen. Dies kommt in den ersten beiden Merkmalen des modernen Weltbildes deutlich zum Ausdruck – die weiteren Kennzeichen sind Folge- bzw. Begleiterscheinungen. Verglichen mit dem traditionellen Weltbild haben sich die Verhältnisse also umgekehrt: Die früher enge und positive Bindung an Gott ist in der heutigen säkularisierten Welt einer losen Bindung gewichen, die früher schwache Bindung an das Leben hat einer engen Bindung mit einer entsprechend hohen Wertschätzung des Lebens Platz gemacht.