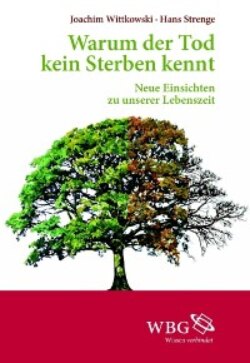Читать книгу Warum der Tod kein Sterben kennt - Joachim Wittkowski - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhaltsverzeichnis
ОглавлениеVorwort
Kapitel 1: Der kulturgeschichtliche Hintergrund von Sterben und Tod
J. Wittkowski und H. Strenge
1.1 Anthropologische Prämissen
1.2 Allgemeine Kennzeichen des mittelalterlichen Weltbildes
1.3 Traditionelle Orientierungen gegenüber Sterben und Tod
1.4 Allgemeine Kennzeichen des modernen Weltbildes
1.5 Umgang mit Sterben und Tod in der Moderne
1.6 Das Todessystem
1.7 Resümee
Literatur
Kapitel 2: Sterben – Ende ohne Anfang?
J. Wittkowski
2.1 Sterben und Tod in der aktuellen öffentlichen Diskussion
2.1.1 Gleichsetzung oder Verwechslung von »Sterben« und »Tod«
2.1.2 »Guter Tod« und »gutes Sterben«
2.1.3 Auswirkungen eines unscharfen Sterbebegriffs
2.2 Sterben aus traditioneller medizinischer Sicht
2.3 Sterben aus Sicht der Verhaltenswissenschaften und der Palliativmedizin
2.3.1 Aspekte des Sterbens
2.3.2 Fehlen einer Begriffsbestimmung des Sterbens
2.3.3 Implizite Kennzeichnungen des Sterbens
2.3.4 Explizite Definitionen des Sterbens
2.3.4.1 Explizite Definitionen verschiedener Provenienz
2.3.4.2 Explizite Definitionen aus dem Bereich der Soziologie
2.3.4.3 Resümee
2.4 Ein umfassender Begriff des Sterben
2.4.1 Die eigene Definition
2.4.2 Erläuterung der eigenen Definition
2.4.3 Wie man zum Sterbenden werden kann
2.5 Gültigkeitsbereich des psychologisch-verhaltenswissenschaftlichen Sterbebegriffs
2.5.1 Sterben aufgrund einer körperlichen Krankheit
2.5.2 Sterben infolge eines Unfalls oder einer Naturkatastrophe
2.5.3 Sterben infolge äußerer Gewalteinwirkung
2.5.4 Hinrichtung
2.5.5 Sterben durch eigene Hand
2.5.6 Sterben als Kleinkind/Plötzlicher Kindstod
2.5.7 Sterben im hohen Alter bzw. an Altersschwäche
2.6 Sterben – Ende mit Anfang!
2.7 Konsequenzen aus einem psychologisch-verhaltenswissenschaftlichen Konzept des Sterbens
2.7.1 Forschung
2.7.2 Begleitung und Betreuung Sterbender
2.7.3 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Betreuungspersonen
2.7.4 Entscheidungen auf politischer Ebene und Rechtsprechung
Literatur
Kapitel 3: Leben und Tod in den Zeiten der Organverpflanzung
H. Strenge
3.1 Einleitung
3.2 Das Konstrukt des Hirntodes
3.2.1 Klinische Kriterien
3.2.2 »Kritische« Kriterien
3.3 Der Hirntod und seine Erscheinung
3.3.1 Das klinische Bild: Schein der Lebendigkeit
3.3.2 Das emotionale Bild
3.3.3 Betreuung an der Nahtstelle: Der verordnete Statuswechsel
3.4 Todesdiagnostik und Interaktionen beim Organspendevorhaben in der Praxis
3.4.1 Die Diagnostik des Todeszeitpunkts
3.4.2 Interaktionen beim Transplantationsvorhaben
3.5 Schwangere Hirntote: Lebensspende einer Toten
3.6 Herztod und Organverpflanzung
3.6.1 Maßnahmen zur Unterstützung des medizinisch kontrollierten Sterbens
3.6.2 Interessenkonflikte vor kontrolliertem Herztod und Organspende
3.7 »Dead donor rule« und neue Aspekte
3.8 Der versprachlichte Tod: Linguistischer Lackmustest für Klarheit?
3.9 Unvereinbare Todesauffassungen
3.10 Sterben als letzter Lebensvollzug: Angewiesen auf Anerkennung durch andere?
3.11 Leben und Sterben: Neue Konzeptionen?
3.12 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Kapitel 4: Ethische Betrachtungen zur Hirntod-Problematik
W. Lenzen
4.1 Einleitung
4.2 Die »Minimalethik« des Neminem laedere
4.3 Epikurs Irrtum – oder: Wieso es doch schlimm ist, tot zu sein
4.4 Empfängnisverhütung und Abtreibung
4.5 Posthume Geburt
4.6 Ethische Probleme der Organtransplantation
4.6.1 Explizite Einwilligung oder fehlender Widerspruch?
4.6.2 Zur Problematik des Hirntodes
Literatur
Kapitel 5: Fragwürdiges zu Leben, Sterben und Tod. Psychologische, medizinische und philosophische Perspektiven
W. Lenzen, H. Strenge und J. Wittkowski
5.1 Allgemeine Aspekte
5.2 Leben
5.3 Sterben
5.4 Tod
5.5 Ethische Aspekte
Kapitel 6: Zeitgemäße Choreographien bei der Begegnung mit Leben und Tod
H. Strenge und J. Wittkowski
6.1 Der Staat als Lieferant kollektiver Sicherheit und die Endlichkeit des Lebens
6.2 Die Bedeutung der politischen Strukturen für die Wahrnehmung von Sterben und Tod
6.3 Der Einfluss deutungsmächtiger Interessengruppen auf die Kennzeichnung von Sterben und Tod
6.3.1 Der Tod und die leise Hintergrundaktivität der Gewebemedizin
6.3.2 Der Tod und die machtvolle Einflussnahme des Verwandtschaftssystems
6.3.3 Das Sterben in Hospizarbeit und Palliativmedizin
6.4 Fazit und Ausblick
Literatur
Register