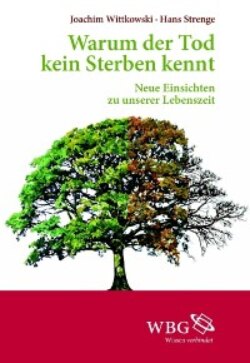Читать книгу Warum der Tod kein Sterben kennt - Joachim Wittkowski - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеDieses Buch hat eine lange Entstehungsgeschichte, in deren Verlauf es mehrfach sowohl Phasen des Stillstands als auch Abweichungen von dem zunächst eingeschlagenen Weg gab. Es begann auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Psychologie im Mai 1997 in Münster. Auf dem Gesellschaftsabend kamen wir – der Nervenarzt und Psychotherapeut Hans Strenge und der Psychologe Joachim Wittkowski, die bisher nicht miteinander bekannt waren – in ein ebenso angeregtes wie anregendes Gespräch über die psychologische Forschung zur Todesthematik im Allgemeinen und über die Entwicklung des Todeskonzepts beim Kind im Besonderen. Im Laufe dieses langen Abends zeigte sich, dass wir beide ein Faible für unorthodoxe Betrachtungsweisen, für den Aufweis von Widersprüchen und Paradoxien haben, und so kam die Frage auf, ob wir unsere Neigung zum produktiven Querdenken nicht zur Grundlage einer gemeinsamen Unternehmung machen sollten. Einer von uns (J. W.) hatte bereits seit geraumer Zeit ein Vortragsmanuskript über den Beginn und die Dauer des Sterbeprozesses aus psychologischer Sicht in der Schublade, das sich allein wegen seines Umfangs kaum für eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift eignete, jedoch den Grundstock für ein Kapitel in einem Sammelband abzugeben versprach. Angeregt durch dieses Vortragsmanuskript und durch langjährige Tätigkeit als neurologischer Konsiliarius in der Herzchirurgie und auf einer Intensivstation nahm der andere von uns (H. S.) die Arbeit an einem Kapitel über das Todeskonzept im Kontext von Organspende und Transplantationsmedizin auf. Die ersten Schritte waren getan.
Im Sommer 2003 sah das Konzept des Buches einen ersten psychologisch-verhaltenswissenschaftlichen Teil, einen zweiten medizinisch-neurologischen sowie einen dritten Hauptteil vor, wobei in letzterem diese beiden Perspektiven im Hinblick auf Berührungspunkte und Unvereinbarkeiten diskutiert werden sollten. Schon früh wurde uns klar, dass dieser Zuschnitt noch nicht genügend Substanz bot und einer Erweiterung bedurfte. Unsere naturgemäß jeweils einseitigen Sichtweisen erforderten eine Ergänzung oder mindestens eine kritische Kommentierung. Am geeignetsten erschien uns dafür der übergeordnete Blickwinkel der Philosophie, und so betrachten wir es als glückliche Fügung, dass wir den Osnabrücker Philosophen Wolfgang Lenzen als dritten Mann gewinnen konnten.
Damit gab es nun drei eigenständige Kapitel, die eine psychologisch-verhaltenswissenschaftliche Definition des Sterbeprozesses (Kapitel 2), den Tod im Kontext der Transplantationsmedizin (Kapitel 3) und die Frage des Wertes von Leben und Tod auf der Grundlage minimalethischer Postulate der Philosophie (Kapitel 4) behandelten. Diese Anordnung ergibt sich aus der sachlogischen Abfolge von Sterben und Tod sowie der ethisch-moralischen Bewertung von Leben und Tod. Zusätzlich wurde Kapitel 5 eingeführt, in dem wie bei einer Expertendiskussion mit Publikumsbeteiligung eine umfangreiche Sammlung von Fragen zu den Kapiteln 2 bis 4 generiert wurde. Nach fünf thematischen Abschnitten geordnet, wurden diese Fragen von den beteiligten Autoren schriftlich beantwortet. Einige dieser Fragen sind bewusst aus der Perspektive eines unbefangenen Lesers gestellt und können somit im positiven Sinne als »dumme Fragen« gelten. Andere Fragen sind rhetorischer oder auch pädagogischer Art – für den Experten erübrigt sich ihre Beantwortung, für manchen Leser ohne spezifische Vorkenntnisse mögen die Antworten hingegen ein Gewinn sein. Aufgrund dieser Aufteilung kann man die Lektüre des Buches auch mit Kapitel 5 beginnen, sind die darin enthaltenen Fragen und Antworten doch geeignet, Neugier auf das Werk als Ganzes wecken.
Das Anliegen dieses Buches besteht darin, die Fragwürdigkeit gängiger Denkmuster im Hinblick auf Sterben und Tod exemplarisch aufzuzeigen und neue, bisher nicht etablierte Sichtweisen auch jenseits (fach-)politischer Korrektheit einzuführen. Diesen Zweck versuchen wir dadurch zu erreichen, dass wir das Sterben als letzten Lebensabschnitt und das Totsein, d. h. den Verlust des Lebens und die medizinische Verwertung des Leichnams, in einer kritischen und unkonventionellen Weise aus den Blickwinkeln dreier Disziplinen beleuchten: der Psychologie, der Medizin und der Philosophie. Wir wenden uns damit nicht nur an Fachleute aus Medizin, Pflegewissenschaften, Rechtswissenschaft, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, an Haupt- und Ehrenamtliche in Hospizarbeit und Palliativversorgung sowie an politische Entscheidungsträger, sondern auch an eine breitere Öffentlichkeit sogenannter gebildeter Laien.
Bereits in der Frühphase der Arbeit erhielt das Projekt den Arbeitstitel Und wenn sie nicht gestorben sind … Vexierbilder des Todes. Der Haupttitel nimmt auf die abschließende Floskel vieler Märchen Bezug. Sie wird in den einzelnen Kapiteln in mannigfachen Variationen aufgegriffen, um neue und ungewohnte Sichtweisen nach Art eines Verfremdungseffekts hervorzuheben. Diesem Leitgedanken der spielerischen gedanklichen Brechung entspringt auch die Metapher des Vexierbildes im Untertitel. Wie bei einer Darstellung, in der man bei genauerem Hinsehen eine andere als die zunächst wahrgenommene Figur erkennen kann, werden dem Leser auf der Grundlage rationaler Analysen der jeweiligen Sachverhalte neue und oft überraschende Einsichten nahegebracht. Die Wahl des endgültigen Titels ist das Ergebnis eines längeren Diskussionsprozesses zwischen dem Verlag und den Autoren.
Mit dieser Konzeption können sich aus dem vorliegenden Buch Anstöße für ethische und empirisch-psychologische Forschung zur Situation des Menschen am Ende seines Lebens, für die Praxis der medizinischen und pflegerischen Betreuung Sterbender, für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Betreuungspersonen sowie Konsequenzen für Entscheidungen auf politischer Ebene (Gesetzgebung) und nicht zuletzt für die Rechtsprechung (Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht) ergeben. Über diese fachspezifischen Felder hinaus wünschen wir uns, dass das Buch einen Beitrag zur aktuellen Diskussion über ein zeitgemäßes Verständnis von Leben, Sterben und Tod leisten möge, die allen gesellschaftlichen Gruppierungen ein Anliegen ist.
Würzburg und Kiel, im Sommer 2010
Joachim Wittkowski
Hans Strenge