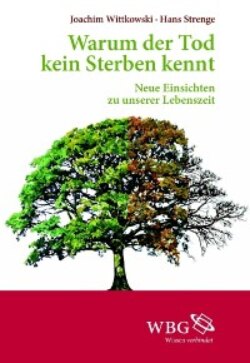Читать книгу Warum der Tod kein Sterben kennt - Joachim Wittkowski - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5 Umgang mit Sterben und Tod in der Moderne
ОглавлениеIn vielen Abhandlungen zur Todesthematik wird der Begriff »Tod« als Sammelbegriff gebraucht. Das hat zur Folge, dass der Leser im Unklaren gelassen wird, ob der Vorgang des Sterbens als letzter Abschnitt des Lebens, das Totsein oder der Umgang mit Toten gemeint ist. Oft lässt sich die zutreffende Bedeutung aus dem Kontext erschließen, zuweilen bleibt die Unklarheit erhalten. In Kapitel 2 wird auf die begriffliche Unschärfe im Kontext der Todesthematik und ihre Auswirkungen näher eingegangen. In diesem Abschnitt wollen wir versuchen, eine saubere Unterscheidung zwischen »Sterben« und »Tod« vorzunehmen, und erst das eine und danach das andere behandeln.
Im Zuge der Individualisierung ist das Sterben in der heutigen Zeit von einer mehr oder weniger öffentlichen Veranstaltung zur Privatangelegenheit geworden. Aus einer Angelegenheit der Gemeinschaft ist die Angelegenheit des Einzelnen geworden. Wurde es früher von den Familienangehörigen als rituelle Handlung inszeniert, findet heute – wenn überhaupt – eine Inszenierung durch den Sterbenden selbst oder allenfalls durch Betreuungspersonen im Hospiz statt (vgl. Gronemeyer 2007, S. 37). Eine Allgemeinverbindlichkeit dieses Rituals gibt es nicht mehr, jeder ist sein eigener Regisseur. Die Entfaltungsmöglichkeiten, die damit verbunden sind, können aber auch eine Art Leistungsdruck und Angst vor Versagen hervorrufen. Sterben steht nicht in einem als selbstverständlich erlebten, weil vorgefundenen Kontext, sondern es muss vom Einzelnen erst in einen Kontext eingefügt werden (Kastenbaum & Aisenberg 1972, S. 208). Ebenfalls anders als früher findet Sterben heute im Verborgenen statt: in spezialisierten Einrichtungen wie Krankenhaus, Pflegeheim, Hospizeinrichtung oder Palliativstation, die dem Wunsch des Sterbenden und seiner Angehörigen nach bestmöglicher Pflege und Betreuung entsprechen. Da Sterbende solchermaßen aus dem alltäglichen Leben ausgelagert sind, finden sie kaum Beachtung durch ihre Mitmenschen. Sterben ist somit kein authentischer Bestandteil des täglichen Lebens (ebd., S. 206). Dies kommt der »Schnelllebigkeit« der heutigen Zeit entgegen und dem Bedürfnis der Menschen, sich in ihren Aktivitäten nicht unterbrechen zu lassen.
Das heute vorherrschende Sterben im Verborgenen wurde gefördert durch die Vorstellung, es handele sich um einen schmutzigen und daher abstoßenden Vorgang, der anderen Personen als professionellen Pflegekräften nicht zumutbar sei. »Ein neues Bild des Todes [gemeint: Sterbens] ist im Entstehen begriffen: der gemeine und heimliche Tod, heimlich eben deshalb, weil er gemein und schmutzig ist« (Ariès 1980, S. 782). Hinzugesellt hat sich die Vorstellung vom Sterben als einem Zustand mit Krankheitswert (Gronemeyer 2007, S. 120). Wer krank ist, kann und muss behandelt werden; wer krank ist, kann prinzipiell gesund werden. Wir haben es hier mit einer kulturellen Definition des Sterbens zu tun (siehe auch Parker-Oliver 1999–2000). Die Medikalisierung des Sterbens, die mit dieser Auffassung einherging, führte dazu, mit Sterbenden nicht als solchen umzugehen, sondern sie wie Kranke zu behandeln, und das bedeutet, über rein medizinische Behandlungsmaßnahmen hinaus die entsprechenden Rollenerwartungen an sie zu richten. Hospizbewegung und Palliativmedizin haben dies in einem gewissen Umfang korrigiert. KASTENBAUM und AISENBERG (1972, S. 205 f.) machen darauf aufmerksam, dass wegen der erhöhten Lebenserwartung Sterben und Verlust mit dem hohen Alter assoziiert und so für die meisten (jüngeren) Menschen zu einer Bedrohung in der mehr oder weniger fernen Zukunft werden.
Neben Individualisierung und Auslagerung kommt Professionalisierung als weiteres Merkmal des zeitgemäßen Umgangs mit dem Sterben hinzu. Dies entspricht dem modernen Verständnis von Sterben als einem Problem, das es auf die gleiche Weise zu lösen gilt, wie unzählige andere Probleme auch: indem man es Fachleuten in ihren jeweiligen institutionalisierten Nischen überantwortet (Feldmann 1990, S. 146 ff.; Schneider 2005). Ob die gesellschaftliche Verdrängung des Sterbens Ursache oder Folge der Professionalisierung ist, sei dahingestellt. Professionalisierung zeigt sich im Wesentlichen in zwei Bereichen: Da ist zum einen die medizinische und pflegerische Versorgung sowie zum anderen die psychosoziale Betreuung durch Spezialkräfte von Hospizeinrichtungen und Palliativstationen, die vornehmlich auf die psychischen Bedürfnisse Sterbender eingehen. Als Nebeneffekt der Professionalisierung ist hier eine Pädagogisierung des Sterbens erkennbar. Behutsam wird dem Sterbenden vermittelt, wie er sich in seiner Rolle »richtig« zu verhalten habe, etwa indem er bestimmte Phasen durchläuft und Sterbebewusstheit – ein Leitkriterium des »guten Sterbens« – zu erkennen gibt. In beiden Bereichen handelt es sich um Problemlösung durch Kontrolle: Im einen Bereich in Form medizinisch-pflegerischen Verstehens, im anderen Bereich in Gestalt psychologischen Verständnisses und wohlmeinender pädagogischer Einflussnahme.
Zusammenfassend sind die wesentlichen Merkmale des gegenwärtigen Umgangs mit dem Sterben seine Individualisierung, seine Verheimlichung vor der Öffentlichkeit durch Auslagerung in spezielle Institutionen sowie seine Professionalisierung. Die Ursachen dafür sind auch in objektiven gesellschaftlichen Veränderungen zu sehen. »Der Rückzug religiöser Orientierungen, der Fortschritt der Medizin und die Auflösung der Familie haben das Lebensende völlig verändert« (Gronemeyer 2007, S. 19). ARIÈS (1980, S. 763) umschreibt dies als den »ins Gegenteil verkehrten Tod« und will damit den Gegensatz zum »gezähmten Tod« des Mittelalters deutlich machen. Die heutige Haltung gegenüber Sterben und Tod ist für ihn Ausdruck des »tiefsten Vertrauens in die Wirksamkeit der Technik und ihrer Umwandlung von Mensch und Natur«. Der Glaube an rationale Erkenntnis und Ingenieurwissenschaft versprach, die Natur zu ersetzen und mit ihr auch Sterben und Tod aus der Welt zu schaffen (vgl. auch Kastenbaum & Aisenberg 1972, S. 207 f.). Als übergeordnetes Kennzeichen des gegenwärtigen Umgangs mit dem Sterben sieht WALTER (1994, S. 42 u. 63) das Nebeneinanderbestehen traditioneller und moderner Elemente. Ob RESTS (2006) deutlich optimistischere Kennzeichnung der aktuellen gesellschaftlich-kulturellen Situation im Umgang mit Sterbenden mehr ist als ein persönlicher Eindruck aus der Subkultur der Hospizarbeit heraus, kann noch nicht beurteilt werden.
Die Entwicklung hin zur heutigen Einstellung gegenüber Sterben und Tod hat für ARIÈS (1980) auch viel mit dem Schwinden religiöser Überzeugung und speziell mit dem nachlassenden Glauben an die Existenz des Bösen zu tun. Indem man nicht mehr an Gott glaubte, gelang es zwar, das Böse abzuschaffen, nicht hingegen Sterben und Tod zu eliminieren. »Der Glaube an das Böse war notwendig gewesen, um den Tod zu zähmen. Die Abschaffung des Bösen hat den Tod in den Zustand der Wildheit zurückversetzt« (ebd., S. 789). Das damit verbundene Eingeständnis der Ohnmacht führte zum Schönreden des Sterbens und zum Verschweigen des Todes.
»Nicht die Verachtung des Todes, sondern seine Verbannung aus der Sphäre des Lebens nimmt man sich vor. Da der Tod einstweilen unausweichlich bleibt, soll wenigstens das Leben, solange es dauert, von ihm gereinigt und die schmähliche Erinnerung an ihn getilgt werden« (Gronemeyer 1993, S. 25; Hervorhebung im Original).
Die historisch einzigartige Situation der modernen Gesellschaft besteht darin, dass sie »den sinnhaft symbolischen Zugriff auf die Sinngebung des Todes, auf seine kommunikative Bewältigung und damit seine kulturelle Verstehbarkeit verloren« (Nassehi 1992, S. 13) hat. In ähnlicher Weise weisen GEHRING et al. (2007) darauf hin, dass der Tod im Gegensatz zu früheren Epochen keine Gestalt mehr habe. Die Gegenbewegung auf diese Sinnleere bestand bzw. besteht in einer »Humanisierung« des Todes durch individuelle Sinnverleihung. Psychologen und Soziologen »möchten festhalten an einem notwendigen Tod [einschließlich des Sterbens], der jedoch akzeptiert und nicht mehr schambesetzt sein soll« (Ariès 1980, S. 789).
Der Umgang mit Toten, d. h. die Bestattung und der Ausdruck von Trauer, weist in der heutigen Zeit die gleichen Merkmale auf wie der Umgang mit Sterbenden. Auch hier hat sich ein hohes Maß an Individualität eingestellt. Die Bestattung im Friedwald oder auf hoher See mit selbst geschaffenem Zeremoniell mögen als Hinweis genügen. Auch hier bestehen traditionelle Umgangsformen neben modernen Elementen, sodass es immer wieder zu deren Vermischung kommt. Familienangehörige können sich nach einem Todesfall in die Lage versetzt sehen, Einzelheiten der Begräbniszeremonie erst aushandeln zu müssen, insbesondere dann, wenn es sich um Personen unterschiedlicher Generationen handelt. Nach WALTER (1994, S. 175) wird in Gesten und vor allem in Worten auf das Leben und die Persönlichkeit des Verstorbenen eingegangen; das Ritual tritt demgegenüber in den Hintergrund.
Ein Verbergen der Trauer entspricht inzwischen der gesellschaftlichen Erwartung. Trauerkleidung wird kaum mehr getragen, schon gar nicht für die Dauer des Trauerjahres. Offenbar sind auch traditionelle Umgangsformen gegenüber Trauernden innerhalb weniger Generationen verloren gegangen. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts entstand »in den am meisten individualisierten und verbürgerlichten Teilen der westlichen Welt eine neue Situation. Die öffentliche Zurschaustellung der Trauer gilt als morbide, desgleichen ihr allzu beharrlicher und allzu langer privater Ausdruck. Die Tränenkrise wird zur Nervenkrise. Die Trauer ist eine Krankheit. Wer sie zeigt, legt eine Charakterschwäche an den Tag« (Ariès 1980, S. 742).
Auch Trauern unterliegt der Professionalisierung. Hospizeinrichtungen bieten Trauergruppen an und es gibt Ausbildungsgänge zum Trauerbegleiter, deren Anbieter im Bundesverband Trauerbegleitung (ehemals Bundesarbeitsgemeinschaft Trauerbegleitung) zusammengeschlossen sind. Die Vereinheitlichung der Ausbildung zum Trauerbegleiter dient dem Ziel, einen Mindeststandard an Qualität sicherzustellen. Handelt es sich bei den Leiterinnen und Leitern von Trauergruppen in der Regel um Personen, die diese Aufgabe ehrenamtlich wahrnehmen, so sind entsprechende Angebote von Bestattungsunternehme(r)n nur schwer von kommerziellen Interessen zu trennen.