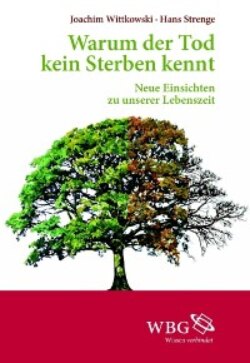Читать книгу Warum der Tod kein Sterben kennt - Joachim Wittkowski - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1: Der kulturgeschichtliche Hintergrund von Sterben und Tod
ОглавлениеJoachim Wittkowski und Hans Strenge
Ein Kind, dessen Verständnismöglichkeiten eine abstrakte Ebene erreicht haben, könnte sich angesichts der Unübersichtlichkeit dieser Welt auf die Suche nach unumstößlichen Gesetzen, nach ewigen Wahrheiten machen. Und in der Tat würde es fündig werden. Da gibt es das Fallgesetz: Ein Stein, der sich im erdnahen Raum über der Oberfläche befindet, fällt stets nach unten, niemals bleibt er in seiner Position oder steigt gar auf. Dann gibt es die ludolfsche Zahl Pi (3,141592…), die in alle Ewigkeit so bleiben wird. Und es gibt die Logarithmen, von denen man ebenfalls sagen kann, dass sie so bleiben werden, wie sie immer schon waren. Als das Arbeiten mit Logarithmen im Mathematikunterricht behandelt wurde, konnte unser Schüler die Logarithmentafel seiner Eltern verwenden, denn Logarithmus Sinus und Logarithmus Tangens hatten sich seit deren Schulzeit nicht verändert, mochte die Welt sich ansonsten auch noch so sehr gewandelt haben. Auch Einsichten über die Menschen, das Leben und die Welt werden seit vielen Generationen unverändert weitergegeben. Dies geschieht beispielsweise über die Alltagssprache durch die Weitergabe von Märchen. Hier erfahren schon kleine Kinder mit großer Regelmäßigkeit das immer gleiche Ende vom Schicksal der Menschen: »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.« Unser junger Zeitgenosse findet es Sicherheit vermittelnd und daher beruhigend, dass in einer unübersichtlichen Welt wenigstens einige Dinge unverrückbar fest stehen.
Man mag über diese Suche nach Konstanten und unumstößlicher Wahrheit lächeln. Entspricht sie nicht der naiven Sicht des Kindes, das noch keinen vertieften Einblick in das Funktionieren der Welt genommen hat? Vielleicht doch nicht ganz. Ist der eigentliche Beweggrund womöglich das Streben des jungen Menschen nach Sicherheit in einer Welt, die er als zutiefst verunsichernd erlebt? Vielleicht schon eher. Wie dem auch sei: Immerhin befindet sich derjenige, der sich einen kindlich-naiven Blick auf die Dinge bewahrt hat, in guter Gesellschaft. Große Geister haben viel Mühe darauf verwandt, die Existenz Gottes verstandesmäßig in der Art naturwissenschaftlicher Beweisführung darzulegen. Man wollte jeden Zweifel ausschließen können; es sollte absolut wahr sein, dass es Gott gibt. Heute ist unstrittig, dass man einen solchen Beweis nicht führen kann. Glaube ist eben Glaube und unterscheidet sich gerade in der Ungewissheit, die ihm innewohnt, vom Wissen. Andere bedeutende Denker haben versucht, nicht mehr hintergehbare Grundsätze der Ethik aufzustellen. Dieses Bemühen kann man als den Versuch interpretieren, eine Beliebigkeit der Argumentation, die sich durch unterschiedliche Grundsatzpositionen zu ethischen Fragen leicht einstellt, auf ein Minimum zu reduzieren, wenn nicht gänzlich auszuschließen.
Nun leuchtet es unmittelbar ein, dass Mehrdeutigkeiten und Interpretationsspielräume dort besonders zahlreich und groß sind, wo es um abstrakte Sachverhalte und »weiche« Erkenntnisgegenstände geht. Die wenigen Beispiele, die oben angeführt wurden, verdeutlichen dies. Darüber, was moralisch richtig ist, lässt sich lange streiten; dass der Stein nach unten fällt, sieht man sogleich, und auch Hunderte von Wiederholungen bringen kein anderes Resultat. Die »harten« Sachverhalte der physikalischen Welt eignen sich besonders gut für die Formulierung unumstößlicher Gesetze. Man sollte denken, dass auch Leben und Tod in diese Kategorie der harten Sachverhalte fallen, denn es handelt sich um Naturgeschehen. Die Vorgänge in einem lebenden Organismus sind gut erforscht, die Verfallsprozesse in einem toten Organismus ebenso. Von daher sollte die Lage eindeutig sein, und der Leser könnte das Buch zuklappen. Sieht und hört man sich jedoch um, was in der Gesellschaft im Allgemeinen und in einzelnen Fachwissenschaften im Besonderen zu Sterben und Tod gesagt wird, so ergibt sich ein anderes Bild. Wann jemand ein Sterbender ist und wann der Prozess des Sterbens beginnt, erscheint recht unklar – schlimmer noch, als unterschiedliche Positionen dazu sind, ist, dass es überhaupt keine explizite Definition des Sterbevorgangs gibt. Wie kann das möglich sein? Was das Totsein betrifft, gibt es zwar einigermaßen klare Begriffsbestimmungen, die jedoch sehr unterschiedlich sind. Welche ist nun die richtige? Und wenn von Sterben und Tod die Rede ist, geht es zwangsläufig auch immer um das Leben, genauer um den letzten Abschnitt des Lebens. Gibt es »richtige« ethische Grundsätze für den Umgang mit Menschen in der letzten Lebensphase – den Umgang des Sterbenden mit sich selbst wie auch den Umgang anderer mit dem Sterbenden? Gibt es solche ethischen Grundsätze für den Umgang mit Verstorbenen?
In diesem einführenden Kapitel soll die kulturgeschichtliche Grundlage für die Erörterungen der Kapitel 2 bis 4 geschaffen werden, die in der zusammenfassenden Bewertung des Kapitels 6 wieder aufgegriffen wird. Der Leitgedanke ist, dass der Umgang des Menschen mit Sterben und Tod wesentlich durch die Lebensumstände der jeweiligen Zeit bestimmt ist. Ungereimtheiten und Widersprüche in den heutigen Vorstellungen von Sterben und Tod, wie sie in den Kapiteln 2 bis 4 ausgeführt werden, kann man daher nur angemessen verstehen, wenn man weiß, wie sich unsere heutigen Lebensbedingungen entwickelt haben und wie sie sich von jenen früherer Zeiten unterscheiden. Ein Blick in die Kulturgeschichte des Abendlandes zeigt, dass sich das Verhältnis der Menschen zu Sterben und Tod vom Mittelalter bis in unsere Tage erheblich verändert hat. Dies kann hier nicht ausführlich nachgezeichnet werden. Für unsere Zwecke ist es ausreichend, eine grobe Skizze der kulturhistorischen Entwicklung der Einstellungen zu Sterben und Tod dadurch zu geben, dass die traditionelle Einstellung des Mittelalters der Einstellung der sogenannten Moderne gegenübergestellt wird.
Im Folgenden werden zunächst allgemeine Merkmale des traditionellen Weltbildes beschrieben. Daraus ergeben sich die traditionellen Orientierungen des Menschen im Mittelalter gegenüber Sterben und Tod. Sodann geht es um eine allgemeine Kennzeichnung der heutigen Lebensverhältnisse, aus der sich der spezifische Umgang mit Sterben und Tod für den Menschen der Moderne ableiten lässt. Darüber hinaus wird das Konzept des Todessystems eingeführt und erläutert. Einige zusammenfassende und ergänzende Bemerkungen schließen dieses einführende Kapitel ab.