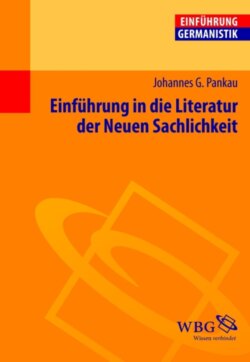Читать книгу Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit - Johannes Pankau - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Metropolenkultur: Berlin
ОглавлениеIm heutigen Bewusstsein sind die Kultur der Weimarer Republik und insbesondere die Neue Sachlichkeit fast untrennbar mit der Metropole Berlin verbunden. Die roaring twenties erscheinen im medial klischierten Bild, das durch Filme wie Cabaret geprägt wurde, als zügellos und wild, ein, wie Hans Mayer sarkastisch meinte, „sonderbares Berliner Schwabing, das etwa vom Nollendorfplatz reichte bis zum Grunewald“ (Mayer 1985, 245). Zutreffend sind diese Bilder nur in begrenztem Umfang. Dies gilt auch für die Zentrierung auf die Reichshauptstadt: Formen neusachlichen Schreibens gab es auch in anderen Großstädten (München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden), in Österreich (etwa Rudolf Brunngraber), in besonderem Maße aber im Industrieareal des Ruhrgebiets. Auch wenn also die Fixierung auf Berlin in ihrer extremen Form zu Blickverengungen führt, so ist dennoch die Bedeutung der deutschen und europäischen Metropole für die Entstehung der Kultur der Weimarer Zeit und auch speziell für die Literatur der Neuen Sachlichkeit nicht zu übersehen. Nicht nur war hier das Verlags- und Pressewesen konzentriert, entwickelten sich die neuen Medien Film und Radio, insgesamt eine florierende Unterhaltungsindustrie, entfaltete sich eine ausdifferenzierte Angestelltenkultur, alle Widersprüche und Verwerfungen der Zeit zeigten sich hier besonders schnell und deutlich. Damit entstand eine Dynamik, die produktive Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Sparten entstehen ließ und selbst zum Sujet für die verschiedenen Genres und Gattungen wurde. Alfred Döblin, der von 1919 bis 1931 eine Kassenpraxis an der vom Alexanderplatz abgehenden Frankfurter Allee 340 betrieb, schrieb im Geleitwort zum Bildband Berlin 1928. Das Gesicht der Stadt (1928) des Fotografen Mario von Bucovich:
Es ist wahrhaft eine moderne Stadt, eine großartige Stadt, eine Siedlung heutiger Menschen. Die Straßen mäßig beleuchtet, man fliegt von Bahnhof zu Bahnhof, man ist schon längst im Stadtbereich Berlin, aber noch immer gliedert sich nichts, nur neue Straßen, […] da ein helles Licht, das muß ein Kino sein, plötzliche Lichtwirbel, aber wie belanglos in diesem Dunkel, auf den Bahnhöfen nüchterne eilige Menschen und wieder Straßenzüge, Mietskasernen, Schornsteine, Brücken. (Döblin 1992, 6)
Das Wachsen Berlins zu einer mit den traditionellen europäischen Hauptstädten Paris und London konkurrenzfähigen Metropole begann bereits im späten 19. Jahrhundert, verstärkt dann in den Jahren nach der Jahrhundertwende bis zum Beginn des Krieges. „Alles wirklich Umstürzende war schon im späten Kaiserreich angelegt gewesen, wenn auch der Monarch selber solche Neuerungen verabscheute.“ (Siedler 2000, 12) Solche Impulse sind gemeint, oder wenn zeitgenössische Beobachter in der Rückschau von den goldenen 20er Jahren sprechen, wenn etwa der bekannte Berliner Journalist Walther Kiaulehn in seinem 1958 erstmals erschienenen Buch Berlin. Schicksal einer Weltstadt zweifellos übertreibend „fünf sorglose Jahre“ (Kiaulehn 1980, 532) nennt, in denen sich die Stadt als Metropole frei entwickeln konnte: „Nie war die Stadt größer, reicher, bunter, glitzernder als damals, niemals hat sie ihren Kindern mehr gehört als in dieser kurzen Zeit!“ (Kiaulehn 1980, 532)
Zur Weltstadt und Kulturmetropole hatte sich Berlin in großem Tempo, wenn auch immer wieder kurzzeitig unterbrochen von ökonomischen Krisen durch die Überhitzung der Konjunktur) seit der Reichsgründung 1870 / 71, entwickelt. Ökonomischer turnoff, damit verbunden die rapide Bevölkerungszunahme und Konzentration in neuen Stadtteilen und angrenzenden Kleinstädten, die Einführung neuer Kommunikationstechnologien (Telefon, Telegraphie, moderne Druck- und Distributionsverfahren der Massenpresse, schließlich Film) und die fortschreitende Industrialisierung und Kommerzialisierung bewirkten tiefe gesellschaftliche Umschichtungsprozesse, die zum Wachsen einer luxurierenden Erwerbsschicht, aber auch zu Wohnraumnot und sozialen Notständen (Gesundheitsversorgung etc.) führten. Die Modernisierungswelle im Anschluss an den Sieg im deutsch-französischen Krieg (1870 / 71) und die Reichsgründung wälzte – verstärkt seit der Jahrhundertwende – alle Bereiche des öffentlichen wie privaten Lebens um. Aus der hauptsächlich durch das Militär und seine Repräsentationsbedürfnisse geprägten Hohenzollernmetropole wurde eine Weltstadt modernen Zuschnitts. Bereits um 1910 hatte Berlin mit europäischen Metropolen wie Paris oder London annähernd gleichgezogen, es war zum Schauplatz tief greifender Modernisierungsprozesse geworden: im Verkehrswesen, in der Industrieproduktion, in der Konglomeration von Bevölkerungsmassen, in der Durchsetzung der neuen Unterhaltungs- und Kommunikationsmedien, auch in den hochkulturellen Sphären der Wissenschaft und der Künste. Berlin, im Jahre 1877 zur Millionenstadt avanciert, überschritt schon 1905 die 2-Millionen-Einwohnergrenze, näherte sich dann, nach einem temporären Bevölkerungsabfall infolge der Kriegsereignisse, 1920 der Zahl von 4 Millionen Einwohnern, was als Hauptursache die vielen Eingemeindungen hatte: Großberlin entstand (vgl. Vietta 2001, 17; Siedler 2000, 15). Schon kurz nach 1900 avancierte Berlin auch zur Stadt der literarischen und künstlerischen Avantgarden, wurde es Szenerie neuer Geselligkeits- und Unterhaltungsformen, trafen sich in den Clubs, Cafés und Kneipen die Literaten aus dem Umkreis des Expressionismus und der Boh›me, frequentierte ein vielfältiger werdendes Publikum die Kinopaläste und Varietétheater. Insgesamt gab es zur Jahrhundertwende in der Hauptstadt ca. 80 Unterhaltungs-, Revue- und Musiktheater. Ein neues städtisches Zentrum entstand im Berliner Westen zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den Gegenden um den Kurfürstendamm in Charlottenburg und in Wilmersdorf – Wohn-, Arbeits- und Erholungsquartiere für das wohlhabende Bürgertum –, in den 1920er Jahren setzte sich diese Entwicklung fort. Die erste Berliner U-Bahnlinie wurde 1902 eröffnet, schon seit 1881 gab es eine elektrisch betriebene Straßenbahn, die nach und nach die frühere Pferdebahn gänzlich ersetzte. Berlin hatte zehn Fernbahnhöfe als Knotenpunkte. All dies hatte jedoch auch eine Kehrseite, die von der offiziellen Fortschrittsgläubigkeit verdeckt wurde: Jetzt entstanden viele der typischen Mietskasernen in den proletarischen Stadtteilen. Die glitzernde Nachtszene an der Friedrichstraße hatte ebenfalls ihre Schattenseiten, etwa 20.000 Prostituierte lebten bereits um 1900 unter meist erbärmlichen Bedingungen in der Stadt. Die Geschichte des Metropolenberlins ist auch eine der Armut und Ausbeutung.