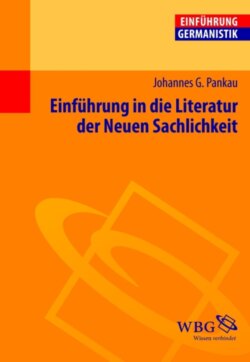Читать книгу Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit - Johannes Pankau - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII. Historische, politische und kulturelle Kontexte
1. Stabilisierung und Krise als Hintergrund neusachlicher Diskurse
Zwei kollektive Bilder der Weimarer Republik sind im Bewusstsein der Nachwelt vorherrschend: Zum einen das Bild der roaring twenties, einer äußerst lebendigen und dynamischen Gesellschaft, die eine Blüte der Kultur ebenso erlaubte wie individuell ausgelebte permissive Lebensstile. Zum anderen das einer krisengeschüttelten Republik, die, durch die Revolutionswirren direkt nach dem verlorenen Krieg hindurch, nach Inflation und Not, unterbrochen nur von einer kurzen Phase relativer Stabilität, in die fundamentale Wirtschaftskrise und schließlich in den Abgrund des Faschismus taumelt. Krise und Krisendiskurs scheinen so allgegenwärtig, dass darüber heute manchmal die Formen alltäglicher Normalität fast aus dem Blick geraten: „Jedenfalls wäre es verfehlt, von der Krisenrhetorik der Kulturpessimisten auf der einen und der radikalen Linken auf der anderen Seite und von den Aufgeregtheiten der akademischen Deutungselite auf die Einstellung der Bevölkerungsmehrheit zu schließen.“ (Hardtwig 2007, 7) Die allgemeine Krisenhaftigkeit strahlt besonders auf die Literatur aus, die in der Weimarer Republik zu großen Teilen Zeit-Literatur ist, so dass ein Buch über den Roman der Neuen Sachlichkeit den Titel tragen kann: Leben in der Krise (Lindner 1994).
Auch die zeitgenössische Literaturkritik ist vielfach bestimmt vom Krisendiskurs, dies besonders nach dem Einsetzen der weltweiten ökonomischen Krise und der für die späte Weimarer Republik charakteristischen radikalisierten politischen Auseinandersetzungen um den Ersten Weltkrieg als ,Urkatastrophe‘ des 20. Jahrhunderts (George F. Kennan, vgl. Mommsen 2002). Im 1931 von Oscar Müller herausgegebenen und mit einem Vorwort von Reichskanzler Heinrich Brüning versehenen Sammelband Crisis beklagt etwa der christlich-konservative Autor Detmar Heinrich Sarnetzki die politische, religiöse und künstlerische Krise der Zeit, die zur Frage führt, wie das Bürgertum zu neuer Orientierung finden könne, wenn „alle Spielarten, die sich in kurzer Folge ablösen und dennoch nebeneinander herlaufen, es bedrängen: Naturalismus, neue Romantik, Expressionismus, neue Sachlichkeit; das Tendenzwerk, die aktuelle Reportage!“ (Sarnetzki 1932, 311) Der Erste Weltkrieg, der Untergang der Monarchie, die tiefgreifenden Veränderungen der Sozialstruktur und Rollenverteilung (Angestellte, Neue Frau, Metropolisierung, Medienentwicklung) haben zwar partiell zu neuen Möglichkeiten, zum Abbau rigider patriarchalischer Strukturen und Obrigkeitshörigkeit, zu größeren Freiheiten des Einzelnen, etwa im Bereich von Ehe, Familie und Sexualität, geführt, sie ließen aber auch kollektive Zustände der Verunsicherung aufkommen, die die mentalitätsgeschichtliche Grundlage der Weimarer Republik bis zu ihrem Ende bildeten (vgl. dazu Fähnders 1998, 210ff.; Weyergraf 1995, 9). Die Krisenerfahrung kommt auch in den berühmten zeitdiagnostischen Werken der Zeit zum Ausdruck, nicht zuletzt in Karl Jaspers’ Die geistige Situation der Zeit (1931) oder in Helmuth Plessners Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus (1924), einem Buch, das – für die Formierung der Neuen Sachlichkeit bedeutsam – aus der Annahme einer Zivilisationskrise die Wendung gegen das in Deutschland verbreitete Denken in Gemeinschaftskategorien ableitet und stattdessen zu einer ,sachlichen‘ Verhaltenslehre gelangt (vgl. Lethen 1994, 75ff.; Kimmich 2002). Als in der Weimarer Republik die ökonomische, kulturelle und mediale Moderne – aller Retardierungen und Behinderungen zum Trotz – endgültig zum Durchbruch kommt, zeigen sich die Reaktionen darauf als Irritation breiter Bevölkerungskreise, die in Literatur und Medien reflektiert werden (vgl. Hoeres 2008, 8; Kyora/ Neuhaus 2006, 10; Peukert 1987).
Das Krisenparadigma bildete in der Frühphase der Forschung weitgehend auch die Grundlage für die Herleitung der Neuen Sachlichkeit. Als Prämisse diente dabei die Annahme, dass durch die Modernisierung der Gesellschaft auf allen Ebenen zusätzlich zu den Kriegsfolgen Anpassungsleistungen erforderlich wurden, für die gerade Kunst und Kultur sorgten. Die wichtigsten Modernisierungsphänomene der Zeit waren sicherlich die Einführung neuer Formen sozialer Schichtung und Arbeitsorganisation (Fordismus, Fließband, Taylorisierung), die Expansion der technischen Apparaturen und wissenschaftlichen Entdeckungen, die in der Produktion wie in der Distribution und im Verkehrswesen zu bisher nicht geahnten Neuentwicklungen führten (Kaufhauskonzerne, Automobil-, Bahn- und Flugwesen), die Ausbreitung und Perfektionierung der modernen Medien (Presse, Verlagswesen, Film, Radio), die immer deutlicheren Interdependenzen der einzelnen Medien in Produktion, Marketing und Streuung brachten, die weitergehende Verstädterung und Metropolenbildung, eine sich vor allem in den Städten ausbreitende ausdifferenzierte Unterhaltungskultur und nicht zuletzt die veränderte Stellung der Frauen.
Bei dieser Aufzählung darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Kräfte des Überkommenen, des Konservatismus und der Reaktion, in der Weimarer Zeit in je nach Phase unterschiedlicher Weise präsent waren und einen starken Gegenpol zu den genannten progressiven Tendenzen bildeten. Dies manifestierte sich etwa in den Versuchen der frühen Freikorps-Verbände zu einer Revision der Kriegsergebnisse, dem völkisch-frühfaschistischen roll-back mit stark antisemitischen Bestrebungen, im Kampf der klerikalkonservativen Gruppen gegen jede Liberalisierung des Strafrechts, der Wendung gegen den Amerikanismus, der angeblich die nachwilhelminische deutsche Gesellschaft überschwemmt habe, und der Ablehnung der Frauenemanzipation. Zugleich gerät die traditionsgebundene, dem Bildungsbürgertum verpflichtete Hochliteratur immer stärker in die Defensive, durch die immer schärfer werdende Konkurrenz der neuen Medien, aber auch durch den Aufschwung einer medienaffinen Unterhaltungs- und Reportageliteratur.
Die Annahme eines grundsätzlichen Einverständnisses der Neuen Sachlichkeit mit der kapitalistischen Modernisierung in einem Krisenbewältigungsdiskurs (Lethen) ist selbstverständlich verkürzt, denn gerade die neusachliche Literatur enthält starke sozialkritische Elemente und zeigt die Charaktere in ihrer Rat- und Orientierungslosigkeit. Bezüglich der Relation zu krisenhaften wie stabilisierenden Elementen kann für die Literatur summarisch festgestellt werden:
Das zentral positionierte Personal in neusachlichen Narrationen und partiell auch in den Dramen oder den lyrischen Ichs der Gedichte entspricht weitgehend dem neusachlichen Prototyp. Beispiele dafür sind der angepasste, zugleich aber verunsicherte und nach Perspektiven suchende, von sozialer Deklassierung bedrohte Typus des Angestellten (oft mit akademischer Bildung und Journalist, Werbetexter etc.), wie er bei Kästner, Tergit u.a. gezeigt wird. Bei den weiblichen Protagonisten ist es die karriereorientierte, gut ausgebildete, im persönlichen Habitus freizügige Neue Frau, wie sie Cornelia Battenberg in Fabian repräsentiert, oder die ,Girlie‘-Figur, wie sie Baum in Flämmchen (Menschen im Hotel) gestaltet. Besonders augenfällig sind die Charaktere Keuns, die von ihrem Aufgehen in den Warenversprechungen der Zeit träumen. Die für den Roman charakteristischen Liebeskonflikte werden ebenfalls partiell versachlicht, indem prononciert untragische, entromantisierte Konfliktlösungen oder Romanschlüsse angeboten werden. Dies trotz der Vorliebe für melodramatische Effekte: So wird die große Oper in Menschen im Hotel von zwei eigentlich nicht in die Moderne passenden Figuren durchgespielt, von der Tänzerin Grusinskaya und dem Baron von Gaigern.
Als Erklärungsmodell für Verhaltensweisen der Figuren werden weniger psychologische, innengelagerte Prozesse angenommen als Reaktionsbildungen im Konflikt mit der Außenwelt (Externalisierung). Stark aktiviert ist die epische Beobachterfunktion, die sich weitgehend auf das Äußere, Gegenständliche beschränkt.
Die Formen des Amerikanismus, der Technikbegeisterung, der Vorliebe für Zahlen und Rationalisierungsprozesse erscheinen im Einsatz von Musik, kühl-sachlicher Redeweise und dezidiert antiromantischer Attitüde, besonders auch im Tanz und in gesteuerten Bewegungsabläufen sowie in der Relation zum eigenen Körper.
Die expandierende Unterhaltungskultur bildet das Setting und das Ambiente vieler neusachlicher Texte: Kaffeehaus, Kino, Revue, Tanzpalast, Büros und teilweise auch Fabriken sind die Orte, an denen die Lebenspraxis und die Beziehungskonstellationen bevorzugt stattfinden.
Lebensperspektiven und -alternativen werden in den Angeboten der vorhandenen Kultur und Gesellschaft gesucht, kaum in existentieller Reflexion oder Metaphysik.
Die Gattungen werden entsprechend diesen Vorgaben modifiziert. Es finden sich Innovationen im Drama und im Roman, wie etwa Zeitstück und -roman, die sich den journalistischen Formen annähern. Erstmals entsteht in größerem Ausmaß, nach den naturalistischen Vorformen, eine realistische Fabrik- und Büroprosa und die narrative Vergegenwärtigung des Krieges in einem eigenen Genre.
Durch die Betonung des Gebrauchswertcharakters des Literarischen wird die Möglichkeit individueller Aktivierung und Operationalisierung in den Vordergrund gerückt. Das Versprechen neusachlicher Literatur liegt in der objektiven Schilderung persönlich erfahrbarer Zustände und deren Bewältigung, nicht in revolutionär-verändernder Aktion, sondern eher in einem wehmütig hingenommenen Abfindungsprozess, beispielhaft in der Lyrik Mascha Kalékos.