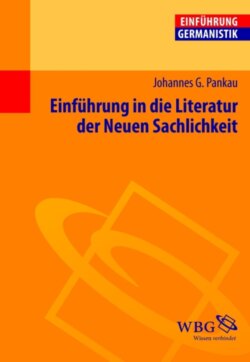Читать книгу Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit - Johannes Pankau - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Die Neue Frau
ОглавлениеIm Jahre 1929 reiste Lady Grace Drummond-Hay als einzige Frau im Luftschiff „Graf Zeppelin“ um die Welt, gesponsert vom New Yorker Pressezar Randolph Hearst, für dessen Zeitungen sie von der abenteuerlichen Fahrt berichtete, in einem Film der niederländischen Filmemacherin Ditteke Mensink von 2009 mit dem Titel 1929: Mit dem Zeppelin um die Welt wird dies dokumentiert. Diese Reise und ihre massenmediale Verarbeitung hat Symbolwert: Das Bild des Weiblichen ist hier mit der modernen Realität synchronisiert, es erscheint im Schnittpunkt von Reisen – Tempo, Geschwindigkeit, Abenteuer, Medien und Aktivität. War um die Jahrhundertwende das kollektive Bild der Frau vor allem von femme fatale- und femme fragile-Projektionen bestimmt gewesen – von der sexuell bedrohlichen wie naiv-elementaren Frau – so gewinnt jetzt ein modernisiertes Bild mit entsprechenden Attributen und Verhaltensformen Raum. Ein anderes Beispiel: 1927 tritt die Industriellentochter und Rennfahrerin Clärelore Stinnes eine Fahrt um die Welt mit dem Auto an. Im Juni 1929 kehrt sie mit ihrem Begleiter nach Berlin zurück, dreht mit diesem zusammen einen Dokumentarfilm, 1929 erscheint das Reisebuch Im Auto durch zwei Welten in Berlin (Neuausg. Wien 1996). Ein berühmtes Geschwisterpaar der Zeit unternahm 1927 ebenfalls eine Weltreise, die zu einem Buch verarbeitet wurde, Erika und Klaus Mann, die 1929 den Bericht Unterwegs. Abenteuer einer Weltreise publizierten. Maria Leitner, wie Vicki Baum Mitarbeiterin des Ullstein-Konzerns, wurde 1925 von diesem auf große Amerika-Fahrt geschickt und fasste ihre Reisereportagen 1932 in dem Sammelband Eine Frau reist durch die Welt zusammen.
Das individuelle und Neuland entdeckende Reisen – bislang eine Domäne der Männer und weithin als unweiblich betrachtet – wurde nun zunehmend zu einer Unternehmung, bei der sich auch junge, körperlich durchtrainierte, technisch versierte und sexuell wie beruflich emanzipierte Frauen entfalten konnten. Obwohl es diese wagemutigen Frauen real gab – die Fliegerin Elly Beinhorn wie die Schauspielerin und Bergfilmerin Leni Riefenstahl –, so ist das Bild der Neuen Frau, das hier seine Verkörperung findet, doch vor allem ein medial konstruiertes Wunschbild. Es bestimmt vor allem die neusachliche Literatur: Dort begegnen uns – als Produzentinnen wie als Figuren – Frauen in Bewegung, die sich von den alten Rollenvorstellungen jedenfalls teilweise gelöst haben und, vor allem im persönlichen Lebenszuschnitt, neues Terrain erproben. Irmgard Keuns kunstseidenes Mädchen, Irene Moll aus Kästners Fabian oder stud. chem. Helene Willfüer in Vicki Baums gleichnamigem Roman sind alle Frauen, die sich in der nach wie vor männlich-hierarchisch bestimmten Berufs- und Wissenschaftswelt durchzusetzen versuchten. Und es taucht sogleich eine Reihe von prominenten Namen auf: Marieluise Fleißer, Vicki Baum, Irmgard Keun, Gabriele Tergit, Mascha Kaléko und Gina Kaus, um nur einige der heute noch bekannten Namen zu erwähnen (vgl. Fähnders/Karrenbrock 2003). Fällt es beim Expressionismus noch schwer, außer Else Lasker-Schüler eine andere Repräsentantin namhaft zu machen, obwohl es natürlich weitere schreibende Frauen gab, bietet die Literatur der Neuen Sachlichkeit Autorinnen bisher ungekannte Möglichkeiten der Entfaltung.
Das Bewegungsmoment ist deshalb von so großer Bedeutung, weil es sich real wie symbolisch mit dem Großstadtmilieu verbindet, in dem die genannten und viele andere neusachliche Autorinnen arbeiteten (vgl. Becker 2003, 193ff.) Auch Marieluise Fleißer, die in ihren Werken gerade die selbst gemachte Erfahrung von provinzieller Unterdrückung thematisiert, lebte lange in großen Städten, zunächst in München, dann in Berlin, und arbeitete im engen Kontakt zur großstädtischen Literaten- und Theaterszene (vgl. Häntzschel 2007). Nicht nur ,Tippfräuleins‘ wurden bei den expandierenden Verlagen und Journalen gesucht, man benötigte journalistisch schreibendes weibliches Personal, da sich auch die Rezipientengruppen zunehmend ,verweiblichten‘ und eigene Genres für Leserinnen entstanden. Im Bereich der Literatur – und vor allem im neusachlichen Kontext – war der Übergang von der journalistischen zur im engeren Sinne literarischen Tätigkeit nun leichter möglich. Eine Gruppe jüngerer hoch gebildeter Frauen, meist aus ärmeren Mittelschichten, die ihre Lebensperspektive nicht mehr primär auf Ehe und Familie abstellten, trat ins Berufsleben.
Im Kontext von neusachlicher Literatur und kulturellen Imaginationen der Neuen Frau bzw. des ,Girl‘-Typus sind folgende Aspekte wesentlich:
Unterschieden werden muss zwischen der Realsituation von Frauen und den literarisierten oder medialisierten Bildern. Obwohl sich etwa aus den Sekretärinnen-Romanen wichtige Aufschlüsse über Arbeitsbedingungen und Autoritätsverhältnisse im Bürobetrieb gewinnen lassen und die Autorinnen meist eine fundierte Kenntnis über diese Abläufe besitzen, sind die Darstellungen trotzdem nicht als naturalistisches Abbild zu verstehen.
Die gewohnten, von Beginn plakativen Begrifflichkeiten (Neue Frau, Girl) sind inzwischen in einer Weise klischiert, die sie für analytische Zwecke kaum mehr brauchbar erscheinen lassen. Zumindest muss zwischen verschiedenen Bedeutungsschichten und Verwendungszusammenhängen jeweils differenziert werden.
Die kulturellen und im direkten Sinne literarisch-poetologischen Bereiche sind zwar vielfältig verknüpft, dennoch müssen diese Sphären auch in ihrer Eigenständigkeit berücksichtigt werden, also in der medialen Spezifik von literarisch-narrativen und filmischen Repräsentanzen der Neuen Frau.
Eine vereindeutigende Festlegung von literarischen Weiblichkeitstypen muss immer scheitern, dies nicht nur beim Vergleich konservativer (Gabriele Reuter, Rahel Sanzara, Ina Seidel, Clara Viebig, Elisabeth Langgässer u.a.) mit modern-neusachlichen Autorinnen, sondern auch immanent, etwa in den Romanen von Vicki Baum. Die Popularität harmonistisch-patriarchaler Frauenbilder ist bei weiten Leserschichten ungebrochen, was etwa die Verkaufszahlen der Romane von Autorinnen wie Hedwig Courths-Mahler anzeigen (vgl. Becker 2003, 195ff.).
Bei der Darstellung des neuen Weiblichen ist zwischen dem Zugang von weiblichen und männlichen Autoren deutlich zu unterschieden, ohne dass Unterschiede im thematisch-inhaltlichen wie literarisch-ästhetischen Zugriff jeweils mit der Geschlechtszugehörigkeit identifiziert werden könnten. Inwieweit von einer „spezifisch weiblichen Ästhetik“ (Becker 2003, 188) oder gar einer „weiblichen neusachlichen Avantgarde“ (ebd., 199) wirklich gesprochen werden kann, wie Sabina Becker behauptet, muss weiteren textkritischen Untersuchungen vorbehalten bleiben.
Die Neue Frau als Kultur- und Medienprodukt
In den Massenmagazinen und auch in den seriösen Zeitschriften der Weimarer Republik wird immer wieder der Versuch gemacht, die Neue Frau zu präsentieren, dies zunehmend im fotografischen Bild, und zugleich zu ,ergründen‘. Die alte Frage, was das Weib denn sei, die die Autoren des Fin de Si›cle oft bis zum Obsessiven umtrieb, kommt in anderer Form wieder, nun etwas modernisiert, aber immer noch oft aus der irritiert männlichen Perspektive. Die Neue Frau zeigt sich männlichen Beobachtern als Paradox: sinnlich-aufreizend und offensiv, schien sie doch zugleich nüchtern-sachlich und damit traditionelle männliche Weiblichkeitsimaginationen unterlaufend (vgl. Vorw. v. Silvia Bovenschen, in: Huebner 1990, 14). So fragt sich Max Brod, neben Bronnen, Eggebrecht, Flake, Thiess, Lucka u.a. Beiträger zum 1929 von Friedrich Markus Huebner herausgegebenen Sammelband Die Frau von Morgen, wie wir sie wünschen, ob die Beziehungen der Geschlechter sich wirklich versachlichten, ausschließlich Männer wurden hier um ihre Einschätzung gebeten. ,Herzlos‘ sei die Neue Frau mitunter schon, meint Brod besorgt, stellt aber am Ende beruhigt fest, sie werde den Bogen schon nicht überspannen, und die Problematik der Geschlechter könne dann in der vage prophezeiten sozialistischen Gesellschaft gelöst werden:
Die Frau von morgen wird instinktvoll und klug die guten von den bösen Komponenten der ,neuen Sachlichkeit‘ zu scheiden haben. Darin sehe ich ihre Bedeutung […] für die gesamte soziale Entwicklung zu einer wirklichen, nicht auf Ausbeutung beruhenden Gesellschaft und Staatengemeinschaft. (Huebner 1990, 54)
Neigen viele der in diesem Band vertretenen Autoren zur Fortschreibung spekulativer Weiblichkeitsmuster, äußert sich bei ihnen auch eine alte Angst vor der ,Vermännlichung‘ der Frau. Brod etwa meint in den literarischen Weiblichkeitsdarstellungen einen „harten, kalten männlichen Zug“ (ebd., 48) zu entdecken und der Flaneur Franz Hessel hält sich – halb schwärmerisch, halb ironisch – bei der Skizzierung der Hauptstadtfrau an Beobachtungen:
Schöne Berlinerin, du hast bekanntlich alle Vorzüge. Du bist tags berufstätig und abends tanzbereit. Du hast einen sportgestählten Körper, und deine herrliche Haut kann die Schminke nur erleuchten. […] Mit der Geschwindigkeit, in der deine Stadt aus klobiger Kleinstadt sich ins Weltstädtische mausert, hast du Fleißige schöne Beine und die nötige Mischung von Zuverlässigkeit und Leichtsinn, von Verschwommenheit und Umriss, von Güte und Kühle erworben. (Hessel 1994, 26)
Hessels Flaneursblick kommt der Realität wahrscheinlich näher als die spekulativen ,Wesensbestimmungen‘ der in Huebners Band versammelten Kollegen. Er zeigt etwas von der Diversität, auch den Anforderungen, der sich die Neue Frau zu stellen hatte, aber auch von ihrer Erlebnislust – und er sieht sie in Synchronie zur Großstadt, deren Teil sie ist. Die Bilder des Weiblichen werden auch in der Weimarer Zeit noch hauptsächlich von Männern produziert, allerdings ist deren Definitionsmacht jetzt doch immer mehr bedroht. Denn gerade im neusachlichen Kontext, aber überhaupt in der öffentlichen Repräsentation melden sich Frauen jetzt erstmals in größerer Zahl und mit größerem Gewicht selbst zu Wort und bestimmen zumindest ein Stück mit, und das nicht nur über die tatsächliche soziale Praxis, sondern auch über deren Symbolisierungsfelder.
Allerdings finden wir auch in den kulturellen Repräsentationen die für die Weimarer Republik charakteristische Gemengelage: Häufig ist kaum zu entscheiden, ob es sich um authentische Selbstäußerungen neuer Weiblichkeit handelt oder nicht doch letztlich um traditionelle Zuschreibungen, die auch von Frauen selbst übernommen werden. Immerhin sitzen in den Redaktionen der Zeitungen, Zeitschriften und Verlage nun immer mehr gebildete und unternehmungslustige Frauen, die versuchen, die Stellung der Frau in der Gesellschaft neu und selbstbewusst zu verorten (vgl. Todorow 1991). Voraussetzung dafür waren der mit der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und dem Zerfall der wilhelminischen Gesellschaft sich vollziehende partielle Abbau von Hierarchien und zugleich eine Erschütterung der überkommenen patriarchalischen Strukturen. Die Frauen waren in großem Ausmaß Trägerinnen der Kriegswirtschaft gewesen, und dieser Wandel ließ sich trotz allen Beharrungsvermögens der reaktionären Kräfte auch nach dem Kriege nicht wieder rückgängig machen.
Die Künstlerinnen, Autorinnen, Direktricen, Modeschöpferinnen und Galeristinnen repräsentieren neue Formen des Selbstbewusstseins, des Körper- und Bewegungsausdrucks, insbesondere auch der Erotik. Der moderne Typus wird häufig von Schriftstellerinnen, Schauspielerinnen, Tänzerinnen oder Varietékünstlerinnen repräsentiert: von der skandalumwitterten Tänzerin Anita Berber, die nach ausschweifendem Leben bereits 1928 mit 29 Jahren starb, von Valeska Gert, der erfolgreichen Kabarettistin und Schauspielerin, von den umschwärmten Film- und Theaterstars Claire Waldoff und Marlene Dietrich, von Autorinnen wie Vicki Baum, Gabriele Tergit, Irmgard Keun oder Thea von Harbou, zeitweilig Gattin von Fritz Lang, die als Drehbuchautorin (Der müde Tod von 1921, Die Nibelungen, Metropolis), aber auch als Romanautorin reüssierte.
Die medialen Repräsentationen des Weiblichen
In den symbolischen Konstruktionen des Weiblichen findet sich „ein breitgefächertes Spielen mit traditionellen Geschlechterrollen“ (Roebling 2000, 52), aber auch mit neuen Verhaltensangeboten, das in immer neuen Kombinationen vorgeführt wird. Neusachliches Kunstverständnis und neue Weiblichkeit konvergieren dabei häufig in den Grundvoraussetzungen. Die Neue Sachlichkeit, so könnte man pauschalierend sagen, erlaubt größere Spielräume für ästhetische Weiblichkeitsvorstellungen als etwa der Expressionismus oder die Literatur der Jahrhundertwende, die eine Domäne von Weiblichkeit imaginierenden Männern blieb. Wesentlich dabei ist die Hinwendung der neusachlichen Kunst und Literatur zum Gegenständlichen und Körperlichen, zur Bewegung, zum Visuellen und auch die Annäherung der Literatur an die Berichts-, Presse- und Unterhaltungsformen, die eine Teilnahme von Frauen eher möglich machte. Ob neben der Versachlichung auch die „Vereinfachung“ (Becker 2003, 191) des literarischen Stils die ,Feminisierung‘ der Literatur erleichtert hat, wie Becker meint, muss dahingestellt bleiben.
Die medialen Konstruktionen des Weiblichen werden zunehmend von den Ikonographien des Kinos bestimmt, dort werden anziehende junge Frauen – Schauspielerinnen wie Asta Nielsen, Pola Negri oder Greta Garbo, in Deutschland Henny Porten oder Marlene Dietrich – im Luxusleben gezeigt, als Wunschbilder der Männer, allerdings auch in tragischen und verzweifelten Situationen, die sich in der Form des filmischen Melodrams gut zeigen lassen. Mit der Realität haben diese Bilder natürlich wenig zu tun, und Kritiker wie Siegfried Kracauer vermerkten diese Irrealität in ihren Analysen immer wieder, etwa im bekannten Artikel „Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino“, der 1928 in der Frankfurter Zeitung erschien: „Die blödsinnigen und irrealen Filmphantasien sind die Tagträume der Gesellschaft, in denen ihre eigentliche Realität zum Vorschein kommt, ihre sonst unterdrückten Wünsche sich gestalten.“ (Kracauer 1963, 280).
Girlkultur
Das Girl – wie die analogen Typen des ,Flapper‘ und der ,Garçonne‘ – ist ein Produkt der seit Mitte der 1920er Jahre immer stärker repräsentierten Unterhaltungskultur, ein Import aus den USA. Der Typ findet sich als Zigarettenverkäuferin in den Varietés und Revuetheatern, im Film und nach diesem Modell geformt, auch in den Cafés und Büros der Großstädte: jung, sportlich, körperbetont, freizügig, aber auch diszipliniert. Die modischen Vorgaben für die Neue Frau waren dem dominierenden Vorkriegsbild entgegengesetzt: „Die Kleidung versprach jetzt Bewegungsfreiheit und strahlte Jugendlichkeit aus. Das modische Ideal der Zeit war die schlanke, knabenhafte Silhouette.“ (Strobel 2008, 124) Die Kleider wurden kürzer oder man trug Hosen, die Schuhe spitz, und der Pagen- oder Herrenschnitt (Bubikopf) war die bevorzugte Frisur. Die junge Frau stellte sich als „sachlich und androgyn“ (ebd.) vor, zugleich aber auch als sinnlich und begehrenswert. Rudolf Kayser beschrieb das Girl in seinem Artikel „Amerikanismus“ von 1925 als „knabenhaft, linear, beherrscht von lebendiger Bewegung, vom Schreiten, vom Bein“ (zit. n. Kaes 1983, 266).
Die Girlkultur präsentierte sich vor allem in den beliebten Revuen der Varietétheater, wo, nach Pariser Vorbild, die Tänzerinnen sparsam bekleidet und zugleich in fast militärischem Gleichschritt oder auch im Rhythmus der Maschinen vorgeführt wurden. Diese Formierung und Anonymisierung beschäftigte die Theoretiker stark, in kritischer Absicht Kracauer (Das Ornament der Masse), vor allem aber den Psychologen Fritz Giese, der in seinem Buch Girlkultur. Vergleiche zwischen amerikanischem und europäischem Rhythmus und Lebensgefühl (1925) die Revueveranstaltungen als ein Mittel zur Disziplinierung (vgl. Baureithel 2007) sowie als Ausdruck einer neuen Körper- und Bewegungskultur bestimmte: „Die Girls sind der Ausdruck jenes echten Sportgeistes der Frau, die in elegantem Sprunge auf die Straßenbahn, vom Automobil herunter, in schneller Reaktion zum Telephon eilt: wie es die rasche Zeit dauernd erfordert.“ (Giese 1925, 97) Ähnlich wie in der Massengymnastik erscheint das Individuum hier gleichgeschaltet mit der kapitalistischen Rationalisierung und seriell, jede Individualisierung wird zurückgenommen. Für Giese ist die Girlkultur insgesamt ein „Produkt amerikanischer Mentalität“ (Giese 1925, 15). Im Vordergrund steht der Zusammenhang von Amerikanismus, Fordismus, Taylorismus und Girlkultur, wobei die Wurzeln dieser Vermassung und Disziplinierung in der preußisch-militaristischen Kultur verkannt werden (vgl. Weisbrod 2006, 206). Besonders eindrucksvoll wurde die massenhafte ornamentale Inszenierung des weiblichen Körpers von Gruppen wie den „Tiller Girls“ vorgeführt, die in den 1920er Jahren in allen Großstadtrevuetheatern Triumphe feierten (vgl. Polgar 1926). Die Girl-Truppen trieben den Drill allerdings teilweise so weit, dass die Vorführungen als unerotisch empfunden worden (vgl. Roebling 2001, 263). Die Betonung des Körperlichen als Auslöser erotischer wie ,sachlicher‘ Wirkungen erscheint in der Entstehungszeit neu, ist aber auch eine Fortschreibung binärer Geschlechtercodes, da beim Mann weiterhin stärker die ,Geistigkeit‘ betont wird.
Die Verbindung von Girlkultur und Amerikanismus wurde häufig polemisch attackiert, etwa in Adolf Halfelds bekanntem Buch Amerika und der Amerikanismus (1927), das die alteuropäische Tradition gegen die angebliche amerikanische Kulturlosigkeit verteidigte (vgl. Weisbrod 2006). Die Vereinigten Staaten erschienen solchen kulturkritischen Autoren als Einfallstor für eine ungehemmte, wilde Sinnlichkeit, wie sie sich vor allem im Tanz und in der Musik äußerte. Dass dabei stets rassistische Untertöne im Spiel waren, Warnungen vor ,Neger- und Hottentottenbewegungen‘, versteht sich. Eine Einflussnahme war natürlich durchaus vorhanden: Ein Roman wie Anita Loos' Gentlemen Prefer Blondes, der 1925 in den USA erschienen war und in Deutschland zunächst als Fortsetzungsserie in der Zeitschrift Die Dame und dann 1927 in Buchform erschien, wirkte massiv auf die Entstehung der deutschen Frauenliteratur der 1920er Jahre ein und beeinflusste Keun, Baum und andere Autorinnen. Die Ambivalenz des Girl-Typs zeigt sich gerade an diesem ungemein erfolgreichen Buch, denn hier erscheint unter der sexualisierten Oberfläche eine geradezu septische Lustneutralität (vgl. Roebling 2000, 17 – 21).
Erfolg und Kritik
Die neusachlichen Autoren nehmen die gängigen, teilweise bereits klischierten Bilder der Neuen Frau auf, variieren sie und eröffnen durch die Form des überwiegend nüchternen, manchmal ironischen und bisweilen wehmütigen Berichts Möglichkeiten des Verständnisses wie der Kritik. Neben der beruflich erfolgreichen Alleinstehenden, die für die Karriere eine ausfüllende Liebesbeziehung opfert, wie Cornelia Battenberg in Kästners Fabian, steht die nur in Teilbereichen – zum Beispiel der erotischen Ausstrahlung – ihrer selbst sicheren Frau, die beruflich in einem nivellierten Angestelltenheer untergeht und sich in eine Phantasiewelt flüchtet, wie die Protagonistinnen bei Irmgard Keun. Der Nähe zur Unterhaltungs- oder Kolportageliteratur versuchen die Romanautorinnen meist nicht auszuweichen. Vicki Baum nennt Menschen im Hotel im Untertitel nicht ohne Ironie einen Kolportageroman mit Hintergründen, ihren Roman stud. chem. Helene Willfüer versieht sie ebenfalls mit trivialen Erzählelementen. Die neusachlichen Frauen- und Angestelltenromane befriedigen also partiell durchaus die eskapistischen Bedürfnisse der Leserinnen in der Schilderung kleinbürgerlicher Hoffnungen auf Liebe und Erfolg, zugleich aber zeigen sie immer wieder in realistischer Weise die zermürbenden Routinen, denen Sekretärinnen oder Verkäuferinnen unterworfen und die Repressionen, denen sie in der Berufs- wie Freizeitwelt ausgesetzt sind. Die Freizeit erscheint mitunter als illusionärer Freiraum. Realistische Bilder der weiblichen Angestelltenexistenz vermitteln etwa Rudolf Braunes Roman Das Mädchen an der Orga Privat (1930), Christa Anita Brücks Schicksale hinter Schreibmaschine (1930), Gina Kaus’ Die Verliebten (1928), ein Roman, der wegen seiner Darstellung von der Frau initiierter freizügiger sexueller Aktivitäten Publikationsschwierigkeiten hatte, Mela Hartwigs 1931 entstandener Roman Bin ich ein überflüssiger Mensch oder – auf ungleich höherem ästhetischen Niveau – auch Marieluise Fleißers Eine Zierde für den Verein - Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen (1931).