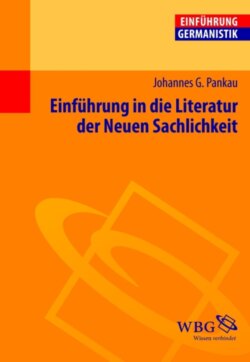Читать книгу Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit - Johannes Pankau - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Die Nachwirkung des Krieges
ОглавлениеWurde der Weltkrieg in der ersten Zeit häufig als eine Art reinigendes Gewitter empfunden, „,eine herrliche Erfrischung nach der langen faulen Zeit des Friedens‘“ (Glaeser 1978, 56), wie ein Assessor in Ernst Glaesers Roman Jahrgang 1902 sagt, so erscheint sein Ausgang je nach Standort als Niedergang oder als eigentlicher Beginn der Moderne. Große Teile der publizistischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Diskurse in allen Phasen der Weimarer Republik reflektieren in sehr verschiedenartiger Weise die Schuldfrage, mehr noch aber die Folgen des verlorenen Krieges für die staatliche Organisation, das Verhältnis zu den ehemaligen Feinden, die Ökonomie und die Mentalität von großen Teilen der Bevölkerung. Besonders in der Literatur spielt die Kriegsthematik eine wichtige Rolle, und mit den im Umkreis der Neuen Sachlichkeit zu verortenden Autoren meldete sich Ende der 1920er Jahre eine später als lost generation bezeichnete Gruppe zu Wort, die bei Kriegsanbruch im jungen Erwachsenenalter (Renn, Jahrgang 1889), in der Adoleszenz (Remarque, Jahrgang 1898) oder noch in der Kindheit (Glaeser, Jahrgang 1902) war.
Patriotische und nationalistische Romane, Berichte und Erinnerungen überwogen zunächst. In der Statistik der Auflagenzahlen der Kriegsliteratur von 1914 bis 1939 liegen Richthofens Tagebuchsammlung Der rote Kampfflieger und Remarques Im Westen nichts Neues mit jeweils ca. 1,2 Millionen Exemplaren klar an der Spitze, danach kommen die Abenteuer des Fliegers von Tsingtau (1916) des Luftwaffenfliegers Gunther Plüschow, gefolgt von der erfolgreichen, national gestimmten Kriegserzählung Der Wanderer zwischen beiden Welten von Walter Flex (vgl. ebd., 10f.). Den nationalistischen Autoren (Beumelburg, Dwinger, Grimm, Luckner) ging es nicht um die schonungslose und aufrüttelnde Darstellung des Geschehens, sondern um Verklärung aus einer vergoldeten Erinnerung und die Stärkung des militaristischen Widerstandswillens. Die mediale Auseinandersetzung mit dem Krieg als entscheidendes Zentralereignis spielte im gesamten Weimarer Kontext eine große Rolle, insbesondere auch als ein Sujet der Neuen Sachlichkeit, die hier ihren Wirklichkeitsbegriff besonders intensiv erproben konnte.
Die lange vorherrschende, schon von Pinthus vertretene Annahme, nach einer Phase des „Nichtmehrwissenwollens“ (Pinthus, zit. n. Becker 2000b, 40) habe sich seit 1928 / 28 ein neuer Strom an ,Kriegsbüchern‘ gebildet, ist, wie quellenkritische Forschungen gezeigt haben, nicht haltbar; allerdings ist nach 1929 in der Tat ein Anstieg zu verzeichnen. Der Gesamtkorpus dieser Literatur ist kaum überschaubar, in einer neuen Sichtung wird von 670 Titeln gesprochen, faktisch ist die Zahl wesentlich höher (vgl. dazu Vollmer 2003, 6). Wesentlich schwieriger noch als die quantitative Erfassung der Texte ist die Bestimmung der Intentionalität, des Verhältnisses zur literarischen Moderne sowie zum Spannungsfeld von Dokumentarismus und Fiktionalität, zumal in der frühen Forschung (einsetzend mit Hans Harald Müllers Habilitationsschrift Der Krieg und die Schriftsteller, 1986) häufig nur eine geringe Zahl von heute noch bekannten Romanen einbezogen wird. Selbst literarisch ambitionierte Werke wie Leonhard Franks Novellensammlung Der Mensch ist gut (1918), die beiden Kriegsromane Theodor Plieviers Des Kaisers Kulis (1930) und Der Kaiser ging, die Generäle blieben (1932), Als Mariner im Krieg (1928) von Joachim Ringelnatz oder Arnold Zweigs Der Streit um den Sergeanten Grischa (1927) wurden erst spät eingehender untersucht. Noch weniger Aufmerksamkeit gewannen Werke wie Adam Scharrers proletarisch-marxistisches Kriegsbuch Vaterlandslose Gesellen (1930) oder auf der rechten Seite Franz Schauweckers Roman Aufbruch der Nation (1930), ein Antikriegsbuch wie Der Schädel des Negerhäuptlings Makaua (1931) von Rudolf Frank und Georg Lichey oder Ernst Johannsens Vier von der Infantrie (1929), immerhin die Vorlage für G. W. Pabsts bedeutenden Kriegsfilm Westfront 1918 (UA 1930). Johannsen schrieb zudem mit Brigadevermittlung (1929) auch eines der wichtigsten Hörspiele der Zeit. Gegenüber dieser lange Zeit vorherrschenden Vernachlässigung (der auch ein Desinteresse des Lesepublikums entsprach) konnten sich die Bücher von Ernst Jünger über das Fronterlebnis breiter Aufmerksamkeit gewiss sein, das gilt für das auf Tagebuchaufzeichungen beruhende, 1920 erschienene In Stahlgewittern ebenso wie für den Essay Der Kampf als inneres Erlebnis (1922) und Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen, 1918 (1925).
Im Kontext des neusachlichen Schreibens ist besonders die Frage von Bedeutung, wie sich in der Kriegsliteratur das Verhältnis von Dokumentarismus und Fiktionalismus darstellt. Hierzu können einige Tendenzen angegeben werden:
Die frühe, noch im Krieg oder relativ kurz danach verfasste, Kriegsliteratur ist meist autobiographisch orientiert. Sie ist Erlebnisliteratur, die versucht, die Authentizitäts-Annahme aufrechtzuerhalten oder gar zu konstruieren, obwohl fast immer eine literarische Überformung nachweisbar ist. Dies gilt für die Kriegsbücher Ernst Jüngers, letztlich aber noch für Remarques Im Westen nichts Neues. Damit war eine Transfermöglichkeit auf Grundgefühle der aus dem Krieg psychisch wie häufig auch physisch versehrt zurückgekehrten Kriegsgeneration hergestellt, und zugleich konnte deren Erfahrung in einem nun literarisch gewendeten ,Wahrheitsdiskurs‘ aufgehen (vgl. hierzu Müller 1986, 3 – 5).
Die Romane sind nur dann anschlussfähig an die literarische Moderne, wenn man diese nicht in einem experimentellen Sinne versteht, sondern die nicht-intentionalen Brüche und Spannungen der Narration einbezieht. In der Darstellungsform bleiben die Werke einem Abbildungsrealismus verpflichtet, allerdings mit starken Montage- und Reportagetechniken in Romanen wie Arnolt Bronnens O.S. (1929), der die Kämpfe der Freikorps gegen polnische Aufrührer nach dem Ende des Krieges im Sinne der deutsch-völkischen Kräfte in Oberschlesien darstellt, oder Edlef Köppens Heeresbericht (1930), der den Topos der Desillusionierung eines zunächst begeisterten jungen Mannes entwickelt. Der Kriegsroman in dieser Form scheint besonders gut mit der neusachlichen Programmatik verbunden werden zu können (vgl. Schöning 2007, Stockhorst 2008).
Im Verlaufe der Weimarer Republik, mit der Zeit um 1925 als Zäsur, ist eine tendenzielle Veränderung im Umgang mit den Kriegserlebnissen feststellbar: Gegenüber den pseudoauthentischen, apologetischen, als Augenzeugenberichte präsentierten Kriegserinnerungen, Regimentsberichten, Tagebüchern etc. treten nun Texte mit stärker offen fiktionalisiertem Anteil hervor. Die meisten Romane und Novellen zeigen eine Ausdifferenzierung der Erzähltechnik, es kommt gegen Ende der 1920er Jahre stärker zu auch politisch motivierten Auseinandersetzungen um die Deutungsmacht bezüglich des Kriegsereignisses und ein „semantischer Kampf“ (Vollmer 2003, 16) zwischen den Extremen prägt in der Folge die Wirkungsgeschichte der Kriegsliteratur.
Gegenüber diesen Deutungsunterschieden ist das in den Narrationen gezeigte Bild des Kriegsgeschehens relativ einheitlich (vgl. Schöning 2007, 360), sowohl bei der Schilderung von Kampfszenen als auch der Vorgänge in der Etappe.
Entscheidend ist der Versuch einer Deutung und Sinnstiftung des Krieges ex post (vgl. Müller 1986, 53ff.). Nicht mehr das Rechtfertigungs- oder auch ein Unterhaltungsbedürfnis steht jetzt im Vordergrund, sondern der Versuch einer Bewältigung der generationellen Verlorenheit für die Nachkriegsexistenz, weshalb die meisten Kriegsromane eigentlich Gegenwartsromane sind.
Technifizierung des Krieges und mediale Abbildung stehen in engem Verhältnis. Der Krieg brachte neue destruktive Potenzen hervor, aber auch Möglichkeiten einer visuell bestimmten Realitätswiedergabe wie -manipulation. So wurde die Ufa 1917 von Banken und Militärs vor allem zur Stärkung der Kriegspropaganda gegründet, die Fotografie wurde als wichtiges Speicherungsmedium eingesetzt. Auch in der Literatur wurde der dokumentarische Charakter der Weltkriegesschilderungen betont, allerdings ist eine Identifizierung von Wirklichkeit und Reproduktion bereits theoretisch nicht aufrechtzuerhalten. Die Wiedergabe des Geschehens – häufig aus der Ich-Perspektive eines einzelnen Soldaten – bleibt notwendig im Bereich des Subjektiven, Arbiträren und Fragmentierten (vgl. Müller 1986, 5). Dies gilt selbst für Fotobände und Berichtsanthologien wie Ernst Friedrichs Krieg dem Kriege! (1924), Schauweckers So war der Krieg (1928) und das von Kurt Kläber 1929 herausgegebene Erste Volksbuch vom großen Krieg, in dem Beiträge von international bekannten literarischen und politischen Autoren versammelt sind.
Gerade in der Haltung dem Krieg gegenüber wird der Unterschied von expressionistischer und neusachlicher Haltung deutlich. Im Übergang zeigt dies etwa die Darstellung der Figur des Kriegskrüppels in Franks Der Mensch ist gut von 1918, die, wie Lethen gezeigt hat, noch einmal die ,kreatürliche‘ Mitleidsfunktion aktiviert und zugleich die Ablehnung der neusachlichen Protagonisten hervorruft (vgl. Lethen 1994, 249).
Der Krieg ist als Erfahrungsgrundlage nicht nur in der explizit auf den Krieg bezogenen Literatur präsent, er durchdringt die Texte durch die Gattungen hindurch subkutan: ,Geistige‘ Kriegsfolgen zeigen sich im Zeitstück an den Ängsten und an der Verlassenheit der jungen Leute (etwa in Bruckners Krankheit der Jugend, 1926), sie hindern die (männlichen) Angehörigen der um 1900 geborenen Generation am Entwurf tragfähiger Zukunftspläne, sie bewirken ein Gefühl der Verlassenheit und machen die Gegenseitigkeit der Liebe problematisch. Zwar sucht man (wie Kästners Fabian) nach einer Form der Geborgenheit, ist aber oft unfähig dazu. In Vicki Baums Menschen im Hotel war der Krieg für den entwurzelten Baron Gaigern eine Art Heimat, in der Kälte der Nachkriegszeit wird er zum ruhelosen Wanderer und Dieb: „,Im Krieg war es gut. Im Krieg spürte ich mich zu Hause.‘“ (Baum 1988, 139) Den Verlust der Jugend vor der Zeit als Generationserfahrung im lyrischen Wir rufen neusachliche Gedichte Erich Kästners auf, zum Beispiel „Jahrgang 1899“, das Trauer darüber in der Maske der für Kästner typischen Lakonie artikuliert:
Man hat unsern Körper und hat unsern Geist
ein wenig zu wenig gekräftigt.
Man hat uns zu lange, zu früh und zumeist
in der Weltgeschichte beschäftigt!