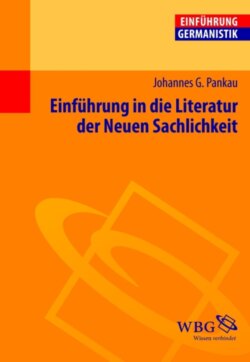Читать книгу Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit - Johannes Pankau - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Politische und literarische Kämpfe und Kontroversen
ОглавлениеDie Autoren der Neuen Sachlichkeit bildeten nicht – wie die Expressionisten – mehr oder weniger feste Gruppen mit programmatischem Anspruch. Sie waren eher Einzelgänger, die in den literarischen Szenen vor allem Berlins verkehrten. Wie bereits vor dem Weltkrieg so waren es auch jetzt insbesondere die Literatencafés, in denen sich Schriftsteller wie Kästner, Brecht oder Kaléko trafen. Zu einem der Zentren wurde das Romanische Café, das allerdings gegen Ende der Weimarer Zeit den Angriffen nationalsozialistischer Trupps ausgesetzt war (vgl. Bienert 2005). Eine Literatengruppe, in der zahlreiche neusachliche Autoren wie Döblin, Kasack, Kesten, Roth und Kisch sich sammelten, war die von Rudolf Leonhard 1927 gegründete heterogene „Gruppe 1925“, die sich gegen staatliche Eingriffe und politische Anfeindungen wehrte (vgl. Petersen 1981). Mit der zunehmenden politischen Polarisierung der Schriftsteller schloss sich eine Reihe von Autoren, die aus dem neusachlichen Umkreis kamen, linken Organisationen an, vor allem dem Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller (BPRS), der – 1928 gegründet und der KPD nahe stehend – die für die literaturpolitischen Debatten wichtige Zeitschrift Die Linkskurve herausgab. Zwar wurden hier zunächst kontroverse Positionen zugelassen, aber in den letzten Jahren der Republik geriet der BPRS immer stärker unter den Einfluss der von der Komintern erlassenen Generallinie der Kommunistischen Partei. Der BPRS blieb trotz seiner unzweifelhaften Bedeutung für die neusachliche Theoriediskussion, vor allem im Rahmen der Kontroverse um Reportage und Roman, doch relativ isoliert, da auch marxistische Autoren wie Brecht ein direktes Engagement ablehnten.
Der Austausch zwischen den Literaten, die der Neuen Sachlichkeit zuzurechnen waren, vollzog sich zu großen Teilen über die Tätigkeit bei den großen Verlagen, Tageszeitungen und Magazinen: Der multimediale Autor entstand. Im Gegensatz zu den prominenten älteren Autoren, die trotz gelegentlicher publizistischer Aktivitäten ihrer literarischen Buchproduktion Priorität einräumten, stand für die neusachlichen Autoren diese Tätigkeit teilweise im Vordergrund, dies aus finanziellen Gründen, aber auch, weil diese Medien als vorwärtsweisend angesehen wurden. So ließ sich für Brecht die marxistische Weltanschauung gut mit der lyrischen Produktion von Werbetexten vereinbaren, arbeitete Kästner durchgängig für Magazine und war Vicki Baum sogar Angestellte des Ullstein-Verlages. Diese Produktionsmischform bot sich auch deshalb an, weil journalistisches und im engeren Sinne literarisches Schreiben sich annäherten und viele Texte ohne Mühe aus der Kurzform oder der Fortsetzungsserie in eine Buchfassung übertragen werden konnten.
Die gegenseitige Kritik der als neusachlich zu bezeichnenden Literaten und Journalisten war durchaus hart und manchmal unversöhnlich, wie etwa die Kritiken von Tucholsky oder Ihering und auch die Polemiken Brechts zeigen. Sie kreisen um politische und gesellschaftliche Fragen, immer wieder aber auch um die Grundpositionen des Schreibens, die Aktualität oder Obsoletheit von Gattungen, Strömungen oder Autoren. Bis weit in die 1920er Jahre hinein reicht die Debatte um den Expressionismus, aber auch um neue Formen des Romans und des Dramas oder die Reportageform und schließlich um die Nachwirkungen des Weltkriegs, die Ende des Jahrzehnts an Schärfe zunimmt. Besonders vehement ist die Diskussion um die gesellschaftsverändernde oder affirmative Funktion der Literatur, die vor allem durch Walter Benjamins gegen Erich Kästners Lyrik gerichteten Aufsatz „Linke Melancholie“ ausgelöst wurde.
Immer wieder geht es im Kontext der neusachlichen Literaturentwicklung um die Begriffe von Objektivität, Gebrauchswert und Parteinahme und darum, wie diese Begriffe inhaltlich-öffentlich zu füllen sind. Die im Verlaufe der Neuen Sachlichkeit entwickelten Genres der Reportage und des Zeitstücks zeigen das Realitäts- und Literaturverständnis der Neuen Sachlichkeit am deutlichsten. Bald schon wurden die Begrenzungen dieser Formen zum Thema, die Tendenzen zur Dispensierung des Kunstanspruchs und zur Negation der Subjektivität. Das Zeitstück als Genre blieb, nachdem es die Jahre ab 1925 bis etwa 1933 auf dem Theater partiell bestimmt hatte, eine Episode in der Theatergeschichte, es wurde von der wesentlich komplexeren und artifizielleren Theaterform Brechts theoretisch wie in der dramaturgischen Durchführung überboten. Auch die Reportage bildete sich in gewisser Weise zurück zur journalistischen Gebrauchsform, nachdem Kisch vor allem aufgrund seines persönlichen Talents die Berichtsform an die Literatur angeschlossen hatte.