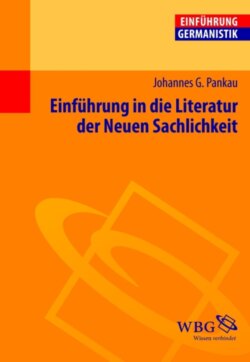Читать книгу Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit - Johannes Pankau - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Forschungsbericht
ОглавлениеDie Neue Sachlichkeit als eigenständige Strömung ist bereits in der Formationsperiode heftig und kontrovers diskutiert worden. In der Entstehungszeit wurde sie häufig als eine Modeerscheinung betrachtet, auch in jüngerer Zeit findet sich gelegentlich noch diese Beurteilung (vgl. Schütz in Kisch 1978, 313). In der Literaturwissenschaft hat sie erst relativ spät Würdigung erfahren. Ähnlich wie andere der literarischen Moderne oder der Avantgarde des 20. Jahrhunderts angehörige Erscheinungen, wie etwa der Expressionismus oder die Exilliteratur, passte sich auch die Neue Sachlichkeit den Epochen- und Gattungspräferenzen der Forschung seit 1945 nicht an und entsprach in Themenwahl und Sprachduktus auch lange Zeit nicht den Geschmackskonventionen, die am Werk von Autoren wie Rilke, Thomas Mann, Benn oder George orientiert waren. So wird etwa in Fritz Martinis viel gelesener Deutscher Literaturgeschichte der Expressionismus als letzte ,Epoche‘ explizit gewürdigt, eine systematische Behandlung der Neuen Sachlichkeit fehlt.
Nationalsozialistische Positionen
Während der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigte sich die Germanistik aus eindeutig politischen Gründen so gut wie nicht mit der Neuen Sachlichkeit, die wichtigen neusachlichen Autoren waren schon vor 1933 von den NS-Ideologen als nihilistische Asphaltliteraten denunziert worden. Allerdings formulierte Goebbels in seiner „Rede über die Stellung des neuen Staates zur Kunst“ vom Mai 1933 ein Verständnis des Sachlichen, das den nationalsozialistischen Normen von Härte und autoritärer Formierung entgegen kommt und den Begriff deutsch-völkisch uminterpretiert (hierzu und zu ähnlichen Stellungnahmen der Nazi-Führer vgl. Becker 2000a, 341f.). Eine im engeren Sinne wissenschaftliche Behandlung des Themas versuchte der kurze Zeit später zum NS-Stargermanisten aufgestiegene Heinz Kindermann mit dem Buch Das literarische Antlitz der Gegenwart und seinen Aufsätzen von 1930 und 1933, in denen er eine lebensphilosophisch grundierte „idealistische Sachlichkeit“ postulierte, eine Haltung, die dann in die Dissertation von Gertrud Hilgers zur zeitgenössischen Lyrik einging (vgl. Kindermann 1930, Hilgers 1934). Denunziert wurden allerdings von Beginn die Werke der wichtigen Exponenten neusachlicher Literatur aus dem linken Spektrum von Bertolt Brecht bis Robert Neumann, von Vicki Baum bis Mascha Kaléko. Sie wurden verfemt und in vielen Fällen in die Emigration gedrängt. Erich Kästner, auch er bedroht und von Berufsverbot betroffen, aber in Deutschland verbleibend, war die Ausnahme.
Aufschwung der Forschung nach 1970
Noch 1972 stellte Karl Prümm mit Recht fest: „Die 20er Jahre haben in der Literaturwissenschaft bisher […] kaum Beachtung gefunden.“ (Prümm 1972, 606) Zugleich merkte er an, dass die Klischeevorstellung der goldenen 20er Jahre eine ernsthafte Erforschung behindert habe. Allerdings hängt die Abstinenz der Germanistik vor allem mit einer Abwehr von allem direkt Politischen und Sozialen zusammen, die die Phase der Werkimmanenz bestimmte.
Eine Öffnung gegenüber modernistischen Richtungen und ein auch politisch motiviertes Interesse an der Literatur der Weimarer Republik entwickelte sich erst im Gefolge des Paradigmenwechsels nach 1968 (vgl. Fähnders 1998, 226). Helmut Lethen legte mit seinem Buch Neue Sachlichkeit 1924 – 1932. Studien zur Literatur des ,weissen Sozialismus‘ (1970) die erste Monographie mit umfassendem Anspruch zum Thema Neue Sachlichkeit vor. Dabei ging er von einem bezeichnenden Gegensatz in der bis dahin überaus spärlichen germanistischen Behandlung dieser Epoche und der des Expressionismus aus: Er konstatierte eine eindeutige Präferenz der expressionistischen Literaturrevolution gegenüber einer Dichtung, die sich nach der Novemberrevolution der neuen realen Situation der deutschen Gesellschaft stellte (vgl. Lethen 1970, 2).
Lethen selber verstand die Literatur der Neuen Sachlichkeit im Ganzen als affirmativen Ausdruck einer von der Systemlogik erzwungenen Sachlichkeit, die ihre Basis in der Produktionssphäre hatte. „In den 20er Jahren lässt sich beobachten, wie die Ideologen der Bourgeoisie mit dem Begriff der ,Sachlichkeit‘ – als einem Normbegriff der herrschenden Klasse – die Arbeit des Unkenntlichmachens der Klassengesellschaft zu leisten beginnen, und später, wie der NS-Staat diesen Prozeß […] fortsetzt.“ (Lethen 1970, 8) Die literarischen Produkte der Neuen Sachlichkeit erscheinen, in rechter wie linker Provenienz, als Ausdruck eines Einverständnisses mit der in Deutschland verspätet wahrgenommenen Modernisierung unter kapitalistischen Vorzeichen (vgl. Lethen 1983, 168). Daraus ergibt sich eine recht schematische Darstellung in Gegensatzpaaren (zit. n. Lethen 1983, 172f.):
Verwurzelung versus Mobilität
Symbiose versus Trennung
Wärme versus Kälte
Undurchsichtigkeit versus Transparenz
Wachstum versus Planung
Erinnerung versus Vergessen
Sammlung versus Zerstreuung
Organismus versus Apparat
Individuum versus Typus
Original versus Reproduktion
Natürlicher Zyklus versus Mechanische Zeit
Dunkelheit versus Helligkeit
Hinter diesem habituellen Einverständnis stecken Lethen zufolge „Parolen der Synchronisierung“ (Lethen 1983, 169), die er bereits im Dadaismus zu Beginn der Weimarer Republik entdeckt. Als Ergebnis dieser Synchronizität wandeln sich die Figur und die Funktion des Autors, der nun – jeglicher romantischen Aura entkleidet – als Operateur und Konstrukteur von technikanalogen Prozessen erscheint.
Lethens Ansatz war von Beginn nicht unumstritten. Ihm stand, ausgerichtet an den aktionistisch-ideologiekritischen Grundhaltungen der Zeit, bei allem Einfallsreichtum nur ein relativ grobes Instrumentarium zur Verfügung, zudem fehlte ihm eine ausreichende Quellenbasis. Methodologisch einseitig schlug er die neusachliche Literatur allzu glatt der kapitalistischen Ideologieproduktion zu, was auch durch die meist negative Sichtweise der Kritischen Theorie beeinflusst war. Insbesondere verfehlte er aber das spezifisch Literarische: „Der Versuch, die Neue Sachlichkeit in Zusammenhang mit ihrer Bindung an die Stabilisierungsphase der Weimarer Republik von 1924 bis 1929 und an deren Scheitern über vornehmlich ideologische Kriterien und politisch inspirierte Wertungen zu erfassen, darf heute als gescheitert gelten.“ (Becker 2000a, 13) Allerdings wird bei Becker wiederum die Verbindung der literarischen mit den anderen kulturellen Diskursen außer Acht gelassen (zur Kritik an solchen Voraussetzungen vgl. Müller-Seidel 1987, 429). Auch in jüngerer Zeit wurde – so von Bengt Algot Sørensen – noch die These vertreten, ein neusachlicher Stil in der Literatur lasse sich, anders als in der Malerei und Architektur, kaum ausmachen, das Neusachliche äußere sich eher in den Themen und Gattungen sowie allgemein in einer bestimmten Haltung Zeitphänomenen gegenüber (vgl. Sørensen 1997, 219).
In der frühen literaturwissenschaftlichen Forschung um 1970 wird die von Benjamin u.a. begründete Traditionslinie einer negativen Wertung der Neuen Sachlichkeit fortgeführt. Affirmative Tendenzen der Neuen Sachlichkeit werden überbetont, etwa in Jost Hermands Aufsatz „Einheit in der Vielheit? Zur Geschichte des Begriffs ,Neue Sachlichkeit‘“ (Hermand 1978; vgl. dazu Becker 2000a, 28f.). Hierbei handelt es sich meist um einen begrifflichen Kurzschluss: Es kann sehr wohl davon gesprochen werden, dass die Produkte der Neuen Sachlichkeit ein „Einwilligen in das zivilisatorisch Erreichte der westlich orientierten Massengesellschaft der Weimarer Republik“ (Schmitz 2001, 167) ausdrücken, also eine Affirmation des Gegenständlichen, dies schließt aber keineswegs eine radikale Kritik aus.
Die Beeinflussung durch die in der Frühphase gesetzten Forschungsprämissen lässt sich seit den 1970er Jahren klar verfolgen. Auch wenn gewisse Verstiegenheiten von Lethens früher Sicht der Neuen Sachlichkeit nicht geteilt wurden, so war der hier initiierte takeoff für die weitere Forschung über eine lange Phase doch maßgebend. Einfluss ausüben konnte auch das zweite wichtige Lethen-Buch zum Thema, Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen (1994), das die aus den Diskussionen der 1920er Jahre (Plessner) bezogene Kälte-Wärme-Metaphorik ausbaute. Lethen hat die vom Klassenschema bestimmte Bewertung aus seinem ersten Buch hier stark revidiert oder abgeschwächt. Allerdings hat er, wenn auch mit anderer Begründung, an den Prämissen des ersten Buches größtenteils festgehalten. Dies betrifft insbesondere die Haltung der Protagonisten der Gegenwart gegenüber, nämlich, wie es in den Verhaltenslehren der Kälte heißt, die „Entscheidung für den Zivilisationsbegriff“ (Lethen 1994, 30), also eine Entscheidung für die vor allem über Amerika vermittelte technisch-kommerzielle Zivilisation und gegen deren polemische Abwehr zugunsten moralischer, künstlerischer oder religiöser Werte, wie sie der europäischen und vor allem deutschen Tradition zugeschrieben wurde. Lethen entwickelt auch einen Begriff der ,neusachlichen Intelligenz‘, der innerhalb seines Untersuchungsspektrums nicht präzisiert werden kann. Becker bezeichnet die „Perspektive der anthropologischen Mentalitäts- und Verhaltensforschung“ (Becker 2000a, 31) als grundsätzlich ungeeignet zur Erschließung der ästhetisch-literarischen Dimensionen und hält die Herausarbeitung einer „Epochenidentität“ (Hüppauf 1995, 399) für unzureichend. In der Tat holt Lethen weit aus und versucht, die großen Entwicklungslinien der Verhaltensdiskurse zu rekonstruieren, die dann in der Weimarer Zeit zur Neuen Sachlichkeit führen: Von der Scham- und Gewissenskultur über Graciáns ,kalte persona‘ und Wahrnehmungs- und Ausdrucksmodelle bis zur Handlungstheorie von Bühler und der Relation Carl Schmitt – Plessner. Die Orientierung an philosophisch-historischen, kulturkritischen und psychologischen Diskursen (Physiognomie-Forschung, philosophische Anthropologie, Behaviorismus) zeigen auch die anderen Arbeiten Lethens zum Thema (vgl. etwa Lethen 1995a, 1997, 2009).
Stilgeschichte und Abhängigkeit von der Kunsttheorie
Neben Lethens Versuch einer ideologiekritischen Herleitung des Sachlichkeitsbegriffs wurden auch schon früh strukturelle Vergleiche von programmatischen wie literarischen Äußerungen neusachlicher Autoren vorgenommen. Dies geschah zunächst vor dem Hintergrund der Begriffsgenese, denn bekanntlich verwendete der Direktor der Mannheimer Kunsthalle Georg Friedrich Hartlaub den Begriff im Titel seiner Ausstellung „Neue Sachlichkeit, deutsche Malerei seit dem Expressionismus“ (1925), was zu seiner Verbreitung in der Publizistik führte, obwohl dieser Ausdruck schon gleich nach Ende des Ersten Weltkriegs in kunsttheoretischen Diskussionen geläufig war. Kleinster gemeinsamer Nenner innerhalb der von da an laufenden Bestimmungsversuche war die Sicht des Neusachlichen als einer im weitesten Sinne gegenständlichen, realistischen Kunst. Eine direkte Übertragung auf die Literatur erwies sich als letztlich unmöglich, obwohl immer wieder Versuche in diese Richtung gemacht wurden. Eine Wechselbeziehung von Literatur und Malerei stellte etwa Volker Klotz in einem Aufsatz her, der die Gegenstandsorientierung der neusachlichen Malerei vor allem auf den Roman übertrug (vgl. Klotz 1972).
Die literaturwissenschaftliche Erforschung der Neuen Sachlichkeit wurde von zwei Aufsätzen angeregt, die sich von Lethens materialistischem Ansatz beträchtlich unterschieden, von Horst Denklers „Sache und Stil. Die Theorie der Neuen Sachlichkeit und ihre Auswirkung auf Kunst und Dichtung“ (1968) und Karl Prümms „Neue Sachlichkeit. Anmerkungen zum Gebrauch des Begriffs in neueren literaturwissenschaftlichen Publikationen“ (1972) (zur Begriffsbildung in der Frühphase vgl. auch Petersen 1982). Prümm setzt sich an mehreren Stellen von Lethen ab: Er kritisiert einen gewissen Schematismus, die fehlende Auseinandersetzung mit den expressionistischen Vorläufern, vor allem jedoch, dass Lethens Wertung einseitig sei, das heißt, ideologische Voreingenommenheiten ihn hinderten, positive Elemente festzustellen und partiell gelungene Versuche, die wahrgenommene Wirklichkeit adäquat darzustellen, zu registrieren. Diese blinden Flecke weist Prümm dann an Lethens Analyse von Regers Industrieroman Union der festen Hand auf (Lethen 1970, 611).
Neuere Studien wie die von Becker beriefen sich auf diese frühen Arbeiten (vgl. Becker 2000a, 14). Allerdings lassen sich diese aus heutiger Sicht höchstens noch bedingt (und kaum im Sinne von Becker) mit dem Forschungsstand synchronisieren, da ihnen ein tragfähiges Moderne-Konzept und eine entsprechende Begrifflichkeit weitgehend fehlen. So wird bei Denkler die Rechts-Links-Klassifizierung unhinterfragt übernommen, entsprechend reibungslos werden die Werke von Jünger und Bronnen ebenso als neusachlich qualifiziert wie die von Renn oder Remarque. Die Frage ist jeweils, wie die zentralen neusachlichen Kriterien Sachlichkeit, Reportage/ Bericht und Zeitnähe definiert werden (vgl. Becker 2000a, 262). Zeitnähe muss auch den Werken Ernst Jüngers oder des späteren Bronnen, sogar einem Drama wie Schlageter des bereits früh zum Nationalsozialismus konvertierten Hanns Johst zugesprochen werden. Der Sachlichkeitsdiskurs zeigt sich als höchst variabel und kann ebenso von der linksliberalen Mitte, die im Allgemeinen als Kern der neusachlichen Literatengruppen wahrgenommen wird, als auch von Autoren der extremen Rechten oder Linken in Anspruch genommen werden. Wegen solcher unklarer Bestimmungen konnte der Begriff des Sachlichen leicht auch für die Zwecke der nationalkonservativen Rechten in Anspruch genommen werden. Denkler bemüht sich allerdings darum, das Sachlichkeitsparadigma zu hinterfragen und gelangt zu dem Ergebnis, dass die neusachlichen Texte (etwa von Ludwig Renn, Arnolt Bronnen oder Hans Küppers’ Gedicht „He, He! The Iron Man!“) ihrem eigenen Postulat nicht folgen und einen poetischen Überschuss in die Texte einlagern, d.h. die ästhetischen Formelemente, die im Programm der Neuen Sachlichkeit hinter Stoff, Aufklärungs- und Gebrauchswert zurücktreten sollten, ebenso aufnehmen wie psychologische Momente.
Neue Ansätze seit 1990
Der wichtigste Versuch einer Neubestimmung des Sachlichkeitsbegriffs aus dem Geist einer quellenkritischen, literaturtheoretisch fundierten Methode ging von Sabina Becker aus, die bereits durch ihre Dissertation Urbanität und Moderne. Studien zur Großstadtwahrnehmung in der deutschen Literatur 1900 – 1930 (1993) den Kontext von Expressionismus, Neuer Sachlichkeit und Urbanität erarbeitet hatte. Vor allem durch ihre zweibändige Habilitationsschrift Neue Sachlichkeit (Becker 2000a, 2000b) suchte sie ihre Grundannahmen zu belegen. Der Dokumentenband wirkte auf die weitere Forschung befruchtend, nachdem bis dato fast nur auf die ältere und nicht auf die neusachliche Strömung ausgerichtete Quellensammlung zur Literatur der Weimarer Republik von Kaes (1983) zurückgegriffen werden konnte. (Kaes u.a. gaben 1994 eine aufwändige amerikanische Quellensammlung The Weimar Republic Sourcebook heraus, vgl. Kaes/Jay/Dimendberg 1994.) Becker bereicherte die Forschung mit ihren zahlreichen Publikationen, dem mit Christoph Weiß zusammen publizierten Interpretationsband Neue Sachlichkeit im Roman (Becker/Weiß 1995) und auch mit der Herausgabe des Jahrbuchs zur Literatur der Weimarer Republik (ab 1995, ab 2001 Jahrbuch zur Kultur und Literatur der Weimarer Republik) erheblich.
Sie trennt methodologisch eindeutig zwei Begriffsverwendungen von Neue Sachlichkeit; es sei „zu unterscheiden zwischen Sachlichkeit als Devise und Modewort für zeitsymptomatische Einstellungen und Verhaltensweisen sowie allgemeinkulturelle Entwicklungen der Zwanziger Jahre auf der einen und den stilprogrammatischen Tendenzen der Neuen Sachlichkeit auf der anderen Seite“ (Becker 2003, 205).
Die Beschränkung des Fokus auf die ästhetische und poetologische Seite bei Becker riskiert eine der Sache selbst nicht gerecht werdende Verengung des Untersuchungsspektrums. Zwar vermeidet etwa die Abkoppelung des bildkünstlerischen vom literarischen Diskurs eine undifferenzierte Sicht der einzelnen Bereiche. Zugleich aber lassen sich die Effekte der neusachlichen Literatur in dieser Limitierung nur sehr grob erfassen. „In Beckers poetologischer Perspektive bleibt die Wirkung der neusachlichen Literatur […] abstrakt und normativ.“ (Barndt 2003, 7) Diese Ausrichtung hat zudem beträchtliche Folgen für die zeitliche Bestimmung der Strömung und den Geltungsbereich der Aussagen. Becker sieht die Neue Sachlichkeit als „eine dominante literarische Ästhetik“ (Becker 2000a, 14) der 1920er Jahre, will also die aus der historischen Epochenbestimmung entstandene Bindung an die Phase der relativen Stabilität aufheben. Die Verknüpfung der neusachlichen Diskurse mit anderen Diskursebenen (vor allem den neu entstandenen Medien, aber auch politisch-ideologischen Implikationen) wird zwar nicht abgestritten, in der konkreten Textuntersuchung aber bewusst ausgeblendet (kritisch dazu Fähnders 2007, 86).
In ihrer Untersuchung (Bd. 1) folgt Becker den aufgestellten Prämissen und argumentiert systematisch. Dadurch dass sie literarische Texte der Versuchsanordnung gemäß selbst kaum berücksichtigt, sondern sich auf die Analyse der theoretischen und poetologischen Zeugnisse beschränkt, wirken die Folgerungen für die Literatur zum Teil abstrakt und ohne Tiefenschärfe. In der Materialsammlung (Bd. 2) bietet sie eine für die weitere Forschung unverzichtbare Materialfülle, die aufgeführten Quellen stellen allerdings teilweise ihre eigenen Forschungsprämissen infrage, denn in den Selbstaussagen wird die Neue Sachlichkeit als ein Ensemble sehr heterogener und keinesfalls ausschließlich poetologischer Diskurse präsentiert.
Die Neue Sachlichkeit steht für Becker am Ende der literarischen Moderne, ist jedoch wegen des weitgehenden Verzichts auf experimentelle Schreibweisen nicht als Teil der historischen Avantgarden einzustufen. Sie unterliegt nicht der „Absage an die formale Kohärenz des Kunstwerks“ (Becker 2000a, 345), sondern beschreitet einen neuartigen Alternativweg der Moderne, indem sie die Funktionalisierung der Literatur als Zentrum ihres Kunstpostulats setze. Dies bedeutet im historischen Verlauf vor allem die Absetzung von den dezidiert antimimetischen Gestaltungsprinzipien des Expressionismus, ohne wiederum einem unreflektierten, platten Abbildungsrealismus zu verfallen.
Insgesamt erwachte das Interesse an der Literatur der Weimarer Zeit in den 1990er Jahren wieder. Neben den Versuchen zu einer theoretischen Abklärung des Begriffsgehalts und damit verbundener Parallelbegriffe hat es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder wichtige Einzeluntersuchungen gegeben. Diese galten zunächst ähnlich wie bei der Exilliteratur der Sammlung und Archivierung, auch der Bewahrung vor dem Vergessen, erstreckten sich aber zunehmend auch auf Einzeluntersuchungen wichtiger Werke und Autoren. Dies gilt vor allem für die neusachliche Literatur von Frauen, die in einigen aufschlussreichen Untersuchungen gewürdigt wurde, teilweise auch für die Kinder- und Jugendliteratur (vgl. Barndt 2003, Stürzer 1993, Tost 2005 u.a.). Man beschäftigte sich nun auch seriös mit bisher eher der Trivialliteratur zugeschlagenen Autoren wie Kaléko, Fallada, Remarque oder Baum, ebenfalls mit weitgehend unerforschten Genres wie dem Zeitstück.
Probleme der Periodisierung
Lethen konstruierte in Analogie zur zeitlichen Eingrenzung des Expressionismus den Begriff des „neusachliche[n] Jahrzehnt[s]“ (Lethen 1995, 10). Dies ist fragwürdig, besonders was den angenommenen Beginn angeht, denn Einigkeit besteht darüber, dass die Mehrzahl der typischen und wirkungsvollen neusachlichen Werke erst nach Mitte der 1920er Jahre veröffentlicht wurde. Höchst problematisch ist ein Abschluss mit dem Jahr 1930, denn besonders zahlreiche der wichtigen neusachlichen Romane und Gedichtbände erschienen erst danach: Falladas Kleiner Mann, was nun? (1932), Kalékos Lyrisches Stenogrammheft (1933), Keuns Kunstseidenes Mädchen oder Theodor Plieviers Der Kaiser ging, die Generäle blieben (1932). Zeitliche Fixierungen unterliegen immer ideologischen und forschungsgeschichtlichen Vorgaben. Für die Literatur der Neuen Sachlichkeit wurde meist der politische und ökonomische Bezugsrahmen angelegt, und in der Tat sind große Teile der in der republikanischen Zeit entstandenen literarischen Texte an politische Themen und Intentionen gebunden, die Zeitstücke ebenso wie die Industriereportagen oder die Kriegsliteratur. Auch zentrale politisch-soziale Veränderungsprozesse wie die Entstehung einer ausdifferenzierten Angestelltenschicht und -kultur wirkten fast ungefiltert auf die Literatur ein und führten zur Entstehung neuer Genres, etwa des Angestelltenromans. Gegenüber dem poetologischen Paradigmenwechsel der letzten beiden Jahrzehnte, der die Geltung neusachlicher Schreibweisen zeitlich eher ausdehnt, ist eine vermittelnde Sicht angemessen, die neben der Betrachtung der ästhetischen Faktoren auch berücksichtigt, dass die ökonomisch-soziale Stabilisierung ab Mitte der 1920er Jahre mit Dawesplan und Fordismus als Grundlage Impulse für den Sachlichkeitsdiskurs gab (vgl. Fähnders 1998, 234). Dies wirkt auch nach dem Einsetzen einer breiten Kritikbewegung zu Beginn der 1930er Jahre nach, teilweise bis ins Exil. Eine Wendung hin zu restaurativen, mythenfixierten oder christlichkonservativen Haltungen ist partiell vorhanden, aber nicht als dominierende Tendenz zu sehen.
Analog zu den politischen und ökonomischen Prozessen wurde für die Weimarer Republik immer wieder eine Phasenbestimmung in drei Teilen vorgenommen (so Fähnders 1998, 224):
1 Nachkriegskrise mit dem Spätexpressionismus und Dada als dominierenden Avantgardeströmungen (1919 – 23)
2 Phase der relativen Stabilisierung mit der Neuen Sachlichkeit als charakteristischer Richtung (1923 – 29)
3 Etappe der Wirtschaftskrise und der Faschisierung der Weimarer Republik ohne eine künstlerisch hegemoniale Strömung (1929 – 33)
Die Positionierung der Neuen Sachlichkeit in diesem Schema ist gerade von Sabina Becker angezweifelt worden – aus plausiblen Gründen, da neusachliche literarische Texte auch außerhalb des Zeitraums von 1923 bis 1929 in größerem Ausmaß erschienen sind, aber auch aus methodischen Erwägungen, da die Übertragung politisch-historischer Kategorien auf ästhetische Strömungen grundsätzlich problematisch erscheint. Trotzdem ist die Einteilung bis zu einem gewissen Grade brauchbar, da mit ihr die starken kulturell-politischen Bezüge abgedeckt werden und ein großer Teil der Texte erfasst werden kann.
Offene Fragen und Forschungsperspektiven
Die Beantwortung der Fragen nach den politisch-gesellschaftlichen Positionierungen der Neuen Sachlichkeit ist durch die Polarisierung und damit Vereinseitigung der Forschungsmeinungen eher verhindert worden.
Die Merkmale nüchterner Beobachtung, soldatischer Kühle, männlicher Härte und aristokratischer Distanz rückten die ,Neue Sachlichkeit‘ in die Nähe faschistischer oder präfaschistischer Thesen. Stellt man die ,Neue Sachlichkeit‘ allerdings in einen aufklärerischen Diskurs des neuen Sehens, das sozialrevolutionäre Visionen und ästhetische Avantgarde verbindet, ist von rechter Gesinnung nichts mehr zu finden. (Kimmich 2002, 167)
Zwar ist richtig, dass die heute als führend betrachteten Autoren im Umkreis der Neuen Sachlichkeit (Glaeser, Weiß, Roth, Toller, Feuchtwanger, Kisch, Graf u.a.) der linken oder linksliberalen Kultur und Subkultur entstammten. Allerdings ist auch diese Aussage zu relativieren: Zahlreiche Autoren – etwa Fallada, Keun, Baum, Kaléko – können hier nicht eingeordnet werden, sie gehören vielmehr einer politisch kaum festgelegten, primär am Massenerfolg orientierten Literatenschicht an.
Keineswegs ausreichend untersucht sind die formativen Entwicklungslinien, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Kleinschmidt weist zu Recht darauf hin, dass zwar der Begriff Sachlichkeit im Grimm’schen Wörterbuch von 1893 noch nicht auftaucht, nennt zugleich aber Voraussetzungen im Realismus und Naturalismus und formuliert die Notwendigkeit der Einbeziehung außerkünstlerischer und außerliterarischer Einflüsse für die Diskursarchäologie, etwa im Positivismus oder in medizinischen Diskursen (vgl. Kleinschmidt 2000). Eine Erweiterung der Forschungsperspektiven versprachen die diskursanalytischen und auch die kulturwissenschaftlichen und vom new historicism beeinflussten Sichtweisen, die jedoch bis heute in die literaturwissenschaftliche Untersuchung der Neuen Sachlichkeit nur gelegentlich und unsystematisch einbezogen wurden.
Nach wie vor ist trotz aller Bemühungen eine Unschärfe in der Grundbestimmung als Stilbegriff, politischer Begriff, Epoche oder Gruppenphänomen festzustellen (vgl. Fähnders 1998, 244). Der Forschung stellen sich insbesondere folgende Probleme:
die Situierung der Neuen Sachlichkeit innerhalb des politisch bestimmten Zeitraums der Weimarer Republik,
die Herkunft der Bezeichnung aus der Bildenden Kunst und das Verhältnis zur Literatur,
das Schwanken des Begriffs zwischen stilgeschichtlicher und politisch-soziologischer sowie medienhistorischer Bestimmung,
die für die künstlerische Moderne überhaupt konstitutive Frage nach dem Charakter als Epoche, Strömung oder lediglich Phase, was einen hegemonialen Anspruch ausschließen würde,
der Zusammenhang von literaturwissenschaftlicher, intermedialer und interdisziplinärer Forschung in einer kulturwissenschaftlichen Makroperspektive,
der Zusammenhang von neusachlicher Schreibform und Unterhaltungsformen,
die weitere Klärung der Position neusachlicher Literaturformen in den und zu den literarischen Moderne- und Avantgardebewegungen.