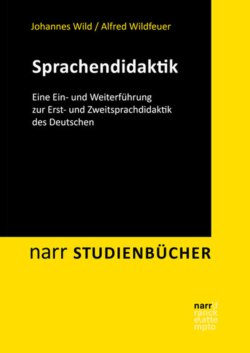Читать книгу Sprachendidaktik - Johannes Wild - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.3 Feldermodell (FM)
ОглавлениеEin Grammatikmodell, das explizit die Stellungsbesonderheiten des deutschen Satzbaus herausstellt, ist das Feldermodell (auch als Stellungsfeldermodell oder topologisches Satzmodell bezeichnet). Es wurde in Grundzügen bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Erich Drach (1937) entwickelt. Da das Deutsche über komplexe Möglichkeiten des Satzbaus verfügt und zudem im Vergleich zu anderen Sprachen wie z.B. dem Englischen eine tendenziell freiere Wortstellung aufweist, ist es sinnvoll, ein diesbezüglich adäquates Modell auch in Bezug auf den Deutschunterricht näher zu betrachten. Dies erscheint uns gerade mit Blick auf DaZ- und DaF-Lernende als hilfreich, da dieses Modell explizit auf die vielfältigen, jedoch nicht regellosen Stellungsmöglichkeiten des Deutschen fokussiert. Beim Zweit- und Fremdspracherwerb stellt diese Komplexität der Syntax eine große Herausforderung dar.
Das Feldermodell findet zudem vermehrt Eingang in den Deutschunterricht. Für das Bundesland Baden-Württemberg ist es inzwischen fest in den Bildungsplänen verankert.
Zu einer Übersicht siehe: http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/sprache/grammatik/feldermodell [Zugriff am 29.04.2018].
Für die Verwendung dieses Modells sprechen mehrere überzeugende Gründe. Doch zuerst zu den Grundlagen:
Dieses Grammatikmodell versucht, die Besonderheiten des deutschen Satzbaus zu beschreiben. Zu diesen zählen, dass das Deutsche durch eine diskontinuierliche Anordnung des Prädikats ausgeprägte Satzklammern (auch Verbklammern genannt) bilden kann. Darüber hinaus – die Syntax wird dadurch noch komplexer – kennt das Deutsche drei verschiedene Positionen des finiten Verbs.
Unter Satz- bzw. Verbklammer versteht man die diskontinuierliche Anordnung von Bestandteilen des Prädikats vor allem im Aussagesatz. Diese Fähigkeit des Deutschen entstand im Laufe seiner Geschichte parallel zur Ausdehnung der Schriftlichkeit vor allem in der Epoche des Frühneuhochdeutschen. Beispiele für die Satzklammer sind Sätze wie Donald hatte, bevor er zum Kartenspielen ging, noch schnell Kleingeld auf der Bank wechseln lassen. Die unterstrichenen Bestandteile des Prädikats kennzeichnen die linke respektive rechte Klammer. Neben verbalen Elementen können im Nebensatz auch einleitende Subjunktionen klammeröffnende Elemente darstellen (die Teile der Satzklammer im Nebensatz sind wiederum unterstrichen): Paul sagte seinem Lebenspartner nicht, dass er erst nach 24 Uhr nach Hause kommen würde.
Das Deutsche kennt drei verschiedene Verbstellungstypen, d.h. Positionen des finiten Verbs im Satz. Es gibt Sätze mit Verberststellung (V1), Verbzweitstellung (V2) und Verbendstellung (VLETZT). Diese Anordnung der finiten Verben im Satz ist jedoch nicht beliebig, sondern steht in enger Verbindung mit der jeweiligen Satzart (Aussage-, Frage-, Imperativsatz) und Satzform (Satzreihe, Satzgefüge). Zusammengefasst und vereinfacht dargestellt gilt im Normalfall folgende Verteilung: Imperativ- und Entscheidungsfragesätze haben V1, Aussagesätze und Ergänzungsfragen V2, eingeleitete Nebensätze VLETZT. Hierzu einige Beispiele:
| Gib mir bitte den Stift. | (V1, Imperativsatz) |
| Kommst du heute Abend mit ins Kino? | (V1, Entscheidungsfrage) |
| Nariman kommt aus Hannover. | (V2, Aussagesatz) |
| Woher kommt Nariman? | (V2, Ergänzungsfrage) |
| Nariman dient als Bundeswehrsoldatin, was ihr viel Respekt in ihrer Familie einbrachte. | (VLETZT, eingeleiteter Nebensatz) |
Um die Satzklammer herum bestehen im deutschen Satz verschiedene Felder (daher auch der Name dieses Modells), die unterschiedlich gefüllt sein können. Einen Überblick hierzu gibt folgende Tabelle:
| Vorfeld (VoF) | linke Klammer (li. Kl.) | Mittelfeld (MiF) | rechte Klammer (re. Kl.) | Nachfeld (NaF ) |
| Die Lehrerin | hat | uns Erfolg | gewünscht | bei der Arbeit |
| Die Lehrerin | hat | uns bei der Arbeit Erfolg | gewünscht | |
| Bei der Arbeit | hat | uns die Lehrerin Erfolg | gewünscht |
Tab. 3.3:
Feldgliederung des deutschen Satzes
Diese in der Tabelle dargestellten Felder – also mögliche Positionen für verschiedene Satzglieder – können nicht beliebig gefüllt werden. So können das Subjekt und Objekte nicht in das Nachfeld verschoben werden, Angaben (adverbiale Bestimmungen) dagegen schon:
Nariman hatte nach ihrem Dienstwochenende ein Kino besucht in Hannover.
*Gerade hat Jesper getroffen Xaver.
Zudem darf – von wenigen Ausnahmen abgesehen – vor dem finiten Teil des Verbs immer nur ein Satzglied stehen.
Jesper hat Xaver in der Schule getroffen.
*In der Schule Jesper hat Xaver getroffen.
Ausnahmen davon, d.h. Mehrfachbesetzungen des Vorfelds, tauchen jedoch durchaus in der gesprochenen Sprache auf und sind nicht immer als ungrammatisch zu bewerten. In einzelnen Varietäten des Deutschen treten sie sogar gehäuft auf und sind innerhalb des Systems der entsprechenden Varietät als zweifelsfrei grammatisch zu bewerten. Folgendes Beispiel stammt aus dem Kiezdeutsch (nach Wiese 2012, 81):
Danach ich ruf dich an.
Angaben (adverbiale Bestimmungen), die als Satz realisiert sind, rücken in der Regel ins Vor- oder Nachfeld. Das Mittelfeld wird somit entlastet:
| ▶ | Er | hatte | nichts | gesagt, | weil … |
| VoF | li. Kl. | MiF | re. Kl. | NaF |
Das Feldermodell setzt sich neben der Anordnung der einzelnen Satzglieder im Rahmen der vom Satz gebildeten Felder auch mit der Anordnung einzelner Elemente innerhalb eines Feldes auseinander. Dies ist vor allem bei komplexen Prädikaten in Bezug auf die Reihung der Elemente in der rechten Satzklammer betrachtenswert. Hierzu ein paar Beispiele:
Ibrahim wird um diese Zeit schon in die Schule gegangen sein.
Stefan hätte den Kinofilm nicht gesehen haben müssen.
Die diesbezüglichen Regeln der Stellung der einzelnen Elemente in der rechten Satzklammer sind komplex und sollen hier nicht im Einzelnen vorgestellt werden. Wichtig ist uns hier nur herauszustellen, dass auch diese Anordnung nicht willkürlich abläuft. Eine Übersicht zu den Stellungsregeln findet sich in der DUDEN-GRAMMATIK (2016, 871ff).