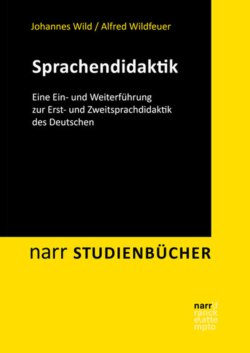Читать книгу Sprachendidaktik - Johannes Wild - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Sprachkompetenz entwickeln
ОглавлениеAlfred Wildfeuer, Johannes Wild
Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie, …
welche Areale unseres Gehirns für Sprache zuständig sind.
welche Vorteile Mehrsprachigkeit hat.
ob es einen Unterschied macht, ob zwei oder mehr Sprachen in früheren Lebensjahren erworben werden.
welche Erwartungen wir an „Sprachkompetenz“ haben.
wie man sich dem Begriff „Sprachkompetenz“ nähern kann und welche Teilaspekte davon die Sprachendidaktik in den Blick nimmt.
wie Ideologien unsere Bewertung von Sprache prägen können.
Sprache ist zentraler Gegenstand und Medium von Bildung (vgl. Feilke 2012, 4): Das sprachliche Universum ist, auch nach dem postulierten Ende des Buchzeitalters (vgl. McLuhan 2011, 362), Gegenstand des Deutschunterrichts. Doch wie funktioniert Sprache eigentlich in unserem Kopf? Was bedeutet es, (k)ein kompetenter Sprecher zu sein? Schon diese beiden Fragen zeigen, dass verschiedene Disziplinen (hier z.B. kognitive Linguistik, Bildungsforschung) unterschiedliche Fragestellungen und Forschungsinteressen verfolgen, wenn sie sich mit Sprachkompetenz auseinandersetzen. Eine einheitliche Definition dieses Begriffs liegt bislang noch nicht vor (vgl. Jude 2008, 10f).
Trotz unterschiedlicher Erkenntnisinteressen und einer heterogenen Datenlage steht (immerhin) fest, dass es sich beim Erwerb von Sprachkompetenz um einen lebenslangen Lernprozess handelt, in dem sich Individuen die Charakteristika von Sprache(n) aneignen (vgl. Jude 2008, 10). Die Redewendung „man lernt nie aus“ trifft also auch auf Sprache zu. Was wir unter Sprachkompetenz verstehen, zeigen für das Deutsche dieses und die folgenden Kapitel.
Erwerb bedeutet (die häufig ungesteuerte) Sprachaneignung durch „modellhafte Sprachverwendung in möglichst authentischen und für die Schüler/innen bedeutsamen Situationen […], in denen sprachliche Strategien und Mittel für die Lösung konkreter Aufgaben eingesetzt werden“ (Vollmer & Thürmann 2013, 51). Lernen dagegen bedeutet das systematische und reflektierte Einüben, die gesteuerte Sprachaneignung. Beides – Erwerb und Lernen – sind zentral für den Aufbau von Sprachkompetenz.
Nähern wir uns dem Ausdruck Sprachkompetenz zunächst aus entwicklungsbiologischer Sicht: Um eine Sprache zu erwerben oder zu lernen – im Folgenden werden wir diesbezüglich nicht unterscheiden –, müssen wir Erfahrungen machen (zum Verlauf des Spracherwerbs vgl. Kapitel 06), auf deren Grundlage wir uns sprachliche Kenntnisse aneignen, wie zum Beispiel, dass Sessel im Deutschen ein spezifisches Möbelstück benennt, im Englischen aber dafür chair steht.
Wie in Saussures bilateralem Zeichenmodell werden Wortform (Signifikant) und Wortbedeutung (Signifikat) im Gedächtnis zwar getrennt gespeichert, sind jedoch vernetzt. Ein gutes Beispiel hierfür ist, wenn uns etwas „auf der Zunge liegt“: Hier haben wir Zugriff auf die Bedeutung (Inhalt), aber uns fehlt die entsprechende Form, um den Inhalt auszudrücken (vgl. Schwarz 2008, 106). Lesenswert zur Beziehung von Bedeutung und Form ist zudem Peter Bichsels Geschichte „Ein Tisch ist ein Tisch“.
Abb. 2.1:
Ferdinand de Saussures Zeichenmodell. Ein sprachliches Zeichen besteht aus der arbiträren Verknüpfung von Signifikant (Ausdruck/Bezeichnendes) und Signifikat (Konzept/Bezeichnetes)
Zudem eignen wir uns abstrakte (Regel-)Systeme an, wie zum Beispiel die Phoneme oder die Grammatik einer Sprache. Sprachenlerner bauen ihre Kompetenz dahingehend aus, dass sie Sätze wie er lachte als richtig, Sätze wie *sie gehte als falsch bewerten können (vgl. Kapitel 04).
Erwerben wir diese Kenntnisse nicht, sind wir nicht in der Lage, an der Kommunikation und Kultur einer Sprachgemeinschaft teilzunehmen.
Einerseits referiert der Begriff [Sprachkompetenz also] auf Sprachkönnen in dem Sinne, dass eine bestimmte Sprache verwendet werden kann, andererseits kann Sprachkompetenz auch als Voraussetzung und Instrumentarium zur Aneignung von neuem Wissen angesehen werden (Jude & Klieme 2007, 11).
Sprachkompetenz umfasst, was von einem kompetenten Sprecher erwartet wird und welche Abweichungen davon akzeptiert werden können: Ist Gib mir mal den Butter! in Ihren Augen akzeptabel? Wenn nicht, warum? Wenn ja, in welchem Kontext? Wie sieht es mit Lassma Viktoriapark gehen, Lan! aus? Wie begründen Sie Ihre Meinung? Auch wenn Sie vielleicht Zweifel hegen: Beide Äußerungen sind in verschiedenen Sprachgemeinschaften des Deutschen alltäglich und angemessen. In Teilen Süddeutschlands und Österreichs kommt Millionen von Sprecherinnen und Sprechern nur der Butter auf die Breze (vgl. Möller & Elspaß 2008), im Ethnolekt Kiezdeutsch deutscher Großstädte sind lassma und Lan weit verbreitete und akzeptierte Ausdrücke (vgl. Wiese 2010). Damit wird deutlich: Nicht nur die Erwartungen an einen kompetenten Sprecher sind von der sprachlichen Umgebung, von der jeweiligen Sprachgemeinschaft abhängig, sondern auch der Erwerb von Kompetenzen; denn das Datenmaterial, an dem wir Kompetenzen erwerben, ist die Sprache, die uns umgibt: Es ist das „Sprachmaterial“, mit dem wir alltäglich konfrontiert werden. Vor allem mittels sprachstatistischer Lernmechanismen wird es analysiert, abstrahiert, systematisiert und im Gedächtnis verankert (vgl. Schwarz 2008, 143; vgl. Kapitel 03 und 06). Vorausgesetzt, wir bringen das biologische Vermögen dafür mit, Sprache wahrzunehmen und zu produzieren.
Theoretisch könnten wir wohl auch (wie es z.B. Hunde und Katzen tun) über Düfte o.Ä. kommunizieren. Allerdings wären wir so vermutlich etwas schweigsam! Die biologischen Voraussetzungen bringen wir nämlich nicht ausreichend mit: Unser Geruchssinn ist viel zu schlecht.
Sprachkompetenz ermöglicht es uns darüber hinaus, mit unvollständigem Sprachmaterial umgehen zu können. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Ihrem Obst- und Gemüsehändler. Weil Sie vielleicht ein wortkarger (oder sagen wir sprachökonomischer) Mensch sind, sagen Sie nur: Fünf rote Äpfel! Nun geschieht etwas ganz Wunderbares: Sie müssen nicht die Äpfel selbst entnehmen, abwiegen, mit einem Preis versehen etc., sondern all das macht der Verkäufer für Sie. Warum ist das möglich? Sie haben nicht nur eine Äußerung von sich gegeben, sondern eine komplexe sprachliche Handlung, einen Sprechakt vollzogen. Der Verkäufer hat daraufhin nicht nur den physikalisch hör- und messbaren Lautstrom analysiert und fehlende Elemente (z.B. Ich hätte gerne) gedanklich ergänzt, sondern auch aufgrund des Kontextes (hier: Einkauf) interpretiert: Er ist davon ausgegangen, dass Sie ihm nicht einfach sagen wollten, dass dort fünf rote Äpfel liegen, sondern dass Sie diese erwerben möchten (Verkaufe mir bitte fünf rote Äpfel!) (Beispiel n. Schlobinski 2014, 69; vgl. auch Kapitel 07).
Zweifellos sind Sprachkompetenz und ihre Teilkompetenzen der Schlüssel zu schulischem und außerschulischem Lernen, sie „sind grundlegend für Lernprozesse, sie beeinflussen in Form von Lese-, Schreib- und Gesprächsfähigkeiten Bildungsprozesse im Allgemeinen“ (Schilcher 2015, 6).