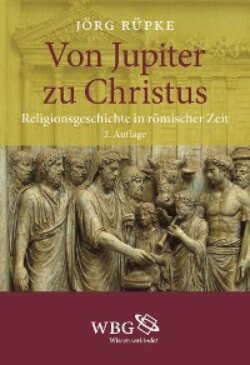Читать книгу Von Jupiter zu Christus - Jorg Rupke - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Die Strategie des Visionenbuches
ОглавлениеIch habe das Visionenbuch bislang immer durch die Vogelschau beziehungsweise den Rückblick, nach Ende der Lektüre, perspektiviert. Der Text ändert seinen Charakter aber merklich, wenn man ihn sequenziell analysiert und so die Erfahrung des Ersthörers zu rekonstruieren versucht. Die Strategie des Visionenbuches ist der Strategie der pseudonymen Apokalypsen diametral entgegengesetzt. Wo sich jene Texte durch einen möglichst hochrangigen Visionär legitimieren und Ereignisse universalen Ausmaßes zum Thema machen, wählt Hermas einen radikal autobiographischen Ansatz, kontextualisiert den visionären Ich-Erzähler sogar primär durch negative Momente. Der Text beginnt als Schuldbekenntnis eines ehemaligen Sklaven35 und erhebt erst im Verlaufe stetig zunehmenden apokalyptischen Anspruch.
In Anbetracht des Textumfangs werde ich nur skizzenhaft einige Linien herausheben. Ich beginne mit dem Verhältnis von proprium beziehungsweise, hinsichtlich der Familie des Hermas, commune zum publicum beziehungsweise universale in der Terminologie des Macrobius. Inhaltlich betreffen die Visionen zunächst allein den Visionär, Hermas, und seine Verfehlungen. Erst durch die Erscheinung der Greisin werden die Vorwürfe auf die Familie, Hermas eingeschlossen, also commune, ausgedehnt. Gegen Ende dieser Vision rezitiert die Greisin einen Text, der die gesamte Menschheit, Christen wie Nichtchristen, betrifft (4,2), doch wird der damit gegebene Bezug nicht in eine Handlungsanweisung umgesetzt, Hermas solle in Hinblick auf diese Gruppe tätig werden. Entsprechend vergeht ein ganzes Jahr, für das keine Aktivität des Hermas berichtet wird. Erst mit der zweiten Erscheinung der Greisin, nun aber bereits als Gesprächseröffnung, erhält Hermas den Auftrag, den Auserwählten Gottes (5,3) himmlische Texte zu übermitteln: Der Inhalt der Offenbarungen ist nun ein publicum; der Rhythmus der Visionen, Auditionen und intuitiven Offenbarungen beschleunigt sich stark, sie bilden lediglich noch Retardierungen der Publikation des Grundtextes (6,2 – 7,4). Auch in diesem nimmt das commune, nehmen die Familienangelegenheiten des Hermas großen Raum ein.
Mein bisheriger Umgang mit dem Wort „Vision“ verdeckt die semantische Strategie des Visionenbuches. Festzuhalten ist zunächst, dass ein die Gattung offenbarender Werktitel fehlt; eine Zwischenüberschrift (die an anderen Stellen freilich in ihrer Authentizität umstritten sind) fehlt für den Textbeginn. Hermas schildert die beiden Visionen der ersten Entrückung mit ganz neutralen, alltäglichen Begriffen: zunächst „sehen“ (1,4 f.; 2,2), dann auch „hören“ (dreimal in 3,3). Erst im Rückblick des Folgejahres wird dieses Ereignis mit hórasis bezeichnet (5,1).
Das Wort „Apokalypse“ ist aber immer noch nicht gefallen. Es fällt, in der Chronologie der Erzählung, erst zwei Wochen später. Gegenstand der zweiten Vision der Greisin war die zeitweilige Übergabe eines Schriftstücks zu Kopierzwecken; „nimm“ (5,4) bringt ein haptisches Element in die Vision hinein. Hermas schrieb den Text, den man sich in Scriptio continua vorstellen muss, ab, ohne ihn durch Silben- und Wortbildung zu verstehen: Hermas schreibt Buchstabe für Buchstabe (5,4); er kann den Text nicht lesen, mitsprechen. Erst auf fünfzehntägiges Fasten und Beten hin wird er dazu in die Lage versetzt – genau das wird als „Offenbarung“ bezeichnet (6,1). Der Begriff bleibt aber noch selten; er wird im nun verständlichen Text einmal, auf Hermas bezogen, verwendet (6,4) und nochmals für die unmittelbar folgende Vision (8,1), noch immer nur in Verbform. Das Substantiv zur Bezeichnung eines Offenbarungsinhalts tritt erstmalig dort auf, wo Hermas beginnt, um das „Nachtragsgesicht“ zu beten (9,2). Innerhalb des Deutungsdialogs in den Salzgärten (siehe unten) gibt es dann zwei Passagen, in denen Substantiv und Verb zunächst sieben-, dann viermal in wenigen Sätzen verwendet werden. Das Thema dieser Passagen ist unter der von mir verfolgten Perspektive bezeichnend: Es geht um die Begrenztheit der Hermas zugestandenen Deutungen (11,2 – 4) und die eigentlich nicht vorhandene Würde des Hermas, überhaupt solche Deutungen zu empfangen (12,3): Apokalypse ist, analog zum erwähnten Kopiervorgang, die erst zum Verständnis führende Deutung der geschauten Bilder. Als Zwischenüberschrift erscheint, das sei abschließend erwähnt, „Apokalypse“ erst für die so genannte fünfte Vision (vor 25,1); damit wird entweder ein klares Rezeptionszeugnis oder aber eine Bestätigung der Strategie des Hermas geliefert.
Berücksichtigt man außer der Terminologie auch die Nebenumstände der „Visionen“, ergibt sich ein Beginn der Schauungen, der im Tagtraum erfolgt und inhaltlich Berührungen mit der als insomnium disqualifizierten Traumarbeit des Macrobius und den visa des Halbschlafs aufweist. Diesem Bild folgt die Greisin, ein oraculum im technischen Sinn. Im folgenden Jahr folgt zunächst eine visio, die keiner Deutung bedarf: die lesende Greisin. Das Verständnis des nicht interpunktierten Textes erfolgt verzögert, aber intuitiv, nicht durch Deutung im technischen Sinne. Erst im Nachhinein werden die Erscheinungen kompliziert: In der Erscheinung eines jungen Mannes erfährt Hermas, dass er deutungsbedürftige Elemente der Schauungen, nämlich die Identität der Offenbarenden, gar nicht als solche erkannt hat: Dieser Enthüllung folgt unmittelbar die (nachträgliche) Deutung der somnia. Erst in der insgesamt vierten Erscheinung der Greisin ergibt sich ein direkter Wechsel von Schauung und Deutung, der – mit leichten Komplikationen in Form von zunächst verweigerten Deutungen – dann fortgesetzt wird.
Der Wechsel der Offenbarungsträger36 führt zu einem weiteren Punkt: Das Missverständnis der offenbarenden Greisin als Sibylle37 ist keineswegs „‚belangloser Firnis und Tribut an zeitgenössische Vorstellungen‘, die das ‚italienische Lokalkolorit‘ in die vis I–IV eingebracht haben“,38 sondern Teil eines Prozesses, der das ganze Visionenbuch betrifft. Die Offenbarungsgestalt der (eigentlich nur zunächst) Greisin ist bewusst auf der Folie der Sibylle gezeichnet: Hermas ist auf dem Weg nach Cumae, dem berühmten Sibyllensitz; auch die Sibylle ist eine jahrhundertealte Greisin, die mit schriftlichen Offenbarungen umgeht. Entscheidend ist aber die ständige Verjüngung der Gesprächspartnerin des Hermas: Dieser Prozess, dieses ungewöhnliche Bild, ist allein als Polemik gegen die uralte, aber eben auch alternde Sibylle verständlich, wie sie etwa Ovid in seinen „Metamorphosen“ so eindringlich gezeichnet hat (Ov. met. 14,129 – 153): die Greisin, die mehr und mehr schwindet, bis sie zur bloßen Stimme werden wird. Der blinkende Stab, mit dem die Ekklesía in der Zentralvision auf dem Dinkelacker den Turmbau vor Hermas erstehen lässt (10,4), ist die virga aurea, der goldene Zweig, den die Sibylle in der „Aeneis“ gegenüber dem Charon zur Erzwingung der Überfahrt einsetzt (Verg. Aen. 6,406). Auch die sonst unverständliche Ermahnung der Sibylle-Ekklesia am Ende der ersten Erscheinung, „Sei ein Mann“, entspricht inhaltlich der Ermahnung der Sibylle an Aeneas (Ov. met. 14,110; Verg. Aen. 6,95) und dürfte dem Kontext nach auch daher stammen. Dieses Zitat aus dem Gedächtnis könnte dann in der Formulierung durch den (aber längeren) Abschiedsgruß in 1 Ko 16,13 geprägt sein. Auch die „an Autolykus“ gerichtete Apologie des Theophilus (um 180 n. Chr.) enthält ein langes Sibyllenzitat (2,3); die hexametrischen Sibyllinen werden für Juden und Christen zu einem Medium, gerade gehobene Bildungsschichten anzusprechen.
Noch zwei weitere „prozessuale“ Elemente möchte ich hier anschließen, die bislang unverstanden geblieben sind oder als Exotika marginalisiert wurden. Auffällig ist der Wechsel der Offenbarungsorte.39 Auf zwei Visionen „auf dem Weg nach Cumae“40 folgen, nach Zwischenspielen im Haus des Hermas, zwei Visionen in den Salzgärten des Hermas und auf dem Weg zu seinem eventuell damit identischen, abseits der Via Campana gelegenen „Acker“.41 Berücksichtigt man die autobiographischen Elemente des Visionenbuches, liegt es nahe, hier einen Fortschritt im religiösen Sinne auf der Ebene des Berufes zu sehen. In das ferne Cumae ist der Händler, und damit zwangsweise windige Geschäftsmann, Hermas unterwegs. Zu seinem Salzgarten geht der (zwangsweise redliche) Handwerker und Salinenbetreiber oder -pächter Hermas. Die konkrete Topographie rückt an das Lebensumfeld heran: Rom verlässt auf der Via Campana ein in Trastevere ansässiger Römer, eine Lokalisierung des Hermas, die auch dem Tiberbad entspricht. Unter der Perspektive der Schwerpunktverlagerung in der Tätigkeit vom Händler zum Handwerker gewinnt auch die Lokalisierung des Turmbaus, der Vollendung der Kirche in Arkadien, im Hirtenbuch (78,4) ihren Sinn: Arkadien bezeichnet hier prägnant die ländliche Welt im Gegensatz zur Stadt, wenn auch unter der mit dem Hirtenbuch gegebenen Verschiebung von der bäuerlichen zur Hirtenwelt. In Anbetracht der literarischen Präsenz der Bukolik – der Rückgriff auf vergilianisches Gedankengut ist evident,42 auch wenn Hermas hier ebenfalls auf spezifisch christliche Traditionen der Bevorzugung des Ländlichen aufbaut – kann man diese Verschiebung als organische Weiterentwicklung des Visionenbuches bezeichnen: Zentrale Motive der früheren Schrift werden beibehalten, aber ihre nähere Gestaltung orientiert sich eher an Texten denn an Hermas’ Biographie, was Hermas als Verfasser des zweiten Teils keineswegs ausschließt.
Das letzte Element: Die Aussage innerhalb der ersten Vision, Hermas habe Rhode immer „wie eine Göttin“ geschätzt (1,7) charakterisiert Hermas ebenso wie der Sibyllenglaube bewusst als noch in seinem nichtchristlichen kulturellen Hintergrund verhaftet. Das Wort steht keineswegs isoliert. In der Schlussvision des Tieres wird es erneut aufgegriffen: Hermas charakterisiert das erst unklar Wahrgenommene spontan als „etwas Göttliches“ (22,6). Nicht nur die Schlussstellung im Text verleiht der Begegnung, und damit ihrer Eröffnung, so starkes Gewicht: Das Tier soll, wie die erscheinende Jungfrau sagt, allen Adressaten als Bild der kommenden Bedrängnis dienen (23,5). Das Tier charakterisiert den Moment erneuten und starken Zweifels, der erst durch die bewusste Reflexion auf die vorangegangene Audition überwunden wird: Hermas geht mutig dicht am Tier vorbei – und dieses bleibt regungslos liegen.