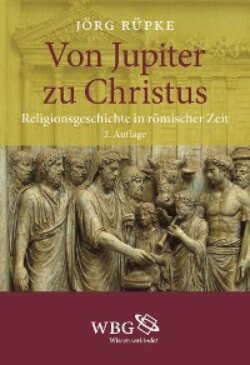Читать книгу Von Jupiter zu Christus - Jorg Rupke - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Die Bilderwelt
ОглавлениеHermas stellt sich nicht als religiöses Genie dar, den plötzliche göttliche Offenbarung zur Autorität über die christliche Gemeinde erhoben hat, sondern als einfachen Zeitgenossen, der selbst nicht recht versteht, was er sieht und hört, und damit ein umso unverfänglicherer Zeuge des Geschehenen und von niemandem Überprüfbaren ist. Um so mehr stellt sich aber damit die Frage nach dem Bildmaterial der zentralen Turmbauvision: Zerstört Hermas den mit aufwendigen literarischen (und wohl auch pragmatischen) Strategien produzierten Eindruck durch exotisches, aus erlesenen und uns nicht mehr zugänglichen Quellen stammendes Bildmaterial, das die Zuhörerinnen und Leser gerade nicht „dort abholt, wo sie stehen“, wie die rhetorische Grundregel lautet? Oder kann Hermas auch hier – allem Augenschein moderner Rezipienten zum Trotz – bei stadtrömischen Alltagserfahrungen ansetzen, die einsichtige Bilder produzieren, die für einen solchen Hermas glaubwürdig sind und erst in jeweils zweiten Schritten in expliziten Interpretationen auf die Aussageabsicht hin allegorisiert werden?
Das zentrale Element der Bilderwelt des „Hirten“ ist der in der dritten Vision und dem neunten Gleichnis geschilderte Bau eines Turms aus weißen Steinen. Die Interpretation des Bildes auf der theologischen Ebene ist eindeutig, sie wird von den Offenbarungsträgern, die jeweils gemeinsam mit Hermas den dramatischen Bildern beiwohnen und sie für ihn auslegen, explizit vorgegeben: Es handelt sich um die Auferbauung der christlichen Gemeinde. Von dieser theologischen Ebene wird im Rahmen meines Versuchs einer sozialgeschichtlichen, und dadurch vermittelt religionsgeschichtlichen Positionsbestimmung des Werkes im Folgenden völlig abgesehen. Ich konzentriere mich allein auf das Bildmaterial.
Die Turmbauvision ereignet sich in einer in der Nacht zuvor angekündigten Vision, für die Hermas den Auftrag erhalten hat, auf ein von ihm genutztes Landstück zu gehen: ἐλϑὲ ἐις τὸν ἀγρὸν ὅποu χονδρίzεις (9,2), gemeinhin als „Acker, auf dem du Dinkel baust“, verstanden. Nach einem längeren Dialog über Vorrechte verschiedener christlicher Personengruppen führt die weibliche Offenbarungsgeberin – mittlerweile für Hermas als Ekklesia identifiziert – mit einer an Vergils goldenen Zweig gemahnenden (und wohl auch davon inspirierten) leuchtenden Rute die Vision herbei, die Hermas nach anfänglichen Schwierigkeiten, das Bild zu sehen, auch wahrnimmt:
(10,4) Sie sagt zu mir: „Siehe doch, da! siehst du denn nicht vor dir einen gewaltigen Turm, der über dem Wasser errichtet wird aus weißglänzenden viereckigen Steinen?“ (5) Im Viereck wurde (tatsächlich) der Turm gebaut von den sechs Jünglingen, die mit ihr gekommen waren. Tausende von anderen Männern trugen Steine herzu – bald aus der Tiefe, bald vom Lande – und gaben sie den sechs Jünglingen. (6) Diese nahmen sie und bauten; die aus der Tiefe heraufgezogenen Steine setzten sie alle, wie sie waren, in den Bau. Denn sie waren behauen und passten an den Rändern auf die anderen Steine; und sie verbanden sich so gut miteinander, dass die Fugen zwischen ihnen gar nicht sichtbar waren; so schien das ganze Turmgebäude wie aus einem einzigen Stein gebaut zu sein. (7) Von den anderen Steinen aber, die vom Getrockneten gebracht wurden, warfen sie manche fort, manche aber setzten sie in den Bau. Noch andere zerschlugen sie und warfen sie weit weg vom Turm. (8) Wieder andere Steine lagen in großer Zahl ringsum den Turm her, die man nicht zum Bau gebrauchen konnte; denn manche von ihnen waren zu rau, manche hatten Risse, manche Beschädigungen, noch andere waren weiß und gerundet, passten also nicht in den Bau. (9) Ich sah auch andere Steine, die weit vom Turm weggeworfen wurden und auf den Weg gerieten, aber dort nicht blieben, sondern vom Wege auf das Ödland rollten; andere fielen ins Feuer und verbrannten; andere fielen in die Nähe des Wassers, konnten sich aber nicht hineinwälzen ins Wasser und wünschten doch hineingewälzt zu werden und ins Wasser zu kommen.43
Der Text erscheint zunächst rätselhaft. Erklärt wird es auch nicht durch das Hapax legomenon χονδρίzεις (9,2), welches das Landstück qualifiziert. Dieses wird mit dem Substantiv χόνδρος in Verbindung gebracht, das seinerseits Graupen aus Weizen oder Spelt bezeichnen kann.44 Einfaches Getreide, „Dinkel“ anbauen, lautet seit M. Dibelius45 die gängige Interpretation. Für das Verständnis des Bildes ergibt sich daraus nichts. So wird die Uneinheitlichkeit des Bildes festgestellt, das sich ganz den Allegorese-Bedürfnissen unterordnet. Dibelius stellt fest, „dass die Deutung allegorischer Bilder weiterwuchernd neue Bildzüge schafft“ und glaubt, dass „Oede, Feuer und Wasser … der Deutung zulieb genannt“ werden.46 Ihm folgt N. Brox: „Die Vision enthält keine Erklärung dafür, in welches Feuer manche Steine fielen und wieso Steine ‚verbrennen‘ können, und auch nicht dafür, dass Steine in ein Wasser zu rollen wünschen. Gerade das Unverständliche in einer Vision macht die Auflösung attraktiv, die für die genannten Punkte dann in allegorischem Stil in 7,1 – 3 erfolgt …“47 Funktioniert so eine erfolgreiche Allegorie?
Eine genaue Lektüre des Textes zeigt, dass die Vision (man muss fast sagen: Projektion) fest in die reale Topographie des Ortes eingebettet ist. Neben dem Personal des sich bewegenden Bildes gehören eindeutig nur der Turm und die Steine, aus denen der Turm besteht, zur Projektion. Dagegen scheinen Wasser, Viereck, (wässrige) Tiefe und (trockene) Erde, Feuer, Weg, Ödland und „Getrocknetes“ zu den Gegebenheiten des Ortes zu gehören, auf die teilweise mit dem bestimmten Artikel verwiesen wird.
Unternimmt man diese Trennung, erhält der Ort eine erstaunlich scharfe Kontur: Es handelt sich um eine Anlage zur Meersalzgewinnung. Das salzhaltige Wasser wird in flache Becken – typischerweise Vierecke – geleitet, die zu Bearbeitungszwecken von begehbaren kleinen Dämmen – Wegen – umgeben und damit getrennt sind: In der Fläche ergeben sich Schachbrettmuster.48 Der Produktionsvorgang weist mehrere Stufen auf. Das in die „Salzgärten“ geleitete Meerwasser verdunstet; das auskristallisierende Salz wird von den Begrenzungsdämmen aus zusammengerecht, zum endgültigen Trocknen auf „Salztische“ geschaufelt und schließlich zu großen Pyramiden zusammengefegt.49 „Erntezeit“ für das Salz sind die Sommermonate. Da das Trocknen, etwa bedingt durch das Wetter, Schwierigkeiten bereiten kann, beschreibt schon Plinius ein eigentlich für Salzgärten untypisches Verfahren: Die Beschleunigung des Trocknens durch den Einsatz von Feuer, konkret durch das Aufbringen des feuchten Salzes auf brennendes Holz – das Resultat ist ein schwarzes Salz (Plin. nat. 31,81 – 83).
Ostia war in der Antike ein bekannter Produktionsort von Salz, das hier in großen Salzgärten gewonnen wurde.50 Die Via Campana, die Hermas in der vierten Vision beschreitet, um zu seinem abseits dieser Straße gelegenen Landstück zu kommen – die Übersetzung von agrós mit „Acker“ ist bereits irreführend –, führte zu den Salzfeldern nördlich des Tibers. Es ist anzunehmen, dass das für den dritten Visionskomplex aufgesuchte Landstück mit dem später lokalisierten identisch ist. Sprechen somit die Ortsschilderung selbst wie die Lokalisierung für die Deutung „Salzgarten“, löst sich auch das Problem des Hapax legomenon. Chóndros bezeichnet nämlich nicht nur Graupen, sondern auch Salzkörner und sogar Salz.51 Chondrízein bedeutet damit „Salz gewinnen“.
Den Schlüssel zur Kohärenz der Bilder stellt die Identifizierung der weißen Steine als Salzklumpen (rund) beziehungsweise Salzkristalle (eckig) dar: In reinem Zustand bildet Salz Kristalle exakt kubischer Form. Diese Hypothese lässt sich zunächst auf die vis 3 anwenden. Die Unterscheidung der Steine idealer Form, die aus der Tiefe, sprich: dem Wasser stammen, von den auf dem Trockenen vorgefundenen (10,6 – 8), die nur teilweise Verwendung finden, reflektiert den Unterschied des Idealfalls reinen Salzes, das aus der übersättigten Lösung auskristallisiert, zum typischen Verlauf der technisch realisierten Salzgewinnung, die eher zu Klumpen – das dürfte mit Chondrós gemeint sein – führen, die aus kleinen Salzkristallen zusammengebacken sind.52 Für ein Bauwerk aus Salzkristallen ist auch ein fugenloses Äußeres (so 10,6) plausibel: Plinius der Ältere beschreibt für arabische Bauwerke aus Salz, dass die Blöcke mit Wasser verkittet werden.53 Eigenschaften des Salzes erklären auch zwei weitere Elemente: Mit einem Schmelzpunkt von 801 Grad Celsius kann Salz im Feuer „verbrennen“ (10,9); der Wunsch der nicht verwendeten „Steine“ ins Wasser zu rollen (ebd.) ist ebenfalls verständlich: Sie lösen sich auf und erhalten damit eine neue Chance „aus der Tiefe gezogen zu werden“.
Das Gleichnis 9 nimmt die Turmbauvision von vis 3 wieder auf, transponiert sie aber in eine bergige Gegend. Dass hier eine Ortsangabe „Arkadien“ vorgenommen wird (78,4), hat zu vielerlei Spekulationen (bis hin zur Identifizierung des Hermas mit dem gleichnamigen griechischen Gott) geführt. Die Salzhypothese leistet auch keine Erklärung für Arkadía, vermag aber plausibel zu machen, warum Hermas die folgende Vision in eine von Rom weit entfernte Gegend legen musste: Die Bilderwelt der Salzgewinnung wird nun von der eigenen Erfahrung der Meersalzgewinnung in den Salzbergbau verschoben. So ist es ganz folgerichtig, dass Hermas seine eingeschränkte Kompetenz zu erkennen gibt, als es um die Prüfung von Steinen geht: „Ich, sagte ich, Herr, beherrsche diese Technē nicht, weder bin ich selbst Bergmann, noch vermag ich etwas davon zu wissen“ (86,1).
Zwei Elemente des Salz-Fachwissens werden in der Vision miteinander verknüpft. Der ganz weiße unter den zwölf umliegenden Bergen – der zwölfte (78,10) und in der Deutung reinste (106,1) – dürfte auf die fabelhafte Kunde reiner Salzberge zurückweisen, die etwa von Plinius mit dem – leider (was bezeichnend ist) nicht lokalisierbaren – indischen Oronenus exemplifiziert werden (Plin. nat. 31,77). Der große weiße und würfelförmige Felsen im Zentrum der Ebene (79,1) spinnt das Ideal des übergroßen reinen Salzkristalls aus. Für den Weiterbau werden dann allerdings wieder Steine aus einer nicht näher beschriebenen Wassertiefe (80,3) herangezogen; erneut wird Fugenlosigkeit am vollendeten Bau festgestellt (86,7).
In Details der Salzkunde verbleibt auch der Einbau farbiger Steine von den zwölf je andersfarbigen Bergen: Sie verlieren beim Einbau in den Turm ihre Farbe; wo es sich nicht so verhält, dient das als Ausschlusskriterium: Solche sind unbrauchbar (81,5 f.). Trotz des Wissens um das ideale Salz war vormodernes Salz typischerweise farbig: Verunreinigungen färbten es schwarz, gelb oder rot und gaben damit gleichzeitig ein Indiz für die Herkunft.54 Nichtsdestoweniger handelt es sich hier der Substanz nach um Salz.
Wenn zu einem späteren Zeitpunkt einzelne Steine des Turms ausgewechselt werden müssen und zu diesem Zweck die Verwendung von Steinen angewiesen wird, die weder aus dem Wasser noch von den Bergen kommen, sondern in einer Ebene ergraben werden (83,6 f.), spiegelt auch das eine bei Plinius zu findende, also im Groben zeitgenössische Klassifikation wider: effoditur et e terra – Kappadokien nennt er als Beispiel für diese Art der Gewinnung (Plin. nat. 31,77).
Die Verwendung von Salz als Bildmaterial hat, das ist abschließend zu betonen, Anknüpfungspunkte im neuen Testament: Im Gleichnis vom Salz, das Matthäus in der prominenten Komposition der Bergpredigt bietet.55 Die Frage, wie man das schal gewordene Salz wieder salzig machen kann, vermag der Salzfachmann Hermas bildlich wie theologisch zu beantworten: Man löse es erneut in Wasser.