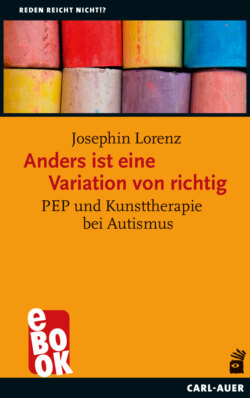Читать книгу Anders ist eine Variation von richtig - Josephin Lorenz - Страница 15
Bedürfnisse ernst nehmen
Оглавление»Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.« Dieses Zitat aus dem wunderschönen Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse gilt auch für mich in jeder Therapiestunde mit einem neuen Klienten. Mir ist es wichtig, dass er sich mit seinen Wünschen und Fähigkeiten zeigen kann. Damit er sich öffnen kann, ist es hilfreich, wenn der Therapeut achtsam mit möglichen autismusspezifischen Bedürfnissen umgeht.
Im Vorfeld einer therapeutischen Intervention ist es wichtig zu klären, welche Sinneseindrücke im Therapieraum für den Klienten Stress auslösen können, und sie ggf. zu beheben. Denn tickende Uhren, lauter Autolärm durch ein offenes Fenster oder zu helles/zu dunkles oder zu kaltes/zu warmes Licht beeinflussen seine Befindlichkeit womöglich zusätzlich.
Jeder Klient kommt mit seinen ganz individuellen Wahrnehmungen, Vorstellungen, Bildern und Sichtweisen. Insofern sollte man diese achtsam kennenlernen.
So beschwerte sich zum Beispiel eines meiner Therapiekinder, als ich die Lampe über dem Maltisch auf ein warmes, gelbliches Licht dimmte, dass er doch kein Grillhähnchen sei, das geröstet werden soll! Also stellten wir die Lichtintensität auf sein Bedürfnis ein. Ein Jugendlicher hingegen fühlte sich durch den kühleren Farbton der Lampe an die Arktis erinnert. Wenn diese modernen, verstellbaren Lampen dann kein zusätzliches Geräusch erzeugen, sind sie perfekt für eine angenehme Beleuchtung im Therapieraum.
Es kann natürlich auch passieren, dass man als Therapeut in eine Zwickmühle kommt, da ja jeder Klient unterschiedliche Bedürfnisse haben kann.
Zum Beispiel hat sich ein junger Klient zur Weihnachtszeit bei mir beschwert, dass der Therapieraum ja überhaupt nicht weihnachtlich geschmückt sei. Gemeinsam bastelten wir etwas, das seinen Ansprüchen für Weihnachten genügte, und hängten es, nun beide zufrieden und beruhigt, auf. Der Jugendliche, der im Anschluss kam, war da völlig anderer Meinung. Er war von den vielen Weihnachtsaktivitäten restlos überfordert und drohte nun schon beim Anblick des Weihnachtsschmuckes und der Kerze, in Panik zu geraten. Nun kann man natürlich darauf hinweisen, dass es doch möglich sein muss, unterschiedliche Geschmäcker zu akzeptieren. Doch gerade bei autistischen Menschen kann die Wahrnehmung durch bestimmte Reize so überfordert sein, dass einfach kein Gefühl von Sicherheit aufkommen kann.
Eine für den Klienten angenehme Umgebung bildet auch eine gute Grundlage zur wertvollen Zusammenarbeit. Da die Empfindlichkeiten bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum sehr unterschiedlich sind, gilt es hier sensibel nachzufragen bzw. selbst achtsam auf möglicherweise überfordernde Sinneseindrücke zu sein.
Frau Preißmann (2007) beschreibt dies aus ihrer persönlichen Erfahrung:
»Abgelenkt haben mich lange Zeit die Bücher (meiner Therapeutin), die in zwei Regalen stehen. Anfangs hat sie sie oft umgeräumt, was mich immer sehr irritiert hat. Mittlerweile macht sie das zum Glück nur noch selten. Die zwei Bilder, die ich von meinem Sessel aus sehen kann, hängen manchmal schief, was mich ebenfalls irritiert. (…) Wir scheinen oft so sehr in uns versunken, aber wir registrieren sehr genau, was um uns herum geschieht. Viel zu genau vielleicht.«
Viele Kinder und besonders die Jugendlichen kommen mit einem unsicheren Gefühl zur ersten Therapiestunde. Oft steckt eine Angst dahinter, was wohl von ihnen verlangt wird. Auf ihre eigene Art und nach ihren Möglichkeiten suchen auch sie nach einem Gefühl von Verbundenheit. Wenn sie merken, dass ich zum Beispiel ihre Spezialinteressen aufgreife oder auf bestimmte Dinge verzichte, die sie nicht leisten können, nehme ich einen ersten »Funken« von Aufeinander-Zugehen und In-Verbindung-Treten wahr.
Jeder von uns weiß, dass wir in einer unbekannten Umgebung oder Situation innerlich wieder ruhiger werden, wenn wir spüren, dass wir wohlwollend aufgenommen werden. In diesem Zustand wird in unserem Gehirn das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Dieser Botenstoff beruhigt die Amygdala – das Angstzentrum des Gehirns. Anders ausgedrückt: Das Gefühl von Verbundenheit schafft die Voraussetzung für angstfreies, kreativ-entspanntes Handeln. Über das Teilen von positiven Erfahrungen gelingt dann leicht der Einstieg in eine gute Beziehung, die ja als maßgeblich für eine gelingende Therapie angesehen wird.
Ich erkläre daher am Anfang immer, was wir zusammen machen könnten. Über Zeichnen und Malen, Plastizieren, Fotos machen, Filme erstellen oder … oder … oder … – der Kreativität sind bei mir (fast!) keine Grenzen gesetzt. Ich erkläre den Kindern, dass ich es wichtig finde herauszubekommen, worin man wirklich gut ist. Denn nur in dem, was einem Spaß macht, ist man wirklich gut. Meistens löst sich die Spannung dann schon ein wenig. Da ich von Natur aus dazu neige, zu viel zu reden, lege ich das im Erstkontakt auch immer offen und mache den Kindern Mut, mir, wenn ich zu viel rede, bitte ein Zeichen zu geben, dass ich den Mund halten soll. Dabei registriere ich dann meistens ein weiteres entspanntes Ausatmen. Je nach Art des Ausatmens spreche ich das dann schon konkreter an – wie zum Beispiel mit der Frage, ob es dem Kind öfters so geht, dass zu viel geredet wird. Wenn das der Fall ist, schaut es mir vielleicht für Bruchteile von Sekunden in die Augen, und ich sehe ein kleines bejahendes Leuchten in seinen Augen. Wenn ich keine Reaktion auf meine Frage wahrnehmen kann, erzähle ich weiter, dass ich von Natur aus sehr neugierig bin und viele Fragen stelle. Aber dass es mir auch sehr wichtig ist, dass das Kind genau überlegt, ob es mir die Frage beantworten will oder nicht.
Wichtige Aspekte für einen guten Kontakt
•Einfühlungsvermögen und Empathie: Wahrnehmung des emotionalen Zustands einer Person, auch auf manchmal noch subtile Signale, die auf unterschiedliche Grade von Regulation und Fehlregulation hinweisen
•Anliegen genau klären: Wer hat welches Problem? Was wünscht sich das Kind, was kommt von den Eltern? Was ist hilfreich? Berücksichtigung der unterschiedlichen Interaktionen zwischen Klient und Therapeut nach Steve de Shazer (s. o.)
•offene und direkte Kommunikation: klare Sprache verwenden, das heißt, auf Ironie und Floskeln verzichten, bei Verwendung von Metaphern und Redewendungen das Verständnis beim Klienten klären, Nachfragen bei Unklarheiten
•»Warum?«: widerständiges Verhalten nicht einfach als aufsässig etikettieren, sich die Mühe machen herauszufinden, was dem Verhalten zugrunde liegt; Wissen um Zustände autistischer Überlastungen mit einbeziehen
•gemeinsame Kontrolle: Entschleunigung, Zeit geben, Antworten geduldig abwarten, Sie teilen die Kontrolle mit der Person und leiten sie nach Bedarf an. Überlässt man dem autistischen Menschen in vielfältigen Situationen und Settings die Kontrolle, führt das letztlich zu mehr Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung.
•Humor: Nicht jede Überlastungsreaktion wird durch die Katastrophenbrille betrachtet. Viel hilfreicher – sowohl für das Kind als auch die Familie – ist es, wenn die Menschen im Umfeld ihren Sinn für Humor bewahren.
•Vertrauen: Es ist wesentlich, von Beginn an zuzuhören, dem Klienten mit Respekt zu begegnen und gleichzeitig die Familie als Partner anzusehen.
•Flexibilität: Wichtig ist folgende Erkenntnis. Wenn Plan A nicht funktioniert, ist es Zeit, zu Plan B überzugehen.
In der Regel ist das der Moment, wo die Kinder und die meisten Jugendlichen in eine Beziehung zu mir einsteigen können. Ich erkläre, dass ich offen bin für die unterschiedlichsten, gemeinsamen kreativen Ausdrucksformen. Auch erkläre ich gleich zu Beginn, dass ich bestimmte Sachen nicht akzeptiere. Gemalt wird zum Beispiel nicht auf meiner Hose oder auf der weißen Tapete. Möglichst schnell versuche ich, bei den Kindern und Jugendlichen herauszubekommen, welche Talente und Interessen sie mitbringen und in der Therapie zum Ausdruck bringen können oder wollen, was sie gerne machen bzw. mit mir machen möchten.
Natürlich spielen für das Gelingen der Kontaktaufnahme auch persönliche Qualitäten des Therapeuten eine große Rolle. Dabei sind emotionale Wärme, Echtheit, Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz auch für Menschen aus dem Autismus-Spektrum wichtige Kriterien. Denn auch sie erkennen sehr genau, ob sie als Persönlichkeit wohlwollend aufgenommen werden.
3Alle Namen in den Fallbeispielen sind geändert.