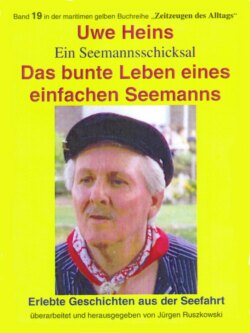Читать книгу Das bunte Leben eines einfachen Seemanns - Jürgen Ruszkowski (Hrsg.) - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAuf See – Freiheit total
Noch während der Revierfahrt auf dem Fluss, dem offenen Meer entgegen, hatte die Decksbesatzung alle Hände voll zu tun. Das Schiff musste seeklar gemacht werden, die Bäume wurden heruntergelassen, das Ladegeschirr abgetakelt und verstaut, die Luken waren nach dem Laden verschlossen worden, Persenninge verhinderten ein Eindringen von Wasser auf See.
„STECKELHÖRN“
Nachdem wir die Mündung der Gironde verlassen hatten, war es inzwischen Abend geworden Ich hatte meine Arbeit verrichtet und stand diesen ersten Abend lange an Deck an der Reling und schaute hinaus ins offene Meer.Die „STECKELHÖRN“. Ein Bild aus der Zeit, als das Schiff in Charter für eine andere Reederei fuhr, deshalb auch nicht die Original-Schornsteinmarke trägt. Auch war der weiße Außenbordsstreifen noch nicht vorhanden.
Jetzt wurde es von Tag zu Tag wärmer, man kam jeden Tag der Sonne näher. So oft ich Zeit hatte, war ich jetzt draußen an Deck und genoss den Ausblick, schaute den „Tagelöhnern“ bei der Arbeit zu und fragte wann immer es ging nach Sachen, die ich nicht verstand und die mir oftmals unbegreiflich waren.
Ich hatte das große Glück, dass der 3. Offizier auch aus Lübeck war. Dieses, so vermutete ich, veranlasste ihn des Öfteren, mir Einzelheiten des Schiffsbetriebes außerhalb meiner bis jetzt doch relativ eintönigen Aufgaben zu zeigen und auch zu erklären. So lernte ich auch den von der Decksbesatzung durchgeführten Wachbetrieb kennen, der sich im Einzelnen so abspielte:
Die 24 Stunden eines Tages teilten sich für die Decksbesatzung in drei Wachen auf: 4 bis 8 Uhr, 8 bis 12 Uhr und 12 bis 16 Uhr, danach war wieder die 4 bis 8 Uhr-Wache dran mit Wache von 16 bis 20 Uhr, dann war Wache von 20 bis 24 Uhr und von 00 bis 04 Uhr in der Nacht, diese nannte man die „Hundewache“.
Während einer vierstündigen Wachzeit, die mit zwei Mann besetzt war, ging ein Mann Ruderwache, d. h. er steuerte nach Vorgaben des diensthabenden Offiziers das Schiff. Die zweite Person verrichtete andere Sachen, wie z. B. Ausguck bei schlechter Sicht, sorgte mal für Kaffee oder bekam andere Aufgaben vom Offizier. Dieser zweite Mann löste dann nach zwei Stunden den Rudergänger am Steuer ab und die Aufgaben wechselten. Somit waren immer zwei Mann auf Wache und sorgten zusammen mit dem diensttuenden Offizier für die Sicherheit.
Der restliche Teil der Decksbesatzung wurde vom Bootsmann (an Land würde man ihn Vorarbeiter nennen) für Instandsetzungsarbeiten (meistens Rost entfernen und malen) an Deck eingeteilt. Dies waren die so genannten Tagelöhner, die von morgens um 8:00 Uhr bis nachmittags 16 Uhr Arbeiten verrichteten.
Um alle anfallenden Arbeiten, deren Ausführung bei einem Hafenaufenthalt nicht möglich waren, auf See durchzuführen, konnten auch Matrosen sowie Junggrade außerhalb ihrer Wache an Deck arbeiten. Dies nannte man „zutörnen“ (törn tau). Die anfallenden Stunden wurden dann als Überstunden abgegolten.
Bedenken muss man aber, dass diese Zusatzstunden, die außerhalb der Wache zustande kamen, auf Kosten des Schlafes gingen, denn bei den Wachgängern lagen ja nur immer acht Stunden zwischen den Wachen. So war es nur zu verständlich, dass meistens nur vier Stunden zugetörnt wurde, der Rest der Zeit ging dann für Essenszeiten und Ruhepause drauf.
Jetzt wurde es auch schon spürbar wärmer. Wer an Deck zu tun hatte, hielt sich dort nur in ganz leichter Kleidung auf, irgendwann trugen auch einige einen Tropenhelm, der an Bord zur gestellten Ausrüstung gehörte.
Ab und zu konnte man auch Schiffe beobachten. Meist waren sie aber so weit entfernt, dass man nicht einmal die Nationalität erkennen konnte.
Meine mir aufgetragenen Arbeiten machten mir inzwischen viel Spaß. Ich hatte es gelernt, so effektiv wie möglich zu arbeiten und auch die mir am Tage verbleibende Freizeit gut zu nutzen, wenngleich bei der zunehmenden Hitze immer öfter Faulenzen angesagt war.
Irgendwann, nach 16 Tagen auf See, begleiteten uns plötzlich Möwen, sie kreisten immer wieder über dem Schiff. Von Mannschaftsmitgliedern vernahm ich, dass es nicht mehr weit bis nach Dakar, dem ersten Hafen in Westafrika, sein würde. Nun kam auch bald die Küste in Sicht, aber es dauerte immer noch etwa zwölf Stunden, bis wir mit Lotsenhilfe im Hafen von Dakar anlegten.
Alles Freunde?
Sofort, nachdem das Schiff sicher am Kai lag, wurde die Gangway heruntergelassen, und die Behörden kamen an Bord, auch der Zoll erschien mit einigen Leuten.
Die Besatzung machte sich sofort daran, die Luken zu öffnen. Das Ladegeschirr musste richtig gestellt werden. Insgesamt wurde alles vorbereitet für das Löschen der für Dakar bestimmten Ladung, welches am nächsten Morgen beginnen sollte. Ich selbst hatte nach dem Anlegen nichts Besseres zu tun, als nur an der Reling zu stehen und an die Pier zu schauen.
Es war für mich einfach überwältigend, nur dunkelhäutige Leute zu sehen, z. T. doch recht ärmlich gekleidet. Am Kai war reger Betrieb. Viele Leute lungerten hier einfach nur so herum, wie es schien. Eine große, in eine Khaki-Uniform gezwängte männliche Person fiel mir irgendwann auf, die zielstrebig einen zweirädrigen kleinen Gummiwagen in die Nähe des Schiffes zog, ihn hier stehen ließ und die Gangway hoch kam.
Hier sprach er mit einem Offizier und ließ bald darauf eine Wurfleine von Deck hinunter an die Pier. Danach ging er wieder die Gangway herunter, befestigte einen Schlauch, der auf seinem Gummiwagen war, an der Leine, ging wieder an Bord und zog den Schlauch in die Höhe.
Hier schloss er den Schlauch an einer an Deck befindlichen Anschlussstelle an, ging wieder nach unten, schloss das andere Ende des Schlauches an eine Anschlussstelle an Land an und drehte dann ein Ventil auf.
Des Rätsels Lösung war denkbar einfach, es war der „Waterman“, ein schon seit Jahren in Johnson-Line-Uniform Dienst tuender Angestellter der Hafenbehörde, dessen einzige Aufgabe es war, die einlaufenden Schiffe mit Trinkwasser zu beliefern.
Am ersten Tag in Dakar war auch Postausgabe für die Besatzung. Leider war für mich noch nichts dabei, hatte ich doch wirklich noch keine Gelegenheit gehabt, meiner Mutter bzw. meinem Großvater zu schreiben und die Adresse der Reederei mitzuteilen. Dieses wollte ich aber unbedingt hier in Dakar erledigen.
Am nächsten Tag wurde es hektisch, schon vor dem Frühstück herrschte reges Treiben an Bord. Viele Schwarze kamen an Bord, bereiteten die Entladung vor, wie es schien. Viele gingen aber auch nach vorne unter die Back und tauchten erst mal nicht wieder auf. Wieder ein Rätsel? Durch einen meiner Kollegen wurde ich aufgeklärt.
Für die gesamte Lösch- und Ladezeit in Westafrika waren hier in Dakar, und das passierte jede Reise, 37 so genannte „Crew-Boys“ an Bord gekommen, 36 davon bewältigten die gesamten Lösch- und Ladegeschäfte und damit verbundene Decksarbeiten, der 37ste war der Wachmann, der, wie ich erfuhr, schon seit drei Jahren regelmäßig auf das Schiff kam. Er hatte eine Unterkunft in einem Decksraum des hinteren Windenhauses und war abends nach Arbeitsende der Arbeiter immer präsent in der Höhe der Gangway, um ungebetenen Besuch zu verhindern. Diese Maßnahmen waren schon seit Jahren hier in den Häfen so üblich.
Die Räumlichkeiten unter der Back auf dem Vorschiff, dienten für die nächsten zwei Monate als Schlafraum für die anderen Crew-Boys, hier kochten sie auch selbst. Alle Arbeiter waren nicht das erste mal hier an Bord, kannten sich mit den Gegebenheiten an Bord bestens aus und kannten auch die Besatzungsmitglieder, die nicht, wie ich, ihre erste Reise machten. Kurzum, man kannte sich.
Gesagt werden aber muss noch, dass für alle Einheimischen, die sich von nun an länger hier an Bord aufhalten würden, das Betreten der übrigen Räumlichkeiten der Besatzung streng verboten war. Warum diese Anordnung bestand, wurde mir nur zu deutlich vor Augen geführt. Ein Mannschaftsmitglied erzählte mir von abenteuerlichen Diebstählen in früheren Zeiten, und auch der Koch wusste vom Verschwinden einiger gekochter Hühner zu berichten. Wie er sagte, seien sie bestimmt nicht durch das geöffnete Bullauge der Kombüse entflogen. Auf jeden Fall war ich gewarnt. Trotzdem sollte es später zu einer seltsamen Begebenheit kommen, für die ich eine einfache Erklärung hatte.
In Dakar lagen wir nur wenige Tage. Dann ging es zum nächsten Löschhafen, vorbei an einer Anlegestelle, wo unglaublich hohe Berge von gestapelten Bettgestellen aus Metall lagen, eine nicht zu schätzende Menge. Uns wurde erzählt, dass die dreiteiligen einfachen Metallbetten schon vor Monaten hier abgeladen worden waren und für eine Hilfsorganisation bestimmt seien, aber bisher habe sich nichts getan.
Dicht unter der Küste fahrend ging es zum nächsten Hafen, Conakry, hier wurde nur kurz Station gemacht. Einen Tag lang entluden die mitfahrenden Crew-Boys die für diesen Hafen bestimmte Ladung. Auffallend war die große Anzahl von „Verwandten“ der Crew-Boys, die hier, wie auch in den folgenden Häfen, immer wieder an Bord kamen, und jeder brachte was mit, was die Angehörigen mit zu anderen Verwandten mitnehmen sollten.
Mir fiel erst hier ein unförmiges Gestell auf, welches an der Backbordseite vorne über das Vorschiff hing, eine Art flaches Zelt, was über dem Wasser schwebte, befestigt an der Verschanzung des Vorschiffes. Des Rätsels Lösung war nicht schwer zu erraten. Nachdem den ganzen Tag lang die Crew-Boys sowie alle dunkelhäutigen Besucher, die sich auf dem Schiff aufhielten, immer mal hinter den flatterigen Planen verschwunden waren und anschließend immer etwas außenbords ins Wasser plumpste, war mir schnell klar, was es war, und es hatte auch an Bord einen Namen: „Shit House“. Dass im Hafen, wenn mit Backbordseite angelegt war, jeder, der sich unten an der Pier aufhielt, alles beobachten konnte, störte hier keinen.
Am nächsten Tag waren wir schon wieder auf See, aber nur einige Stunden. Freetown war der nächste Hafen. Auch hier dasselbe Spielchen. Da hier das Löschen über zwei Tage dauerte, hatte ich das erste Mal Gelegenheit, abends an Land zu gehen, aber nicht alleine. Dies war uns von der Schiffsleitung ausdrücklich untersagt worden, und wir hielten uns dran. Viele Matrosen, die diese Reiserouten schon kannten, erzählten fast unglaubliche Storys.
Unglaublich waren auch die Eindrücke, die ich hier bei meinem ersten Landgang abends wieder mit an Bord nahm. Nichts, was an Verhältnisse in Europa erinnerte. Kam man mal von der Hauptstrasse ab, war man sofort in den Gegenden, die man besser meiden sollte. Hier war alles dunkel, und verdächtige Gestalten lungerten überall herum. Oftmals wurde man auch, da man sofort als Europäer erkannt wurde, von aufdringlichen Einheimischen nach Zigaretten gefragt. Ziel der abendlichen Ausflüge an Land waren fast immer Kneipen oder, wie man es hier nannte, Bars. Es waren primitiv eingerichtete Kaschemmen, deren Türen immer offen standen und aus denen auch immer laute Musik zu hören war.
Mein Kammerkollege und einer der Messejungen der Offiziersmesse, die mich begleiteten, brauchten eigentlich nur dem Geräuschpegel folgen, da machte man nichts verkehrt. Ausgelassenheit und Freude herrschte in solchen Bars vor, alleine die farbenfrohe Kleidung der Einheimischen und die vornehmlich jüngeren Frauen waren schon den Besuch wert. Trotzdem waren wir immer wieder froh, wenn wir an Bord zurück waren. Die paar Flaschen Bier, die wir getrunken hatten, machten uns das Einschlafen leicht.
Doch auch Freetown war nur eine kleine Episode entlang der Küste von Westafrika. Weiter ging es zum nächsten Hafen, Monrovia, einem für damalige Verhältnisse großen Hafen, aus dem Schiffe aus aller Welt Eisenerz holten. Hier pulsierte das Leben im Hafen und auch in der Stadt noch mehr als anderswo. Alles war, zumindest im Zentrum der Stadt, schon viel moderner für damalige Zeiten. Die zwei Nächte, die wir in Monrovia waren, nutzen wir fast alle für einen ausgiebigen Landgang. Zumindest die Matrosen schienen hier schon recht heimisch zu sein, denn hier, wie auch noch in einem anderen Hafen, tauchten auch nachts Frauen an Bord auf, obwohl dies verboten war.
Am Tage hatte ich dann auch mein erstes negatives Erlebnis. Nachdem ich von fliegenden Händlern geschnitzte Hartholzfiguren gekauft hatte (Zahlungsmittel waren Zigaretten), was an Deck vor sich ging, brachte ich diese in meine Kammer. Diese lag an Backbordseite, und aus meinem geöffneten Bullauge konnte ich an die Pier sehen. Als ich gerade in der Kammer war, tauchte ein schwarzer Kopf nahe der Öffnung auf und bot mir Sonnenbrillen an. So etwas war hier bei der glühenden Sonne natürlich immer zu gebrauchen, und so wechselten zwei Sonnenbrillen den Besitzer, vier Schachteln Lucky Strike wurden dafür nach draußen gelangt. Damit war der Kauf perfekt, und ich ging wieder meiner Arbeit nach. Als ich Stunden später wieder einmal in meine Kammer kam, staunte ich nicht schlecht, die Holzfiguren, die ich nahe des Bullauges deponiert hatte, waren weg. Da half kein Suchen und Schimpfen. Es war mir klar, dass der Sonnenbrillenverkäufer das offene Bullauge genutzt und die Figuren herausgefischt hatte. Also in Zukunft: Bullauge im Hafen immer geschlossen halten!
Weiteren Unmut bereitete mir manchmal der Blick morgens in die Messe. Immer, wenn ich voller Tatendrang, mitunter auch etwas unter Zeitdruck, das Frühstück vorbereiten wollte, bekam ich einen Schlag. Die Messe sah aus wie ein Schweinestall. Nachts an Bord gekommene Matrosen und Maschinenleute hatten wohl nach ausgedehnter Zechtour an Land erst noch mal so richtig gegessen und Kaffee getrunken. Natürlich war nichts wieder sauber gemacht oder gar weggeräumt worden. Da lagen benutzte Brotbretter, verschmierte Messer, halb volle Aufschnittplatten mit Wurst und Käse. Benutzte Becher mit Kaffeeresten standen auf der Back und die Butter schwamm mehr, als dass sie eine streichfähige Masse war. Brotreste und natürlich Krümel überall. Dass der Fußboden gleichermaßen sein Aussehen verändert hatte, leuchtet wohl allen ein. Zusätzlich waren überall Zigarettenkippen in unzähligen Aschenbechern verteilt.
Schnellstens musste dann von mir alles weggeräumt und gereinigt werden, denn im Hafen tauchten pünktlich die ersten Hungrigen auf.
Endlich mal wieder andere Deutsche
Der nächste Hafen, den wir anliefen, war Abidjan, hier bot sich beim Einlaufen am frühen Nachmittag ein herrliches Bild. Mindestens sechs Schiffe mit dem Heimathafen Hamburg lagen hier an den Kais. Beim Vorbeifahren betätigte der Kapitän unser Typhon als Begrüßung. Das war, wie ich später merkte, so üblich, wenn hier an der Westküste Afrikas andere deutsche Schiffe im Hafen lagen.
Während auch hier zwei Tage lang gelöscht wurde, nahmen viele von uns die Gelegenheit wahr, abends auf ein anderes Schiff aus Deutschland, womöglich noch eins der selben Reederei, zu gehen und dort Besuche zu machen. Das beschränkte sich unter Mannschaftsgraden dann oftmals auf das Leeren von einigen Kästen Bier und den Austausch von mehr oder weniger glaubhaften Gruselgeschichten aus anderen Häfen.
Durch diese Besuche hatte ich wiederum Gelegenheit, auch andere Gegebenheiten auf anderen Schiffen kennen zu lernen. Die Kammergröße für Mannschaftsgrade, die Ausstattung und die Sorten der Biere, vornehmlich deutsches Export, sowie Zigarettenmarken, meist amerikanisch, waren ohnehin gleich.
Ein Gesprächsthema war auch oftmals die Verpflegung. Zu dieser Zeit machte ein Gerücht die Runde, dass aufgrund von schlechten Frachtraten die Reedereien Einsparungsmaßnahmen bei der Verpflegung planen würden, wovon aber keiner etwas Genaues wusste.
Ausflüge mit der Barkasse
Vor unserem nächsten Löschhafen, Accra, gingen wir vor Anker. Riesige Pontons kamen längsseits. Auf die wurde dann die für diesen Hafen bestimmte Ladung gestellt und abtransportiert.
Hier kam auch die an Bord befindliche Barkasse erstmals zum Einsatz. Nachdem die Besatzung sie zu Wasser gelassen hatte, machten wir an einem Wochenende, das wir hier verbrachten, mit zwölf Mann einen Ausflug, einfach den Fluss hinauf. Nach einiger Zeit hatten wir rechts und links richtigen Urwald, den wir aber nicht betraten. Das war wirklich mal eine gute, wenn auch nicht allzu lange Abwechslung.
Obwohl wir hier nur in Sichtweite der Stadt vor Anker lagen, wie übrigens andere Schiffe auch, kamen viele kleine Boote mit fliegenden Händlern längsseits. Sie machten immer auf der Seite des Schiffes fest, an der sie nicht den von Bord gehenden Löschbetrieb störten oder durch ihn gefährdet wurden. Hier kaufte ich, oder besser gesagt, tauschte ich noch einmal Holzfiguren aus ganz schwerem, schwarzem Material gegen Zigaretten. Diesmal aber verstaute ich die Souvenirs gleich in meinem Spind, obwohl hier aufgrund der Höhe keine Gefahr bestand, durchs Bullauge hindurch bestohlen zu werden.
Der Koch droht mit dem langen Messer
Der nächste Löschhafen, Cotonou, brachte aus den Luken sehr viel Stauholz zu Tage, welches auf der dem Land abgewandten Seite in die Gangbord abgelegt wurde, ein wüstes Durcheinander von Planken, Brettern und zerbrochenen Holzteilen. Außerdem lagen hier auch noch dicht am Lukenrand gestapelt die Holzlukendeckel der jeweiligen Luke. Diese Unordnung sollte für mich noch einige Konsequenzen haben, wie sich nur allzu schnell zeigte. Weil es morgens Eier gegeben hatte (bei der Seefahrt gab es jeden Donnerstag Eier), muss es ein Donnerstag gewesen sein!
Mittags ging ich wie gewohnt nach mittschiffs zur Halbtür der Kombüse, um mit dem Tragegeschirr das Essen für die Mannschaft abzuholen. Es gab Pfannkuchen mit Apfelmus bzw. Preiselbeermarmelade, für jeden so, wie er es wollte. Der Weg zurück zur Mannschaftsmesse gestaltete sich aufgrund der schon beschriebenen Verhältnisse als schwierig. Holzbretter lagen ungeordnet wild durcheinander, und ich musste darüber klettern. Dann kam es, wie es kommen musste, ich stürzte und ließ, um mich abzustützen, das Tragegeschirr mit dem Essen fallen. Auf den Brettern lagen jetzt etwa 30 große Pfannkuchen, etwas davon entfernt die beiden Gefäße mit dem Apfelmus und den Preiselbeeren, zum Glück nicht umgestürzt. In manchen Situationen hat man eine Eingebung! Ich hatte genau in dem Moment meine. Als ich merkte, dass mich keiner sah, packte ich die Pfannkuchen mit den Händen, rieb kurz die daran haftenden Sägespäne und Holzsplitter ab, bzw. meinte dies zu tun – alles rein in das Gefäß, ein kurzer Blick noch in Richtung Kombüse, einer in Richtung achtern zu den Bullaugen der Messe – und ab ging es wie die Feuerwehr in die Messe. Hier war noch keiner der Mannschaft. Ich hatte aber gerade die Pfannkuchen auf die dafür vorgesehenen großen Platten gelegt, schnell noch einige Splitterchen beseitigt, als die ersten Hungrigen schon kamen. Argwöhnisch sah ich zu, wie die Leute zulangten, sich einen Pfannkuchen auf den Teller legten, Apfelmus darauf füllten, es etwas verstrichen - oder eben dasselbe mit den Preiselbeeren - und anfingen genüsslich zu essen.
Das Schicksal nahm jetzt ziemlich schnell seinen Lauf. Nachdem der erste kleine Holzsplitter von einem Matrosen gefunden war, ließen sich auch die anderen den Teig langsamer zwischen den Zähnen hin und herwandern, und siehe da, plötzlich hatten mehrere was aus ihrem Mund gefischt und hielten es drohend nach oben: „Dieser Koch!“
Es durchzuckte mich, ich war aber noch zu naiv, um zu glauben, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommen würde. Ich wurde beauftragt, mit den beanstandeten Pfannkuchen zum Koch zu gehen und von ihm Rechenschaft zu verlangen und natürlich neues Essen. Ich also los, wieder über die Bretter hin zur Kombüse. Ich hatte gerade damit begonnen, mein Essgeschirr über die Halbtür in die Kombüse zu reichen, als es auch schon losging. Ich brachte etwas zögernd die Einwände der Matrosen hervor und berichtete von gefundenen Holzteilchen in den Pfannkuchen, als der Kochsmaat auftauchte. Der Koch griff nach seinem wahrscheinlich längsten Messer, als der Kochsmaat mich spöttisch fragte, ob ich denn wohl auch alle Pfannkuchen zwischen dem Stauholz wieder gefunden hätte. Zum Glück fuchtelte der Koch nur, ich bekam neue Pfannkuchen und die Matrosen hatten das Gefühl, es durch mich dem Koch einmal wieder so richtig gegeben zu haben. Pfannkuchen mit Holzsplittern drin, wo gibt’s denn so was! Ich für mich dachte nur: „Noch mal gut gegangen.“ Komischerweise wurde von Seiten des Kochs und des Kochsmaaten in Gegenwart der Mannschaft nie von dieser Episode gesprochen. Vielleicht zum Glück für mich!
Als nächster Hafen stand Lagos auf der Liste, nur wenige Stunden Seetörn, und wir hatten dort festgemacht. Wieder wurden durch die fleißigen Crew-Boys viele der Kisten und sonstigen sperrigen Teile aus dem Schiff an Land verbracht und von der Pier aus mit klapperigen LKW weiterbefördert, währenddessen es bei den Matrosen, die schon mehrmals hier in Lagos waren, nur ein Gesprächsthema gab, eine Kneipe, die sich „Dressler-Bar“ nannte.
Hier sollte sich alles abends abspielen, hier gab es die schönsten Frauen und die heißeste Musik, hieß es. Aber alles kostete Geld, und das hatte ich nicht. Immer konnte man auch keine Zigaretten verkaufen, ein Leichtmatrose gab mir dann aber einen Tipp, wie man zu Geld kommen könnte.
Ich hätte doch eine Lederjacke, meinte er, die solle ich einfach mit an Land nehmen, da kämen die Leute von ganz alleine, um sie zu erwerben. Ich dachte, der spinnt, hier in den Tropen und dann die schwarze Lederjacke. Der Gedanke daran, vielleicht aber was zu versäumen, brachte mich aber doch dazu, abends, als ich mit dem zweiten Decksjungen und dem Messejungen aus der Offiziersmesse an Land ging, die Lederjacke mitzunehmen und sie, weit genug vom Schiff entfernt, anzuziehen.
Wir waren noch gar nicht sehr weit in Richtung Stadt gegangen, als wir auch schon von ein paar Einheimischen angehalten wurden, die neugierig die Jacke betatschten und wissen wollten, was sie denn wohl kosten sollte. Ich nannte einen Preis, der mir angemessen schien, und einer der Leute wollte sie gerne anprobieren, wofür ja eigentlich kein Hinderungsgrund vorhanden war. Ich zog also die Jacke aus, er streifte sie über, drehte sich, sprach mit seinen Freunden, alle begutachteten die Qualität, den Strickkragen und auch die Gangbarkeit des Reißverschlusses, er wurde rauf und runter gezogen, immer noch einmal.
Dann ging alles ganz schnell und einfach! Der gute Mann lief einfach weg, er und seine Kollegen verschwanden alle in verschiedene Richtungen. Ehe wir uns versahen, standen wir alleine auf weiter Flur. Uns war ganz schnell klar, dass da keine Chance bestand, die Jacke wiederzubekommen. In der Hoffnung, auch so in der so genannten Dressler-Bar irgendwie jemanden zu treffen, der uns einen ausgab, fragten wir uns nach der Bar durch.
Die so genannte Bar lag im Stadtteil Apapa und war wohl mehr eine Bruchbude als ein normales Haus. Verfehlen konnte man diese angebliche Sehenswürdigkeit nicht, laute Musik und bunte Lichter außen an der windschiefen Baracke wiesen uns schon von weitem den Weg. Innen war im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los, etwa 50 bis 60 Leute waren in einem Raum von wahrhaft unglaublicher Ausstattung: Bunte Lampen überall, an den Wänden übergroße Zeichnungen von halbbekleideten Mädchen, eine Tanzfläche von etwa 25 qm, ein unheimlich rustikal zusammen gezimmerter Tresen, laute Musik aus einer modernen Music-Box und um die Tanzfläche herum etwa 15 Tische mit einfachen Stühlen. Das unbedingte Glanzstück war aber die Frau hinter dem Tresen! Eine absolute Schönheit, bekleidet mit einem Kleid aus imitiertem Tigerfell, nur ein Träger führte über eine der Schultern, das Kleid war so kurz, dass man es auch als breiten Gürtel bezeichnen konnte. Und dann dieses Lächeln. Nicht nur, dass es dauernd das braune Gesicht zierte, nein, man hatte auch das Gefühl, wenn man vom Blick getroffen wurde, als wenn es direkt für jeden persönlich gedacht war. Und die Bedienungen, alle mit ähnlicher Figur wie auch die „Tigerfrau“, waren auch nicht schlecht. Mit meinen gerade 17½ Jahren klafften aber Träume und Wirklichkeit ganz weit auseinander. Da hatten die Matrosen, die sich auch um viele andere junge Mädchen bemühten, die sich hier aufhielten, schon bessere Chancen.
Aber im Moment hatten wir andere Wünsche. Obwohl es nicht besonders auffiel, wenn man zwischen den ganzen Leuten einfach nur so dastand, Unterschiede gab es schon, denn wir hatten nichts zu trinken. Der zweite Decksjunge hatte schließlich den Mut, einen der Matrosen anzusprechen, von dem er dann auch ein paar Dollar bekam, so dass wir endlich auch etwas trinken konnten. Wir ließen uns an einem der Tische nieder und schlürften behaglich das (daher der Name der Bar) Dressler-Bier, schön eisgekühlt. Meine Augen flogen nur so hin und her, sie kamen nicht zur Ruhe, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Getanzt haben wir drei damals nicht, dazu waren wir wohl doch noch zu jung und unerfahren, aber das Leben lag ja noch vor uns, das würde sicher noch anders werden.
Gegen zwei Uhr nachts waren wir wieder an Bord. Der Wachmann empfing uns mit einem Grinsen an der Gangway. „Dressler-Bar“? „Yes, Dressler-Bar, wonderfull“, war die Antwort.
Als ich in der Koje lag, mein Kollege unter mir, sprachen wir noch eine geraume Zeit über diese wunderbare Dressler-Bar, und auch später sollte ich auf der ganzen Welt Seeleute treffen, die diese Bar, wenn sie einmal in Lagos gewesen waren, nur zu gut kannten. Der Morgen beim Frühstück bestätigte die so genannte Einmaligkeit dieser Vergnügungsstätte in Lagos-Apapa, auch die Matrosen und das Maschinenpersonal, die ja schon wesentlich mehr Erfahrung aufwiesen als ich, sprachen beim Essen noch länger über die nächtlichen Erlebnisse, wohl wissend, dass es wohl der letzte Hafen dieser Reise sein würde, in dem man mal so richtig einen draufmachen konnte.
Der letzte Löschhafen der STECKELHÖRN war Douala. Hier wurde auch der Rest der Stückgutladung gelöscht, die wir in Europa geladen hatten. Danach liefen wir in Ballast wieder in nördliche Richtung aus, letzter Hafen in Westafrika sollte Takoradi werden. Hier sollten wir Baumstämme für Hamburg laden.
Wenn ich gedacht hatte, in Takoradi, dem Ladehafen für Baumstämme für Hamburg, noch mal abends an Land gehen zu können, sah ich mich getäuscht. In Sichtweite des Hafens gingen wir vor Anker. Es dauerte nicht lange, dann wurden riesige Mengen von schwimmenden Baumstämmen rings um das Schiff herum verbracht. Stunden später, das Ladegeschirr war richtig gestellt, begann die Beladung.
Das an Deck liegende Stauholz, ebenso in den Räumen befindliche Holzreste waren auf See von der Decksbesatzung unter Mithilfe der Crew-Boys einfach über Bord geworfen worden, eine damals gängige Praxis, denn benötigt wurde es für die Ladung hier nicht, und ganz nach Hamburg mit dem Abfallholz? Kein Kommentar.
Obwohl die Barkasse hier auch zu Wasser gelassen worden war, bestand absolutes Landgangsverbot, warum, erfuhren wir nie richtig.
Das Beladen der STECKELHÖRN mit den riesigen Edelholzbäumen war schon ein Schauspiel für sich. Die Standards, die in Europa für Hafenarbeiter galten, hatten hier gar keine Bedeutung, barfuss turnten hier die Dunkelhäutigen auf den Baumstämmen umher, die rund um das Schiff lagen. Für deren Bewegung zu den richtigen Stellen zum Anbringen der Drahtseile war ein kleiner Motorschlepper im Einsatz. Die Winden an Deck wurden von den Crew-Boys bedient, auch im Laderaum waren sie für die richtige Platzierung eines jeden Stammes zuständig. Jeder Stamm dieses hochwertigen Holzes aus dem Urwald Afrikas hatte übrigens eine eigenständige Markierung, die immer am Kopfende jedes Stammes angebracht war. War neben der Nummer ein A, zeigte dies, dass es das untere, also dickste Stück eines Stammes war, ein B war das nächst höhere Stück und ein C bedeutete, dass es einmal der höchste, also dünnste Teil eines Stammes war. So ein Stamm wog schon mal fünf bis sechs Tonnen und war am untersten Ende 2,50 Meter dick.
MS „STECKELHÖRN“
Von morgens bis abends wurde jetzt an allen Luken gearbeitet. Stamm um Stamm wurde in den Laderäumen verstaut. Als die Räume voll waren, wurden sie vom Deckspersonal angedeckelt und so mit Persenningen überzogen und verschalkt, als wenn es ohne Decksladung auf See gehen würde. Danach begannen die Crew-Boys, an Deck weitere schwere Holzstämme zu lagern. Dabei entstand schon mal so manche Beule an den Geländern der Deckshäuser.
Am 17. Oktober 1957 waren die Ladungsarbeiten abgeschlossen, die Decksmannschaft ließ die Bäume herunter und verzurrte alles, was irgendwie lose war. Dann verließen wir den Ankerplatz in Takoradi. Kurze Zeit später legten wir noch einmal in Dakar an, wo die Crew-Boys von Bord gingen, diesmal mit vielen Kisten und Säcken, denn auf unserer Reise zu den anderen afrikanischen Häfen und den vielen Besuchen ihrer Angehörigen war es zu einer wundersamen Vermehrung ihrer anfangs mitgebrachten Habseligkeiten gekommen. Mit viel Wortschwall und Gestik verließen die uns vertraut gewordenen Gesichter das Schiff. Der Wachmann bekam von einem der Offiziere noch ein besonderes Geschenk für seine immerwährende Aufmerksamkeit.
Nachdem auch die Formalitäten durch die Behörden erledigt waren, legten wir endlich ab. Jetzt stand uns eine Seereise von etwa 12 bis 13 Tagen bevor, danach sollten wir Hamburg wieder sehen.
Heimreise
Gerade mal aus dem Hafen heraus, begann die Mannschaft damit, auf der Deckslast, also über die Baumstämme hinweg, Laufstege aus Brettern zu errichten. Schnell merkte ich, dass dies auch unbedingt erforderlich war, denn ein Laufen auf den glitschigen Baumstämmen, die ja schon wochenlang im Wasser gelegen hatten, war sehr gefährlich, aus diesem Grund wurden auch zusätzliche Laufseile gespannt, um sich in Notfällen festhalten zu können. Die Decksbesatzung hatte jetzt bei der Heimfahrt lange nicht so viel zu tun, denn das Deck, an dem man hätte arbeiten können, war ja nicht frei. Für mich persönlich hatten sich die Arbeitsbedingungen erheblich verschlechtert, denn, immer wenn ich nach mittschiffs zum Essenholen musste, hatte ich achtern einen Aufstieg auf die Deckslast hinauf und mittschiffs wieder hinunter mit dem Essgeschirr zu bewältigen, zurück nach achtern zur Mannschaftsmesse wieder dasselbe in umgekehrter Reihenfolge.
Das Wetter war immer noch wunderbar, die Temperaturen angenehm. Allerdings wurde es in nördlicheren Breitengraden von Tag zu Tag kühler, und man musste sich immer öfter ein Kleidungsstück mehr anziehen. Ungewöhnliche Vorkommnisse gab es in den ersten Tagen auf See nicht, doch je dichter wir wieder in heimische Gefilde kamen, desto gereizter wurde die allgemeine Stimmung.
Einmal morgens beim Frühstück hatte ich wohl übersehen, dass ich auf die Back des Maschinenpersonals keine Butter hingestellt hatte. Einer der Reiniger rief daraufhin zu der Decksbesatzung hinüber: „Schmeiß mir mal die Butter rüber“, einer der Matrosen nahm dies wörtlich und warf die Butter in Richtung des Reinigers, er zog allerdings den Kopf ein und die Butter landete hinter ihm an der Verkleidung. Maschine und Deck waren nicht nur hier wie Katz und Maus. Noch auf mehreren Schiffen, in denen sie eine gemeinsame Messe hatten, konnte man eine gewisse Streitsüchtigkeit zwischen beiden Berufsgruppen beobachten.
Als wir nach einigen Tagen den Eingang der Biscaya erreichten, änderte sich das Wetter total: Wir bekamen, wie man sagt, „richtig einen auf die Mütze“. Das Schiff rollte und stampfte, und in der Messe rutschten die Teller und Tassen hin und her, die Schlingerleisten an den Seiten der Tische wurden hochgeklappt, das Essenholen wurde jetzt zu einem Erlebnis. Die Überholbewegung war manchmal so schlimm, dass mir einer von der Decksbesatzung helfen musste, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte ganz schön die Hosen voll. Den Matrosen und anderen langjährigen Fahrensleuten machte dies alles nichts aus. Ich für meinen Teil war jedenfalls heilfroh, als wir den Ausgang der Biscaya und damit den Eingang zum Englischen Kanal erreichten. Es wurde spürbar besser mit dem Wetter, aber dafür immer kälter.
Einer der Offiziere nahm mich hier im Englischen Kanal das erste Mal mit auf die Brücke. War das eine Aussicht! Ich staunte nur so, und immer wieder griff ich zum Fernglas, um andere, manchmal gar nicht so weit entfernte Schiffe zu betrachten. Mir wurde von dem Offizier auch die Handhabung des Ruders erklärt, und ich durfte einen Blick auf den Radarbildschirm werfen. Das Kartenhaus wurde mir gezeigt und die Funkbude, aus der wir vom Funker jeden Sonntag immer das Telegramm mit den Fußballergebnissen aus unserer Heimat bekommen hatten. Alles war schon sehr beeindruckend für mich.
Bedauerlicherweise wurde mir aber auch eröffnet, dass ich in Hamburg von Bord gehen müsse. Einerseits tat es mir leid, andererseits war ich auch froh, denn ich hatte doch ein wenig Heimweh nach Lübeck. Nach dem Löschen der Holzladung in Hamburg sollte die STECKELHÖRN eine Reise in Ballast nach Archangelsk machen und dort Grubenholz für Frankreich laden, eine damals sehr häufige Fracht. Aber das sollte ich ja nun nicht miterleben. Mit mir wollten noch acht andere Mannschaftsmitglieder in Hamburg von Bord gehen, auch der andere Decksjunge, der bei dem schlechten Wetter unheimlich seekrank geworden war, wollte endlich wieder mal nach Hause.
Bei „Elbe 1“ wurde der Seelotse übernommen, dieses konnte ich früh morgens vom Achterschiff aus beobachten, viele Schiffe waren zu sehen, die aus der Elbe kamen oder in See gingen. Jetzt war es nicht mehr weit bis zum Hamburger Hafen.
Leider verpasste ich die Schiffsbegrüßungsanlage in Schulau. Später sollte ich aber noch öfter Gelegenheit bekommen, diese auf der Welt einmalige Einrichtung kennen zu lernen.
Schiffsbegrüßungsanlage in Schulau
Mein Seesack war natürlich längst gepackt, als wir im Hafenbecken von Waltershof festmachten, wieder an den Pfählen, denn an der Pier war kein Platz frei zum Löschen. Nach einiger Zeit musste ich zum 1. Offizier, der mir mitteilte, dass ich am nächsten Tag, dem 31. Oktober morgens nach dem Frühstück von Bord gehen könne.
Die Besatzung der STECKELHÖRN: Kapitän, 4 Offiziere, 1 ChiefIng, 3 Masch.-Ing, 3 Assis, 1 Storekeeper, 2 Reiniger, 2 Schmierer, 1 Bootsmann, 4 Matrosen, 3 Leichtmatrosen, 1 Koch, 1 Kochsmaat, 2 Jungmänner, 2 Decksjungen, 1 Messejungen, 1 Chief-Steward, 1 Funker, 1 Elektriker, 1 Zimmermann. - Insgesamt 36 Mann Besatzung.
Meine Heuer damals betrug 65,- DM monatlich.
Am 31.10.1957, einem diesigen Oktobertag, war es dann soweit. Nachdem ich noch kurz meinen Nachfolger, einen neuen Decksjungen, der auch von der Schiffsjungenschule Priwall in Travemünde kam, begrüßen konnte und ihm seinen Schlafplatz gezeigt hatte, verabschiedete ich mich von den Seeleuten und Offizieren, die ich gerade mal noch so sah. Dann fuhr ich mit dem Spido, der um diese Zeit voll besetz war, zu den Landungsbrücken nach St. Pauli. Mit mir fuhren noch vier andere Mannschaftsmitglieder. Diese kannten den Weg zur Reederei genau, und so brauchte ich mich ihnen nur anzuschließen.
Das Gebäude der Reederei H. M. Gehrckens war nicht allzu weit von den Landungsbrücken entfernt. Hier angekommen, legte ich die Papiere, die ich an Bord vom 1. Offizier mitbekommen hatte, vor und musste etwa zwei Stunden warten, bis ich endlich mein Seefahrtbuch sowie alle Abrechnungen und auch die Restauszahlung in Händen hatte.
Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie viel Geld ich ausbezahlt bekam, aber es waren schon ein paar Hundert Mark, die Heuer in Verbindung mit den Überstunden summierten sich eben. Außerdem bekam man damals noch für jeden Sonntag auf See eine Extra-Bezahlung, und der Urlaub wurde ja schließlich auch ausgezahlt.
Ich saß jedenfalls noch vor 18:00 Uhr in einem Zug nach Lübeck. Meine Mutter hatte ich telefonisch vom Hauptbahnhof in Hamburg schon einmal vorgewarnt. Sie war, wie sie sagte, sehr gespannt, was das Abenteuer Seefahrt mir gebracht hatte.
Von wegen „nie wieder“
Als ich nach relativ kurzer Fahrtzeit mit dem Zug in Lübeck eintraf, freute ich mich, ehrlich gesagt, auf zu Hause. Ich hatte viel zu erzählen und beglückte meine Mutter, die inzwischen geschieden war, mit den ganzen Mitbringseln aus Afrika und einigen Souvenirs aus den von der STECKELHÖRN in Europa angelaufenen Häfen. Die ersten Tage an Land benutzte ich, um auch bekannten Freunden von meinen „Abenteuern“ zu erzählen. Ich vernachlässigte auch nicht das Biertrinken in Kaschemmen am Hafen, was meiner Mutter gar nicht recht war.
So verging Tag für Tag. Als mein Geld immer weniger wurde und auch meine Mutter merkte, dass etwas passieren müsste, beschloss ich ihr mitzuteilen, dass ich eigentlich gar nicht mehr auf ein Schiff wollte. Da hatte ich aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. In aller Deutlichkeit wurde mir klargemacht, dass ich nun etwas begonnen hätte und es schließlich nicht so einfach beenden könne. Alles Jammern, auch über die total uninteressante Tätigkeit auf meinem ersten Schiff, nützte nichts. Ich schulterte Mitte November wieder meinen Seesack voller frisch gewaschener Wäsche und verließ Lübeck per Zug in Richtung Hamburg, wo ich auf Anraten eines Kollegen, den ich zufällig auf dem Hauptbahnhof in Hamburg traf, in das katholische Seemannsheim „Stella Maris“ ging, wo mir eine Unterkunft in einem Vier-Bett-Zimmer zugewiesen werden konnte.