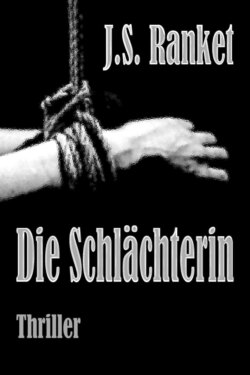Читать книгу Die Schlächterin - J.S. Ranket - Страница 8
-5-
ОглавлениеAnna erwachte in völliger Dunkelheit.
„Verdammt, wie spät ist es und was haben wir gestern Abend nur alles in uns hineingeschüttet? Und wo stand dieser verdammte Wecker? Eigentlich müssten ja auch die zahlreichen Leuchtreklamen das Zimmer etwas erhellen. Doch stand nicht im Reiseführer, dass es in den USA, obwohl sie ein Hochtechnologie-Land waren, öfter als gedacht zu Stromausfällen kam.“
Das Bewegen fiel ihr schwer – nein, es war eigentlich unmöglich. Außerdem lag irgendetwas auf ihrem Gesicht, etwas Stoffiges. Sie konnte auch nur durch die Nase atmen. Es roch leicht nach Ammoniak, als ob jemand uriniert hatte. Unwillkürlich wollte sich Anna in den Schritt fassen, denn unter der Einwirkung von zu viel Alkohol konnte so etwas schon einmal passieren. Doch irgendetwas hielt ihre Hände fest.
Bevor diese ganzen Informationen in ihrem Gehirn zu einem vollständigen Gedanken zusammengesetzt wurden, verschwand die Dunkelheit und wich einem schummerigen Licht. Irgendjemand hatte ihr die schwarze Kapuze herabgezogen, unter der ihr Kopf bis jetzt steckte.
Nur langsam realisierte Anna, wo sie sich befand. Es schien ein Keller oder eine Lagerhalle zu sein und überall lagen Überbleibsel der ehemaligen Nutzer. Alte Paletten, eine Werkbank mit Schraubstock und große Fässer mit verblichenen Beschriftungen ergaben ein surreales Schwarz-Weiß-Gemälde wie in einem Traum. Sie konnte auch das Ende des Raumes nicht sehen. Es verschwand im Dunkel, als hätte der Maler es langsam verwischt.
Vor ihr stand etwas Schönes. Doch ihr Blick verschwamm und sie konnte nicht erkennen was es war. Aber es funkelte und glänzte wie der Mond auf der leicht gekräuselten Oberfläche eines klaren Bergsees. Von ihrer Rechten wehte ein Duft von Tabak heran. Sie hätte jetzt ihr Leben für den Zug an einer Zigarette gegeben. Sie würde den Rauch tief in ihre Lungen inhalieren, kurz darin halten und dann langsam, wie von selbst, wieder in die Luft blasen.
Doch eine alte Lampe warf einen Kreis aus Licht auf den staubigen Betonboden und erhellte so ein Szenario des Schreckens. Adrenalin geschwängertes Blut schoss durch ihre Adern und zog sie mit grausamer Gewalt in die Realität zurück.
Ihr gegenüber saß Mary. Sie war, genau wie Anna selbst, mit festen Ledergurten auf einen Stuhl geschnallt und den Mund verschloss ein breiter Streifen Klebeband. Zwischen ihren Füßen hatte sich eine Pfütze gebildet, in die noch immer ein kleines Rinnsal von der Sitzfläche tropfte. Offensichtlich hatte Mary die Kontrolle über ihre Harnblase verloren, denn in den verheulten Augen stand die blanke Todesangst.
Als Annas Pupillen etwas besser fokussieren konnten, sah sie es. Überdeutlich scharf brannte sich das Bild in ihr Gehirn.
Zwischen Mary und ihr stand ein kleiner Tisch. Nur verwandelte sich der funkelnde Bergsee in chirurgische Instrumente, die mit einer unheimlichen Ordnung aufgereiht waren. Sie glänzten im matten Licht und obwohl Anna noch vor einem Tag die Namen der Gerätschaften und deren Verwendung im Schlaf hätte aufsagen können, fiel ihr jetzt nichts mehr dazu ein.
Ihr Herz schlug bis zum Hals und ihr Gehirn schaltete in eine Art Notprogramm. Krampfhaft versuchte sie, ihren Schließmuskel zusammenzupressen, doch Augenblicke später spürte sie die warme Welle an ihren Schenkeln. Aus der Richtung, aus der die Tabakwolke gekommen war, hörte sie eine ruhige, emotionslose Stimme. Eine Stimme wie im Fahrstuhl einer Klinik:
„Erstes Untergeschoss, Folterkammer. Alle Todeskandidaten bitte aussteigen!“
Nur dass diese Stimme sagte:
„Lass uns anfangen!“
Amandas Instruktionen waren eindeutig.
„Finde heraus, ob sie etwas wissen“, hatte Salazar zu ihr gesagt. „Und wenn ja, dann was. Darüber hinaus möchte ich dich höflich bitten, deine Spielzeuge zu Hause zu lassen, denn wir brauchen nicht noch mehr Aufsehen.“ „Die beiden sitzen morgen im Flugzeug“, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu, „und zwar in einem Stück.“
Salazar hatte es wie immer sehr ruhig und respektvoll gesagt. Zum einen, weil er Achtung vor ihrer professionellen Arbeit hatte, und zum anderen, weil man ja nie wissen konnte. Vielleicht kriegt sie ja etwas in den falschen Hals und man wacht am nächsten Morgen ohne Eier auf. Ihm war nicht wohl bei dem Gedanken, mit einer durchgeknallten Irren zusammenzuarbeiten, und fragte sich, welchen Narren Garcia wohl an ihr gefressen hatte. Wenn sie diesen Auftrag erledigt hatte, musste er sich unbedingt über ihre zukünftige Zusammenarbeit Gedanken machen.
Vielleicht auch schon früher.
Da Amanda ja nicht einmal genau wusste, nach welcher Information sie suchten, hatte sie beschlossen, auf psychologische Spielchen zu verzichten und auf brutalen Terror zu setzen. Denn das beherrschte sie in Perfektion. Man musste seine Quelle ja nicht unbedingt foltern – was manchmal wirklich schade war. Man musste ihr nur demonstrieren, was man mit ihr machen könnte.
Erst jetzt sah Anna den Mann, der noch im Dunkeln stand und nun mit der Geschmeidigkeit eines Pumas ins Licht trat. Er ging zu dem Tisch und griff nach einer großen Rippenschere. Dann drehte er sich langsam zu Mary um und steckte den kleinen Finger ihrer rechten Hand zwischen die scharfen Klingen. Sofort rannen Blutstropfen hinab, weil allein das Aufsetzten des Instruments einen kleinen Schnitt verursacht hatte.
Mary sah aus, als bekäme sie gleich einen Herzinfarkt. Ihr Gesicht wurde aschfahl, riesige kalte Schweißtropfen schossen aus allen Poren und sie zappelte hilflos mit ihren gefesselten Füßen.
Nun wurde Anna auch auf Amanda aufmerksam, die sie mit einem kalten Blick fixierte. Mit wenigen Schritten war sie bei ihr. Das Klacken ihrer Pumps hallte dabei unnatürlich hell durch den Raum. Sie beugte sich zu Anna herab und sah sie an, als ob sie das Versuchsobjekt in einem verrückten Experiment wäre. Mit einer fast zärtlichen Geste strich sie Anna eine Haarsträhne aus der verschwitzten Stirn. Dann wandte sich Amanda kurz um.
Anna hörte ein kurzes Klicken, gefolgt von einem hellen Zischen und sah plötzlich in die blaue Flamme eines Schweißbrenners. Ein heißer Luftstrom, der direkt aus der Hölle zu kommen schien, schlug ihr entgegen.
Amanda schaffte es gerade noch rechtzeitig, das Klebeband von Annas Mund zu ziehen und in Deckung zu gehen. Dann schoss ein süßlich-saurer Schwall an ihr vorbei.
„Das fehlte jetzt noch, dass die Süße an ihrem eigenen Gekotzten erstickt!“
Für Anna war es, als würden ihr sämtliche Eingeweide aus dem Leib gerissen. Ein galliger Strudel bahnte sich seinen Weg durch ihre Nase und sie verschluckte sich – um sich sofort wieder zu erbrechen.
Doch schließlich gelang es ihr, zwischen zwei Brechanfällen etwas Luft zu holen und es herauszuschreien:
„Die Tasche …, es ist in der Tasche. Das Futter ist kaputt …, da ist es drin!“
Ramon nahm die Schere von Marys Finger, griff nach Annas Tasche und fand die Speicherkarte sofort. Er hob überrascht die Augenbrauen, doch Amanda tat in Anwesenheit der jungen Frauen so, als hätten sie genau danach gesucht. Ramon steckte die Karte in sein Notebook, startete den Mediaplayer und nickte kurz darauf befriedigt.
„Okay, wir haben es.“
„Wisst ihr beide denn nicht, dass man bei der Polizei immer die Wahrheit sagen muss?“, kommentierte Amanda den Fund und sah Anna tadelnd an.
„Jetzt bringen sie uns um!“
Der psychische Stress hatte sie so gequält und erschöpft, dass sie im Angesicht des nahenden Todes überhaupt keine Angst empfand. Im Gegenteil. Sie fühlte sich geborgen, wie in eine warme Decke gehüllt und auf einem Meer aus Wolken, dem goldenen Licht entgegentreibend.
Doch plötzlich spürte sie, wie ihre Fesseln sich lösten. Sie registrierte nur am Rande, dass auch Mary losgebunden wurde und der Mann anschließend ihre Pässe auf den Tisch legte, um mit seinem Smartphone Fotos davon zu machen.
„So, ihr zwei Süßen, wir haben was wir wollen“, säuselte Amanda. Sie trat einen Schritt auf Mary zu und spielte ein paar Sekunden gedankenverloren mit den blonden Haaren ihres Opfers, bevor sie fortfuhr. „Ihr solltet diese ganze Sache hier …“, dazu machte sie eine kreisende Handbewegung, „… so schnell wie möglich vergessen.“ „Ich denke, ihr habt auch ohne unser kleines Date genug zu erzählen.“ Dann senkte sie bedrohlich ihre Stimme. „Denkt daran, Deutschland ist nicht weit genug entfernt für mich und ich garantiere euch, wenn wir uns wiedersehen sollten, dann werde ich mir sehr viel Zeit für euch nehmen.“
Mary war wie gelähmt, als Amanda ihr einen zarten Kuss auf den Mund hauchte. Sie spürte die Zunge auf ihren Lippen und im Nachhinein jagte ihr diese Berührung mehr Angst ein als die blitzende Rippenschere.