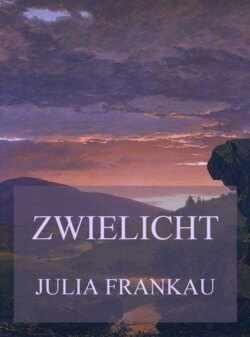Читать книгу Zwielicht - Julia Frankau - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL II
ОглавлениеIch begann schon am nächsten Tag mit der Suche nach besagten Briefen, obwohl ich wusste, wie absurd dies war – als wäre ich noch ein Kind, das am Ende des Regenbogens den Topf mit dem Gold zu finden glaubte. Ich ließ Suzanne bei Dr. Kennedy anrufen und ihm mitteilen, dass es mir viel besser ginge und ich seinen Besuch nicht benötigte. Ich wollte einfach allein sein, um meine Suche abzuschließen und dabei nicht gestört zu werden. Obwohl es nicht stimmte, dass es mir besser ging, so war mein Gesundheitszustand zumindest nicht schlechter geworden. Mein Körper und mein Geist fühlten sich nur behäbig und matt an und aus jeder Bewegung resultierte eine fast unerträgliche Müdigkeit. Trotzdem setzte ich mich fest entschlossen und in der Absicht, jede Schublade und jede Tür zu öffnen, an den Schreibtisch. Dann rief ich Suzanne unter dem Vorwand zu Hilfe, dass ich weißes Papier zum Auskleiden der Schubladen und einen Staubwedel zum Reinigen benötigte – in Wirklichkeit sollte sie sich an meiner Stelle bücken. Leider fanden wir überall nur Leere und ganz viel Staub. Nach dem Mittagessen schlich ich ins Musikzimmer, um dort mein Glück in dem riesigen Haufen ungeordneter Notenblätter zu versuchen; aber auch diese Suche verlief erfolglos. Da es sinnlos war, noch einmal nach unten zu gehen, ging ich noch vor dem Abendessen zu Bett und verbrachte eine schlaflose Nacht mit Schmerzattacken, die mich wie Nadelstiche peinigten, und gegen die selbst mein Schlaftrunk nicht half. Ich hatte insgeheim damit gerechnet, Margaret Capel wiederzusehen, um genauere Anweisungen zu erhalten, wurde aber erneut enttäuscht.
Der nächste Tag und viele andere waren gleichermaßen vielversprechend und erfolglos. Ich schaute an den unwahrscheinlichsten Stellen nach, bis ich erschöpft war, schleppte meinen ausgelaugten Körper herum, den mein nie nachlassendes Gehirn in eine Art ständige Scheinaktivität peitschte. Dr. Kennedy kam und ging, brabbelte immer wieder von Margaret Capel und beobachtete mich, so dachte ich zumindest, mit verwirrten, fragenden Augen. Meine Familie in London wurde ordnungsgemäß darüber informiert, wie viel besser ich mich fühlte und wie gut mir die Ruhe und Einsamkeit taten. Tatsächlich fühlte ich mich schrecklich krank und gab gegen Ende der zweiten Woche meines Aufenthalts die Suche nach Margaret Capels Briefen oder Papieren auf. Ich war immer noch entschlossen, ihre Geschichte aufzuschreiben, aber mittlerweile hatte ich mich dazu entschlossen, sie aus den Fakten zusammenzustellen, die ich von Dr. Kennedy, aus alten Zeitungsberichten und anderen Quellen erfahren konnte – und das nicht immer ganz freiwillig. Es war mir klar, dass meine Arbeit die einzige Möglichkeit war, mich vor dem zu retten, was ich zu dieser Zeit für einen geistigen und körperlichen Zusammenbruch hielt. Hin und wieder sah ich Margaret und konnte mich nie ganz freimachen von dem Gefühl, nicht allein zu sein. Wenn mich Kälteschauer durchzogen, bedeutete das, dass sie hinter mir war; Hitzewallungen zeigten an, dass sie im Begriff war, sich zu materialisieren. Normalerweise war ich der gnadenloseste Zweifler in Sachen Okkultismus, aber nun glaubte ich fest daran, dass es in Carbies spukte.
Als ich wieder in der Lage war, vernünftig und zusammenhängend zu denken, begann ich, das wenige, was ich über die beiden Menschen wusste, von denen ich besessen war, zusammenzufügen. Denn es war nicht nur Margaret, sondern auch Gabriel Stanton, den ich in diesem Haus fühlte oder vermutete. Stanton & Co. waren meine eigenen Verleger. Ich wusste nicht, dass sie auch Margaret Capel unter Vertrag genommen hatten. Aber Gabriel war nicht der Ansprechpartner gewesen, den ich traf, wenn ich den Büros am Greyfriars' Square meine seltenen Besuche abstattete. Er beschäftigte sich nur mit den klassischen Werken, die dieses bekannte Haus herausgab. Irgendwo hatte ich gehört, dass er in Oxford als Kapazität galt und mehr über die griechischen Wurzeln wusste als jeder andere lebende Fachmann. Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen wir uns trafen, hatte ich ihn als ablehnend und überheblich empfunden. Er kam in den Raum, in dem ich mich mit Sir George unterhielt, und war genauso schnell wieder draußen – sagte, dass es ihm leid täte oder dass er nicht gewusst hatte, dass sein Cousin beschäftigt war. Sir George stellte uns mehr als einmal vor, aber Mr. Gabriel Stanton schien diese Begegnungen immer wieder vergessen zu haben. Ich erinnerte mich an ihn als einen großen, hageren Mann, mit tiefliegenden Augen und eingefallenem Mund; einen Gentleman, wie alle Stantons, aber das krasse Gegenteil seines liebenswürdigen Partners. Ich hatte und habe eine Schwäche für Sir George Stanton und war von ihm stets überaus freundlich empfangen worden. Vielleicht hatte auch Gabriel einen gewissen Charme besessen – immerhin galt seine Familie generell als sehr charmant; aber er hatte diesen mir gegenüber nie gezeigt. Er und sie alle waren so ehrenwert, so traditionell und unabdingbar ehrenwert, dass es schwierig war, meinen langsam arbeitenden Verstand daran zu gewöhnen, ihn als den Liebhaber einer Frau zu betrachten; als einen außerehelichen Liebhaber, wie es in diesem Fall zu sein schien. Ich schrieb an meine Sekretärin in London, um alles herauszufinden, was über Margaret Capel bekannt war. Aber bevor ich ihre Antwort erhielt, folgte eine weitere Attacke meiner Rippenfellentzündung, die mich bereits mehrmals in London gepeinigt hatte – und diese wiederum brachte Ella auf den Plan, ganz zu schweigen von diversen geldgierigen und unfähigen Fachärzten aus derselben Stadt.
Wie ich bereits sagte, ist dies keine Geschichte meiner Krankheit und auch nicht der allumfassenden Liebe meiner Schwester, die es mir letztlich ermöglichte, sie zu überstehen, die mich immer wieder aus den Armen des Todes zwang, jenes Freundes, nach dem ich mich in meiner Schwäche manchmal sehnte. Der eigentliche Kampf fand außerhalb statt. Was mich betraf, so legte ich früh die Waffen nieder. Ich fürchtete den Schmerz mehr als den Tod, und das tue ich immer noch – das Erdulden und nicht das Eintreten, wenn ich mich beschämt von meinem eigenen, geschundenen Körper unter den Schmerzen wand und mich nur noch verstecken wollte. Dennoch schlug die Öffentlichkeit weiter auf mich ein, strömte in den Raum wie die Mittagssonne. In den Zeitungen erschienen Berichte, und sogar eine Nachrichtenagentur kam vorbei und wollte Informationen über den Verlauf meiner Krankheit. Vermutlich hatte irgendjemand sogar schon meinen Nachruf vorbereitet. Jeder wusste das, worüber ich noch immer nur Vermutungen anstellte.
Als die Heftigkeit dieser besagten Attacke nachließ, dachte ich wieder an Margaret Capel und Gabriel Stanton, konnte aber nicht über sie sprechen. Ella wusste nichts von den früheren Bewohnern des Hauses, und aus irgendeinem unerklärlichen Grund hatte es Dr. Kennedy aufgegeben vorbeizukommen. Sein Partner, oder sein Stellvertreter, den ich an seinem dämlichen Grinsen leicht erkannte, machte trotz seiner Fröhlichkeit keinen Hehl daraus, wie hoffnungslos er meinen Zustand einschätzte. Ich hasste seine vergeblichen, ergebnislosen Untersuchungen, seine Ratschläge, bei denen er, da war ich mir sicher, seine kleinstädtische Selbstgefälligkeit am besten ausleben konnte, seine großen, kühlen Hände an meinem Puls und seine rechthaberische Ahnungslosigkeit. "Der Schmerz ist genau da", verkündete er oft, traf aber nicht einmal zufällig jemals die richtige Stelle.
Zum Glück war Ella da. Sie muss viele Tage, bevor ich sie erkannte, angekommen sein. Der Haushalt lief wie geschmiert, meine Mahlzeiten wurden mir nun auf Tabletts mit feinen Leinentüchern und ein oder zwei Blumen gebracht. Duftender Sprühnebel und frühe Erdbeeren, Daunenkissen und kühlende Bettlaken, ein Wasserbett und vielerlei anderer Luxus sagten mir unbestreitbar, dass sie in der Nähe war. Ich hatte immer gewusst, dass es so kommen würde, dass sie, sobald ich ihr meine Hilflosigkeit eingestanden hatte, ihr Leben zu Hause und all die Freuden ihrer erfüllten Tage aufgeben und nur noch für mich leben würde. Weil ihre Hingabe für mich die meine für sie traf und zu ergreifend für meine zunehmende Schwäche war, hatte ich uns beiden etwas verwehrt – ihr die Freude am Geben und mir die Freude am Nehmen. Nun nahm ich ohne jede Anerkennung oder ein Wort der Dankbarkeit alles an.
"Geh nicht weg", waren die ersten Worte, die ich zu ihr sagte. Ich! – die sie so sehr angefleht hatte, nicht zu kommen, ihre Sorge um mich so lange zurückgewiesen hatte.
"Natürlich nicht. Warum sollte ich? Ich mag das Land, wenn der Frühling kommt", antwortete sie kühl. "Möchtest du irgendetwas?" Sie ging einen Schritt mehr auf mein Bett zu.
"Was ist aus Dr. Kennedy geworden?", fragte ich.
"Ich dachte, du magst ihn nicht. Suzanne sagte mir, dass du ihn oft nicht sehen wolltest, wenn er vorbeikam. Und du hattest völlig recht. Es war offensichtlich, dass er keine Ahnung hatte, was mit dir los war."
"Die hat niemand"
"Du hast uns nicht gerade geholfen." Ihre Augenlider waren leicht rosa, aber sonst machte sie mir keine Vorwürfe.
"Und jetzt werde ich sterben, nehme ich an."
"Sterben! Du wirst nicht sterben, mach dich nicht lächerlich. Außerdem würde ich dies gar nicht zulassen. Und warum solltest du? Menschen sterben nicht an Brustfellentzündung oder Nervenentzündung. Dir geht es heute schon besser als gestern, und morgen wirst du dich noch besser fühlen, das weiß ich."
Draußen mag sie vielleicht geweint haben, denn, wie gesagt, ihre Augenlider waren leicht rosa. Aber hier, an meinem Bett, war sie voller Zuversicht und Mut.
"Ich will Dr. Kennedy. Hole ihn zurück." Ich wollte nicht mit ihr darüber diskutieren, ob ich leben oder sterben würde, es war zu aussichtslos.
"Dieser Lansdowne ist Mitglied im Royal College of Surgeons, nicht nur einfacher Arzt", erinnerte sie mich.
"Das ist mir egal, selbst wenn er der einzige Doktor in ganz England wäre. Er grinst mir ins Gesicht, redet selbstgefälligen Schwachsinn, bevormundet mich, klopft mir auf die Schulter. Er wird meinem Begräbnis von seiner Kutsche aus beiwohnen, das habe ich in seinem Gesicht gesehen."
Hier mischte sich die Krankenschwester ein und bestätigte, dass Dr. Lansdowne ein fähiger Arzt sei.
"Schick Sie aus dem Zimmer", sagte ich zu Ella gewandt. Dieser Einwurf hatte mich massiv verärgert.
"In Ordnung, Schwester, gehen Sie; ich bleibe bei Mrs. Vevaseur, bis Sie gegessen haben. Du wirst nicht mehr so viel reden?", bat sie mich flehentlich.
"Vielleicht", antwortete ich und lächelte. Es war gut, dass Ella wieder bei mir saß.
"Aber der Doktor wollte, dass sie überhaupt nicht spricht und auch keine Besucher empfängt.", hörte ich die Schwester noch sagen.
Ich weiß nicht, wie Ella es schaffte, diese herrische Frau mit dem weißen Häubchen aus dem Raum zu bekommen, aber es gelang ihr – sie hatte unendlich viel Taktgefühl und Geduld.
"Soll ich mein Handarbeitszeug holen? Oder dir lieber etwas vorlesen? Du solltest wirklich nicht reden."
"Weder noch. Du gehst doch nicht weg?"
"Ich bleibe so lange, wie du möchtest."
Kein Wort über die Zeiten, in denen ich ihr brutal ins Gesicht gesagt hatte, sie solle mich in Ruhe lassen, als ich sie in London fast aus dem Haus geworfen hätte, um schließlich vor ihr hierher zu fliehen. Das war typisch Ella, und es war bezeichnend für mich, dass ich ihr nicht einmal danken konnte. Als sie sagte, sie würde bleiben, schien es zu schön, um wahr zu sein. Ich fragte sie hinsichtlich ihrer Verpflichtungen.
"Was ist mit Violet und Tommy?"
"Alles in Ordnung, ich habe bestmögliche Vorkehrungen getroffen. Ich bin ganz frei und werde nicht weggehen, bis du mich darum bittest."
Bedingt durch meine außerordentliche Schwäche begann ich zu weinen, verbarg aber meine Augen, da ich wusste, dass meine Tränen Ella verletzen würden. Ich war für einen kurzen Augenblick über meinen Schatten gesprungen, denn es war so eine Erleichterung, sie hier zu wissen, zu spüren, dass sich jemand um mich kümmerte. Bezahlte Dienste sind nur was für Gesunde.
Ella tat so, als hätte sie meinen kleinen Zusammenbruch nicht bemerkt, obwohl sie selbst nicht weit davon entfernt war. Sie begann, über belanglose Dinge zu sprechen. Wer telegrafiert oder angerufen hatte, dass die Nachricht von meiner Krankheit in den Zeitungen gewesen sei, und so weiter. Alle meine guten Freunde, die ich in diesen trostlosen Monaten vor den Kopf gestoßen hatte, schienen mir plötzlich verziehen zu haben und traten mit aufrichtiger Anteilnahme und Hilfsangeboten an mich heran. Aber davon wollte ich zunächst nichts wissen und bat Ella, nichts mehr von ihnen zu erzählen. Ich fühlte mich beschämt und ihrer Hilfe unwürdig, zumal ich mich nicht daran erinnern konnte, jemals etwas für jemanden getan zu haben.
"Kannst du Dr. Kennedy zurückholen?"
"Er hat dich schändlich vernachlässigt, schrieb mir leichtfertig. Ich wundere mich nicht, dass du ihm verboten hast, dich zu besuchen."
"Ich will ihn zurück."
"Dann sollst du ihn zurückbekommen. Du sollst alles haben, was du willst, nur werde wieder gesund." Sie wandte ihr Gesicht von mir ab.
"Bin ich auf gutem Weg?"
Da sie nicht sofort antwortete, war mir klar, dass sie im Moment ihre Stimme nicht beherrschen konnte.
Also sagte ich eine Weile nichts. Dann begann ich wieder, sie anzuflehen, mich von Lansdowne zu befreien.
"Eigentlich muss er seinen Beruf nicht mehr ausüben", murmelte sie nach einer Zeit des Nachdenkens. Offensichtlich waren ihr seine Gefühle bewusst geworden und dass sie diese nicht verletzen wollte. "Er hat eine reiche Frau geheiratet."
"Das muss er wirklich nicht. Und ich bin sicher, dass er keine Kinder hat", antwortete ich.
"Großer Gott! Woher weißt du das? Du bist krank schlauer als manch andere Leute, die gesund sind."
Auch das war typisch Ella, sie hat eine übertrieben hohe und weltfremde Meinung von meinem Talent. Nur weil ich Romane schreibe, für die mehr bezahlt wird, als sie wert sind!
Ich weiß nicht, wie sie das alles geschafft hat; ich weiß nicht, wie sie in dieser überaus schmerzvollen Zeit auch nur die Hälfte all dieser magischen, wunderbaren Dinge vollbracht hat, die mich so trösteten. Aber ich war nicht einmal überrascht, als es mir ein paar Tage später tatsächlich besser ging und ich im Bett aufsitzen konnte – wohl mit Kissen gestützt, das gebe ich zu, aber ich konnte aufsitzen; und neben mir auf dem Stuhl saß Dr. Kennedy, groß und unverändert, mit dem gleichen Leuchten in seinen Augen, ja sogar in dem gleichen, schrecklichen Tweedanzug. Ella war rausgegangen, als er hereinkam, da sie schon immer der Meinung gewesen war, dass sich Patienten allein mit ihren Ärzten unterhalten sollten. Sie flirtete mit ihrem Hausarzt, glaube ich. Manchmal konnte sie unglaublich kokett sein.
"Sie haben eine schlimme Zeit hinter sich", sagte er abrupt.
"Und sie haben nicht versucht, mir zu helfen", antwortete ich schwach.
"Oh! Aber … Sie wollten mich nicht mehr haben. Ihre Schwester hat mich aus dem Haus komplimentiert. Sie sagte, ich hätte nicht erkannt, wie krank Sie waren, und ich antwortete, dass sie damit völlig recht hatte. Ich hätte ihr sagen sollen, wie oft sie sich geweigert haben, mich zu sehen."
"Wussten Sie, wie krank ich war?"
"Ich bin mir nicht sicher." Wir lächelten beide. "Wie krank waren Sie denn?"
"Jetzt weiß ich, was Margaret Capel von Dr. Lansdowne hielt."
"Er ist ein sehr fähiger Mann. Und schließlich waren ja Felton, Shorter und Lawson bei Ihnen."
"Erinnern Sie mich bloß nicht daran."
"Jedenfalls geht es Ihnen jetzt besser."
"Ist dem so? Ich bin immer noch so schrecklich schwach."
"Fangen Sie bloß noch nicht wieder an zu schreiben! Wissen Sie, jetzt weiß ich alles über Sie. Ich habe mich durch Ihre Romane gelesen."
"Und haben die ganze Zeit daran gedacht, wie viel besser Margaret Capel geschrieben hat?"
"Sie haben Margaret also nicht vergessen?"
"Und Sie?" Er wurde plötzlich ziemlich ernst und blass.
"Ich! Ich werde Margaret Capel nie vergessen."
Bis zu diesem Moment war er ziemlich lässig und unbekümmert gewesen, als ob dieser Besuch, die ganzen Umstände und ich selbst, die schon kurz vor dem Ableben gestanden hatte, überhaupt keine große Rolle spielen würden.
"Haben Sie darüber nachgedacht, wie viel schlechter ich schreibe, dass ich keinen Stil habe?"
"Warum sagen Sie so etwas?"
Ich war froh, ihn zu sehen und wollte ihn an meiner Seite behalten. Eigentlich war ich der Meinung, dass mich meine Worte bei der Erreichung dieses Zieles unterstützen würden.
"Das hat sie mir selbst gesagt." Ich warf ihm den Brocken hin und wartete gespannt, wie er ihn aufnehmen würde. "Das letzte Mal, als ich Sie sah, in der Nacht, als die Rippenfellentzündung einsetzte, saß sie dort drüben am Kamin. Wir unterhielten uns sehr vertraulich, und sie sagte, sie wisse, dass ich ihre Geschichte schreiben würde – und dass sie es schade finde, dass ich keinen Stil habe." Auf seiner Stirn zeigte sich eine leichte Rötung und er sah zu der Stelle, wo sie angeblich gesessen hatte.
"Was hat sie noch gesagt?" Er schien nicht an meiner Geschichte zu zweifeln und war keineswegs überrascht.
"Sie glauben mir, dass ich sie gesehen habe – dass es kein Traum war?"
"Es gibt einen unerforschten Grenzbereich zwischen Traum und Wirklichkeit. Fieber lässt uns dieses oft überbrücken. Ihre Temperatur dürfte sehr hoch gewesen sein. Und schließlich hat sie uns beide sehr beschäftigt. Fahren Sie fort. Erzählen Sie mir, was sie anhatte."
"Sie war in ganz in Grau gekleidet, mit Ausnahme eines weißen Schultertuchs."
"Und einer rosa Rose."
"Ihr Haar –– "
"Wurde durch ein blaues Haarband gehalten." In seiner Erregung beendete er meine Sätze.
"Nein. Sie hatte sich Zöpfe geflochten."
"Oh, nein! Nicht, wenn sie das graue Kleid trug." Er hatte sich erhoben, stand nun vor meinem Bett und wirkte ängstlich, fast flehend. "Denken Sie noch einmal nach. Schließen Sie die Augen und denken Sie an diese Szene. Ganz sicher trug sie das blaue Band."
Ich schloss meine Augen, öffnete sie wieder und starrte ihn an.
"Aber woher wussten Sie das?"
"Fahren Sie fort. Sie trug ein blaues Band im Haar?"
"Als ich sie das erste Mal sah. Das nächste Mal hingen die Haare über ihrem Rücken, zwei große Zöpfe aus blondem Haar – und sie trug einen blauen Morgenmantel."
"Mit einem weißen Kragen, der aussah wie ein feines Taschentuch und ihren schlanken Hals betonte."
"Wie gut Sie ihre Kleidung kannten."
"Sie hatte Geschmack, sogar einen sehr erlesenen Geschmack. Zu diesem grauen Kleid hätte sie ihr Haar niemals offen getragen."
"Sie glauben mir, dass ich sie wirklich gesehen habe."
"Natürlich haben Sie sie gesehen. Fahren Sie fort. Sagen Sie mir genau, was sie gesagt hat, Wort für Wort."
"Sie sprach über meinen schlechten Stil."
"Über Ihre Geistesverwandtschaft mit ihr."
"Sie sagte, ich solle die Geschichte schreiben. Ihre und die von Gabriel Stanton."
Ich erzählte ihm alles, was sie gesagt hatte, Wort für Wort, so gut ich mich daran erinnern konnte; dabei hielt ich meine Augen geschlossen, sprach langsam und betont – und ich erinnerte mich wirklich sehr gut.
"Sie erzählte mir von den Briefen und dem Tagebuch, den Notizen, den Kapitelüberschriften, alles, was sie vorbereitet hatte ––. "
Ich wandte meinen Kopf ab und versank in den Kissen. Ich wollte nicht, dass er meine Enttäuschung darüber sah, nichts gefunden zu haben. Jetzt spürte ich deutlich meine Schwäche, wie viele Nächte ich mit Fieber und Schmerzen zugebracht hatte.
"Mir fehlt die Kraft weiterzusprechen." Er legte seine Hand auf meinen Puls.
"Ihr Puls ist ziemlich schnell."
"Ich habe nichts gefunden", sagte ich knapp. Ich wünschte, Ella würde zurückkommen.
"Sie haben die Papiere gesucht?" Ich gab keine Antwort.
"Es tut mir so leid. Ich Tölpel! Sie suchten und suchten – deshalb sollte ich mich fernhalten, wollten Sie mich nicht sehen, wollten allein sein. Sie waren die ganze Zeit auf der Suche. Warum ist mir das nicht früher aufgefallen? Aber woher hätte ich wissen sollen, dass sie zu Ihnen kommen und sich Ihnen anvertrauen würde?"
Er führte jetzt Selbstgespräche, schien mich und meine schwere Krankheit vergessen zu haben. "Ich hätte es mir eigentlich denken können. Vom ersten Moment an habe ich mir vorgestellt, wie Sie auf Margaret treffen. Ich habe sie. Ich habe sie genommen – sind Sie nicht auf diese Idee gekommen?" Ich vergaß die extreme Erschöpfung, über die ich geklagt hatte, und ergriff ein wenig atemlos den Ärmel seines Mantels.
"Sie nahmen sie an sich – stahlen sie?"
"Ja, wenn Sie es so ausdrücken wollen. Wer hätte mehr Recht dazu gehabt? Ich wusste alles. Ihr Vater, ihre Familie, die wussten nichts, oder sehr wenig. Und sie hätte nicht gewollt, dass sie etwas erfahren."
"Sie wollte die Geschichte schreiben, wie auch immer diese enden würde – sie wollte sie veröffentlichen."
"Nein!, nicht sofort, erst lange danach, wenn sie niemanden mehr damit verletzen würde. Die Briefe lagen in einer Schreibtischschublade, mit einem Gummiband zusammengehalten. Mit Papieren und Dokumenten war sie in der Regel nicht sehr ordentlich, aber diese waren sauber sortiert. Das Tagebuch war in weiches, graues Leder gebunden, und ich fand auch ein paar hin gekrakelte Notizen; lose, auf Manuskriptpapier. Über alles, was damals passiert ist; die Aufregung war riesengroß. Wie hätte ich es verantworten können, dass ihre Papiere, seine Briefe, ihre Notizen in fremde Hände fielen. Ich tat ihr einen Gefallen, wusste, dass es ihr Wunsch gewesen wäre. An dem Tag, an dem sie – an dem sie starb, sammelte ich alles Material zusammen, steckte es in meine Manteltasche; der Wagen stand vor der Tür. Ich eilte davon wie ein Dieb in der Nacht – der Dieb, für den sie mich halten."
"Bin schnell nach Hause gefahren und habe mich den ganzen Abend daran ergötzt."
"Aber ich schwöre Ihnen, bei meiner Ehre, ich habe das Bündel nie geöffnet. Ich habe nie einen Brief gelesen. Ich habe aus allem, was ich gefunden habe, ein großes Päckchen geschnürt – aus den Briefen, dem Tagebuch, den Notizen; ich habe alles zusammen in braunes Papier gewickelt, mit Kordel verschnürt und versiegelt."
"Sie haben es immer noch!" Jetzt war ich sehr erregt, mein Puls raste, das Gesicht war puterrot und die Hände heiß. Mir stockte der Atem.
"Im Safe meiner Bank. Ich brachte die Dokumente am nächsten Morgen dorthin."
"Werden Sie mir das Päckchen geben?"
"Aber natürlich." Plötzlich schien er sich daran zu erinnern, dass ich die Kranke und er mein Arzt war. "Wissen Sie, diese ganze Aufregung ist sehr schlecht für Sie. Ihre Schwester wird mich sicher wieder rauswerfen. Können Sie sich nicht einfach hinlegen und still sein? Ihr Puls ist von 90 auf 112 gesprungen." Seine Hand lag wieder auf meinem Handgelenk. Ich wusste, dass ich am Ende meiner Kräfte war und verfluchte meine Schwäche.
"Sie werden Ihre Meinung nicht ändern!" Mittlerweile lag ich fast bewegungslos auf dem Rücken und versuchte seinem Rat zu folgen und mich zu beruhigen." Versprechen Sie es mir!"
"Ich hole das Päckchen morgen früh, sobald die Bank geöffnet ist, und komme gleich damit hierher. Sie müssen einen Platz aussuchen, wo ich es hinlegen soll. Ich meine, wo Sie es sehen können und die ganze Zeit wissen, dass es da ist. Aber Sie dürfen es nicht öffnen, dazu muss es Ihnen erst besser gehen. Sie verstehen doch, dass Sie es noch nicht öffnen dürfen?"
"Doch, das werde ich."
"Das wäre sehr falsch. Es würde Ihnen nicht guttun."
"Ich habe es satt, herumkommandiert zu werden." Ich konnte mich kaum noch bewegen, das Atmen fiel mir immer schwerer und ich hatte das Gefühl drohender Ohnmacht, des Erstickens – der Raum wurde zusehends dunkler. Kennedy öffnete die Tür und rief die Krankenschwester, die kurz darauf mit Ella hereinkam. Das zumindest hatte ich noch erkannt.
"Was nimmt sie, wenn es ihr so geht? Riechsalz, Brandy?" Die Krankenschwester fächelte mir langsam Luft zu, da meine Wangen sehr gerötet waren.
Ella öffnete leise die Fenster, sodass der Duft des Ginsters in den Raum strömen konnte. Ich wollte nicht sprechen, nur in der Lage sein zu atmen.
Die Krankenschwester warf Dr. Kennedy einen fragenden Blick zu. Strychnin?, fragten ihre stummen Lippen. Er schüttelte den Kopf.
"Sauerstoff. Haben Sie eine Sauerstoffflasche im Haus?" Er zog mir die Kissen unter meinem Kopf weg.
Ich weiß nicht mehr, was sie alles versucht oder nicht versucht haben. Jedes Mal, wenn ich die Augen öffnete, suchte ich nach Ellas. Ich wusste, sie würde nicht zulassen, dass mir irgendetwas angetan wurde, was den Schmerz zurückbringen könnte. Ich war nur übermüdet, und nach kurzer Zeit konnte ich das auch zum Ausdruck bringen. Als es mir endlich besser ging und Dr. Kennedy weg war, sagte Ella ein oder zwei herbe Worte über ihn. Auch die Krankenschwester fand, dass man sie früher hätte rufen sollen. Sie war eine gute Krankenschwester, war aber weder einverstanden mit meiner ganzen bisherigen Behandlung noch mit meinem Wechsel des Arztes, meinem Widerstand gegen jegliche Autorität und Ellas Einmischung.
"Ella." Sie hatte am Feuer gesessen, kam aber sofort zu mir herüber.
"Was ist los? Ich werde nur noch kurz hierbleiben, dann überlasse ich dich der Krankenschwester. Dieser Mann war zu lange bei dir und hat dich ausgelaugt. Er darf nicht mehr herkommen, da er keine Ahnung von dem hat, was dir wirklich fehlt."
"Doch, das versteht er sehr gut." Obwohl meine Stimme noch etwas schwach war, schaffte ich es irgendwie, sie eindringlich klingen zu lassen. "Ella, ich will ihn morgen früh wiedersehen, das darf nichts und niemand verhindern. Sprich nicht schlecht über ihn, ich will, dass er kommt."
"Dann soll es so sein", entschied sie prompt. Trotz meiner furchtbaren Schwäche und Atemnot lächelte ich sie an.
"Ich fürchte, du hast dich in ihn verliebt", sagte sie. Liebe und Liebeswerben waren ihr halbes Leben, das Spiel, das sie am faszinierendsten fand. Mit meinem eigentlichen Anliegen hatte jedoch beides nichts zu tun.
"Sieh zu, dass er kommt. Das ist alles, was ich will. Egal, wie krank ich bin, oder ob ich überhaupt krank bin, er soll kommen."
"Hast du seine Kleidung bemerkt?"
"Oh, ja!"
Die Krankenschwester muss gedacht haben, wir seien beide verrückt geworden. Aber sie kam einfach nur zu mir herüber, verlagerte mich in eine bequemere Position, fächerte mir wieder zu, bis es mir etwas besser ging, und brachte dann den Schwamm, Eau de Cologne und Wasser, um mein Gesicht und meine heißen Hände zu waschen. Sie sagte Ella, dass sie gehen solle, dass ich allein sein müsse und besser schlafen würde, wenn ich auf mich allein gestellt wäre – und Ella wollte nur das Beste für mich.
"Ich bin sicher, dass Sie recht haben, Schwester. Ich werde nicht nochmal reinkommen. Schlaf gut."
"Du bist wirklich sicher?"
"Sicher, dass Dr. Kennedy morgen früh kommen wird, und wenn ich ihn hierher schleifen muss. Es ist allerdings schade, dass du einen Henker einem richtigen Doktor gegenüber bevorzugst; er scheint dir jedes Mal, wenn er kommt, mehr zu schaden. Du hattest deinen schlimmsten Anfall, als er vorhin hier war. Gute Nacht! Ich wünschte, du hättest einen besseren Geschmack."
Sie behielt ihren lässigen Tonfall bis zum Schluss bei, obwohl ich sehr wohl bemerkt hatte, dass sie vor Sorge und Mitgefühl blass geworden war. Vor Tagen hatte sie mich gefragt, ob die Krankenschwestern gut und freundlich zu mir seien und ob ich sie mochte, woraufhin ich ihr versichert hatte, dass zumindest diese hier die beste war, die ich jemals hatte, klug und unermüdlich. Wenn sie nur nicht so selbstsicher gewesen wäre und immer besser wusste, was gut für mich war, hätte ich sie für perfekt gehalten. Sie hatte eine entzückende Stimme, berührte mich nie unnötig oder rumpelte gar gegen das Bett. Aber sie war jünger als ich, und deswegen nahm ich ihr ihre Fachkenntnis übel. Wir gerieten oft aneinander, denn ich war eine schlechte Kranke, ständig auf Konfrontation aus. Ich hatte noch nicht begriffen, wie man sich als Kranke verhält! Ich lernte diese Lektion ebenso langsam wie grausam, obwohl ich Benhams Qualitäten schon lange vorher erkannt habe, bevor ich ihr schlussendlich nachgab. Jetzt war ich froh, dass Ella gehen und die Krankenschwester sich allein um mich kümmern sollte. Ich wollte, dass die Nacht kommt – und wieder geht. Aber meine Erschöpfung war so vollkommen, dass ich vergessen hatte, warum.