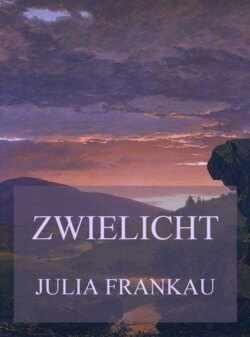Читать книгу Zwielicht - Julia Frankau - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL III
ОглавлениеIch scheine nur langsam zur eigentlichen Geschichte zu kommen, da mir meine eigene ständig in die Quere kommt, mein eigener Leidensweg der Abhängigkeit und ständig schlimmer werdender Krankheit. Benham war meine Tagesschwester. An diesem Abend verließ sie mich gegen zehn Uhr, da es mir wesentlich besser ging und ich bedeutend ruhiger geworden war. Dann trat Lakeby ihren Dienst an, ein weitaus weniger kompetenter Mensch, der immer mit mir sprach, als müsse er ein Kind bespaßen: "Nun denn, seien Sie ein braves Mädchen und trinken Sie das aus" trifft es ziemlich gut. Dann gähnte sie mir ganz unverschämt ins Gesicht, ohne sich die Mühe zu machen, ihre Müdigkeit oder Langeweile zu verbergen, oder sich gar für ihr Benehmen zu entschuldigen. Mein Schlaftrunk und ich waren keine Freunde mehr. Obwohl er mir keine Ruhe mehr verschaffte, trank ich ihn aus, um Streit aus dem Weg zu gehen. Dann nahm Lakeby mir das Glas ab und legte sich auf das Sofa am Fußende des Bettes. Wie schon so oft zuvor dachte ich erneut, dass wohl kein anderer Mensch so fest schläft wie eine Nachtschwester. Ich konnte meiner Rastlosigkeit frönen, ohne Angst haben zu müssen, sie zu stören. Die Aufregung, die der morgige Tag vermutlich mit sich bringen würde, ließ mich nicht schlafen. Ihre Briefe – genau die Briefe, die sie sich gegenseitig geschrieben hatten! Das Tagebuch war mir nicht so wichtig. Ich hatte selbst einmal Tagebuch geführt und wusste, dass man darin alles Wesentliche wegließ. Ich nehme an, dass ich daraufhin ein wenig eingenickt bin. Wie gesagt, waren mein Schlaftrunk und ich keine Freunde mehr, aber wir waren auch keine Feinde – eher enttäuschte Liebende, die sich nicht mehr aufeinander verlassen konnten. Als ich mich dem besagten Grenzgebiet näherte, wünschte ich mir, Margaret säße in ihrem Sessel am Kamin. Es war mir gleichgültig, ob sie ihr graues Kleid trug, oder ihr Haar in Zöpfen hing oder mit Bändern gebunden war. Aber ich hielt vergeblich Ausschau nach ihr. Mir war klar, dass sie nicht kommen würde, solange die Krankenschwester auf dem Sofa schnarchte. Ella musste diese Krankenschwester irgendwie loswerden, sie aus meinem Zimmer verschwinden lassen. Sicherlich konnte ich jetzt, da es mir besser ging, allein schlafen – eine Glocke wäre die Lösung! Zwei Krankenschwestern waren unnötig, fast schon verschwenderisch. Dann holte mich ein kurzer Husten aus meinem Dämmerschlaf und mich überkam ein seltsames Gefühl. Ich knipste das Licht an meiner Seite an, konnte aber die Krankenschwester (die den lieben, langen Tag geschlafen hatte) nur mit Mühe wecken. Ich wusste, was geschehen war, obwohl ich es selbst gerade zum ersten Mal erlebt hatte, und wollte sie oder mich beruhigen. Auch wollte ich ihr sagen, was sie zu tun hatte.
"Holen Sie Eis. Rufen Sie Benham, und sagen Sie dem Doktor Bescheid." Dies war meine erste Hämorrhagie, sehr stark und besorgniserregend, und obwohl Lakeby fachlich nicht brillieren konnte, war sie dennoch nicht ineffizient. Obwohl sie wirklich aufgeregt war, führte sie meine Anweisungen buchstabengetreu aus. Sobald Benham im Raum war, wusste ich zumindest, dass ich mich in guten Händen befand. Ich flehte sie an, das Haus nicht vollständig aufzuwecken und vor allem Ella nicht zu rufen.
"Sprechen Sie nicht und bleiben Sie ganz ruhig liegen. Wir wissen genau, was zu tun ist. Ich werde Mrs. Lovegrove nicht wecken, und auch sonst niemanden, wenn Sie nur tun, was man Ihnen sagt."
Benhams Stimme änderte sich jedes Mal, wenn es einen Notfall gab; sie besaß eine schöne Stimme, obwohl sie manchmal ein wenig hart klang; aber jetzt war sie sanft, weich, und auch ihr ganzes Verhalten hatte sich verändert. Sie hatte mich und die Situation vollständig unter ihrer Kontrolle, und das war genau das, was sie immer wollte. In dieser Nacht war sie die perfekte Krankenschwester. Lakeby gehorchte ihr, als wäre sie eine Lernschwester. Ich frage mich oft, ob ich Benham nicht dankbarer hätte sein, mich schneller an sie gewöhnen hätte sollen. Ich habe es eigentlich nicht so sehr mit der Dankbarkeit, aber in dieser Nacht, in dieser schrecklichen Stunde, bewunderte ich ihre umfangreichen und wunderbaren Fähigkeiten. Ich hatte hohes Fieber, war sehr aufgewühlt, aber dennoch bemüht, die Kontrolle über meine Nerven zu behalten.
"Es sieht schlimm aus, ich weiß, aber es ist nicht wirklich ernst – es ist nur ein Symptom, keine Krankheit an sich. Alles, was Sie tun müssen, ist, ganz ruhig zu sein. Der Doktor wird bald hier sein."
"Ich habe keine Angst."
"Pst! Dessen bin ich mir sicher."
Meine Füße bekamen eine heiße Bettflasche, mein Mund kleine Eiswürfel zum Saugen; in Windeseile legte sich eine angenehm warme Decke um mich, die Jalousien wurden zur Seite geklappt und das Fenster geöffnet – es gab nichts, woran sie nicht gedacht hätte. Und das Wenige, was sie sagte, hatte Sinn und Zweck; sie machte sich nicht über meine Schmerzen lustig, sondern erklärte, linderte sie, und half mir, meine verwirrten Nerven zu beruhigen.
"Ich würde Ihnen ja eine Morphiumspritze geben, aber Dr. Kennedy muss jeden Moment hier sein."
Ich glaube nicht, dass es lange danach gewesen sein kann, bevor er im Raum stand. In der Zwischenzeit lernte ich den Anblick meines eigenen Blutes zu hassen und bat die Krankenschwestern immer wieder, oder gab ihnen entsprechende Zeichen, die Schüsseln zu leeren und die befleckte Kleidung zu wechseln.
Schwester Benham erzählte Dr. Kennedy sehr leise, was geschehen war. Er sah mich an und sagte ermutigend:
"Sie werden bald wieder gesund sein."
Ich hustete immer noch Blut und fühlte mich nach seinen Worten nicht wesentlich beruhigter. Ich hörte, wie er um heißes Wasser bat. Die Krankenschwester und er saßen an der Kommode und flüsterten miteinander. Dann kam die Schwester zurück zum Bett.
"Dr. Kennedy wird Ihnen eine Morphiumspritze geben, die die Blutung sofort stoppen wird.
Als sie den Ärmel meines Nachthemdes hochkrempelte, sah ich ihn neben sie treten.
"Wie viel?", stammelte ich leise.
"Nur etwa sechzehn Milligramm", antwortete er leise. "Ich denke, das wird reichen. Falls nicht, können Sie mehr bekommen."
Ich fand schon den Stich mit der Nadel nicht sehr wohltuend, und dass er danach mit dem Finger noch über die verletzte Stelle strich, machte die Sache für mich noch schlimmer. Aber schon bald machte es mir nichts mehr aus und auch seine Anwesenheit störte nicht länger. Er war immer noch in Tweed gekleidet, der nach Ginster oder Torf roch – nach irgendetwas Angenehmem.
"Wird es besser?" Es gab keinen Zweifel, dass die Blutung weniger wurde; ich zitterte auch nicht mehr und die Besorgnis war ebenfalls besser geworden. Er fühlte meinen Puls und sagte, er sei jetzt "sehr gut."
"Das übliche Gegackere!" Ich konnte sogar wieder lächeln.
"An Ihrer Stelle würde ich nicht reden." Er lächelte zurück. "In einer halben Stunde werden Sie sich viel besser fühlen."
"Ich fühle mich schon jetzt nicht wirklich schlecht."
Er antwortete mit einem leisen, sehr angenehmen Lachen.
"Ist sie nicht wundervoll?", fragte er Benham. Die Schwester war gerade dabei, jedes Überbleibsel des gerade Geschehenen zu entsorgen, und ich spürte erneut, wie fachkundig die beiden waren und dass ich mich in guten Händen befand. Ich war froh, dass Ella schlief und nichts von dem mitbekommen hatte, was gerade geschehen war.
Dr. Kennedy stand wieder drüben vor der Kommode.
"Ich lasse noch eine Dosis da", hörte ich, während er sich mit Benham unterhielt. Dann kam er, um sich von mir zu verabschieden.
"Kann ich nicht allein schlafen? Ich hasse es, wenn jemand bei mir im Zimmer ist." Ich wollte hinzufügen: "Das verdirbt mir meine Träume", bin mir aber nicht sicher, ob ich die Worte wirklich ausgesprochen habe.
"Sie werden sehen, bald werden Sie wieder gesund sein, kerngesund. Die Krankenschwester wird den Rest erledigen. Alles, was Sie tun müssen, ist zu schlafen. Falls Ihnen dies nicht gelingt, wird sie Ihnen eine weitere Dosis geben. Ich habe sie abgemessen und lasse sie hier. Sie haben doch keine Angst, oder?"
"Nein."
"Die guten Träume werden kommen, keine Sorge. Ich wünsche sie Ihnen von ganzem Herzen." Es fiel mir schwer, mich zu konzentrieren.
"Was haben Sie mir vorhin versprochen?"
"Nichts, was ich nicht halten werde. Gute Nacht –– "
Dann ging er schnell weg.
Ich war wacher, als ich es mir wünschte, und schon bald tobte der Wunsch, irgendetwas zu tun, in meinem durcheinander geratenen Verstand. Ich hatte gedacht, eine Blutung würde den Tod bedeuten, und dass ich noch so viele Dinge erledigen hätte sollen. Ich konnte mich nicht mehr an die Bestimmungen meines Testaments erinnern und war mir sicher, dass es ungerecht war. Ich hätte zu so vielen Menschen freundlicher sein sollen, zu den Toten wie zu den Lebenden. Es ist so leicht, verletzende und besserwisserische Dinge zu sagen, und so schwer, diese wieder zurückzunehmen. Ich erinnerte mich an einen besonderen Akt der Unfreundlichkeit – selbst jetzt kann ich es nicht ertragen, daran zu denken. Immerhin geschah er gegenüber jemandem, der mittlerweile gestorben ist. Und Ella – Ella wusste nicht, dass ich ihre Liebe erwiderte, in vollem Umfang, im Übermaß. Einmal, vor sehr vielen Jahren, als sie in einer Notlage war und mich für sehr reich hielt, bat sie mich, ihr fünfhundert Pfund zu leihen. Weil ich das Geld nicht hatte und zu stolz war, dies zuzugeben, war ich so unhöflich zu ihr, dass ich es selbst heute kaum glauben kann, und fragte sie, warum ich arbeiten sollte, um ihre Verschwendungssucht zu unterstützen. Aber sie war nie wirklich verschwenderisch, außer beim Geben. Oh, Gott! Diese fünfhundert Pfund! Wie oft habe ich daran gedacht. Was gäbe ich nicht dafür, nicht nein gesagt, meinen Stolz bezwungen, zugegeben zu haben, dass ich so eine große Summe gar nicht besaß. Nun gab sie ihr ganzes Geld für mich aus. Und wenn ich wirklich sterben musste, was mir durchaus möglich erschien, wäre sie ganz allein auf dieser Welt gewesen. Jede von uns war ohne die andere immer einsam gewesen. Schwesternliebe unterscheidet sich von gewöhnlicher Liebe. Seit unserer Kindheit hatten wir jeweils im Bett der anderen geschlafen, uns gegenseitig all unsere kleinen Geheimnisse erzählt, uns gegen Kindermädchen und Gouvernanten verbündet, und uns dennoch unsere Intimität unter sich ständig verändernden und wechselnden Umständen über lange und abwechslungsreiche Jahre bewahrt. Ella würde einsam sein, wenn ich tot wäre. Das wusste ich. Ein oder zwei heiße Tränen flossen aus meinen geschlossenen Lidern, während ich an Ellas wahrscheinliche Einsamkeit dachte. Ich wischte sie mit dem Laken ab und bemerkte, dass sich der Raum seltsam und ruhig anfühlte – allerdings war er nicht ganz stabil, was mir klar wurde, als ich die Augen öffnete. Also schloss ich sie. Das Morphium begann zu wirken.
"Warum weinen Sie?"
"Wie konnten Sie das von da drüben sehen?" Aber ich wollte nicht mehr weinen und hatte Ella bereits vergessen. Während sie sprach, öffnete ich die Augen. Das Feuer glühte schwach und der Raum war fast dunkel, jetzt wieder stabil wie immer. Margaret saß am Kamin, und ich sah sie deutlicher als je zuvor – ein blasses, kluges, wunderliches Gesicht, ausgezehrt und dennoch mit lebhaften Zügen und grauen Augen.
"Es ist absurd zu weinen", sagte sie. "Als ich zu weinen aufhörte, gab es auf der Welt keine Tränen mehr. All der Kummer, all das Unglück starb mit mir."
"Warum waren Sie so unglücklich?", fragte ich.
"Weil ich eine Närrin war", antwortete sie. "Wenn Sie meine Geschichte erzählen, müssen Sie es so mitfühlend wie möglich tun, damit mein Tod den Leuten leidtut. Aber es ist die Wahrheit – ich war unglücklich, weil ich eine Närrin war."
"Sie glauben immer noch, dass ich Ihre Geschichte schreiben werde. Die Kritiker werden sich freuen –– " Ich dachte an alles, was sie sagen würden, die schmeichelhaften Worte in den Zeitungen.
"Warum haben Sie geweint?", beharrte sie. "Sind Sie auch eine Närrin?"
"Nein. Aber ich will nicht sterben, um Ellas Willen."
"Davor brauchen Sie keine Angst zu haben. Liebt Ella Sie? Falls ja, wird sie Sie hier behalten. Gabriel hat mich nicht genug geliebt. Wenn uns jemand dringend braucht und uns von ganzem Herzen liebt, sterben wir nicht."
"Hat niemand Sie so geliebt?"
"Naja – ich bin gestorben", antwortete sie kurz angebunden und starrte ins Feuer.
Meine Gliedmaßen entspannten sich und ich fühlte mich schläfrig. Dennoch war ich mittlerweile überzeugt von meiner großen Begabung. Ich war mir selbst nie gerecht geworden, aber mit dieser Geschichte über Margaret Capel würde ich groß herauskommen. Ich schrieb in Gedanken den Eröffnungssatz – einen herrlichen Satz, fesselnd. Und dann fuhr ich mit nie gekannter Leichtigkeit fort. Mir, die ich immer nur unter allergrößten Schwierigkeiten geschrieben hatte, langsam, jeden Satz immer wieder von vorne beginnend, abwägend und bewertend, strömten die Sätze geradezu aus der Feder. Ich schrieb und schrieb.
De Quincey hat noch nicht das letzte Wort über Morphiumträume gesprochen. Andererseits ist es schade, dass er überhaupt so gute Worte dafür gefunden hat, und sich deswegen nur wenige gute Schriftsteller trauen, ihre Erfahrungen zu erzählen. In den nächsten Tagen wandelte ich, wie ich hinterher erfuhr, zwischen Leben und Tod, die Temperatur nie unter 39 Grad, während die Blutung immer wieder von neuem einsetzte. Ich weiß nur noch, dass es ruhige und glückliche Tage waren. Ella war bei mir, und wir verstanden einander perfekt, ganz ohne Worte. Die Krankenschwestern kamen und gingen, aber am liebsten war mir, wenn Benham bei mir war, da sie meine Bedürfnisse kannte und genau wusste, wann ich durstig war oder dieses oder jenes wollte. Ganz im Gegensatz zu Lakeby, die ständig redete, dumme, angeblich schmerzlindernde Sprüche von sich gab, meine Kissen aufschüttelte, wenn ich in Ruhe gelassen werden wollte, das Bett berührte, wenn sie daran vorbeiging, mich zu dem überredete, was ich sowieso bereitwillig getan hätte, und meine Erholung insgesamt so gut wie möglich hinauszögerte. Am liebsten war ich allein, denn dann sah ich Margaret. Sie sprach nie über etwas anderes als über sich selbst, die Briefe, das Tagebuch und die Notizen, die sie mir hinterlassen hatte. Wir hatten seltsame, kleine, absurde Auseinandersetzungen. Ich sagte ihr, sie solle nicht daran zweifeln, dass ich ihre Geschichte schreiben würde; sagte ihr, dass ich es liebte, zu schreiben, ich dafür lebte und jeder Tag leer war, der kein geschriebenes Wort enthielt; dass ich nur die Vollkommenheit des Lebens genießen konnte, wenn ich an meinem Schreibtisch saß, meine Augen auf einen weit entfernten Horizont richten konnte und die Menschen meiner Fantasie und Einbildung sah, mit denen ich intimer sein konnte als mit allen, die ich auf Empfängen und überfüllten Dinnerpartys traf.
"Die Absurdität daran ist, dass jemand, der das fühlt, was Sie gerade beschrieben haben, so schlecht schreibt. Ich kann es kaum fassen, dass Sie das Naturell eines Schriftstellers haben, aber das Talent dafür vermissen lassen", sagte sie einmal zu mir.
"Warum sagen Sie, dass ich schlecht schreibe? Meine Bücher verkaufen sich gut! "Ich erzählte ihr, was ich mit meinen Büchern verdiente, und von dem mich liebenden, amerikanischen Publikum.
"Verkaufen! Verkaufen! " Sie klang sehr verächtlich. "Hall Caine verkauft sich besser als Sie, und Marie Corelli und Mrs. Barclay auch."
"Dann sollte ich vielleicht lieber einem dieser Schriftsteller Ihre Aufzeichnungen übergeben?", fragte ich übellaunig. Obwohl ich jetzt verärgert war über sie, wollte ich dennoch nicht, dass sie geht. Früher war sie oft wie ein plötzlich ausgehendes Licht verschwunden. Ich glaube, das war immer, als ich eingeschlafen bin; aber heute wollte ich nicht wach bleiben und sie reden hören. Sie neigte dazu, melancholisch oder gar zynisch zu werden, und das machte meine Stimmung, mein Wohlbefinden, um so viel schlechter.
Jede Nacht und jeden Morgen gaben sie mir meine Morphiumspritzen – bis zu dem Morgen, an dem ich sie verweigerte, sehr zur Überraschung von Dr. Kennedy und entgegen Benhams Protesten.
"Sie tun Ihnen gut, und Sie werden sie hoffentlich nicht vollkommen ablehnen?"
"Sie können mir heute Abend wieder eine verabreichen. Tagsüber brauche ich keine. Die Blutung hat aufgehört." Dr. Kennedy unterstützte meine Ablehnung. Ich muss zugeben, die nächsten Tage waren grässlich. Ich fühlte mich völlig krank und hilflos, und wurde mir schrecklich dessen bewusst, was alles um mich herum vor sich ging. Die mit so einer extremen Krankheit einhergehenden Notwendigkeiten sind für einen denkenden Menschen mit normalen körperlichen Gewohnheiten fast unerträglich. Die Schnabeltasse, das gluckernde Wasserbett, der Verlust jeder Privatsphäre, kommen stündlich wiederkehrenden Demütigungen gleich. Man verliert selbst seine bescheidensten Ansprüche. Aber langsam ging es mir wieder besser, obwohl niemand, wie ich hinterher hörte, erwartet hatte, dass ich überleben würde. Die Ärzte hatten mich aufgegeben, ebenso die Krankenschwestern. Nur Dr. Kennedy und Ella weigerten sich, die Hoffnungslosigkeit zu akzeptieren. Je besser es mir ging, desto überheblicher wurde Ella – ganz im Gegensatz zu Benham. Die eine zog mich hübsch an, fertigte adrette Mützen aus Spitze und Schleifen, schickte nach London, um dort wunderbare Jacken und Nachthemden zu besorgen, und tat insgesamt so, als sei ich außer Gefahr und auf dem Weg der Genesung, lange bevor ich überhaupt normale Temperatur hatte. Benham hingegen widersetzte sich all dem Luxus, den Ella und ich angeordnet hatten, und gegen den Dr. Kennedy nie protestiert hatte. Besucher zu empfangen, im Bett aufzusitzen, Zeitungen zu lesen, die diätetische Ernährung einer Kranken gegen Kaviar und Gänseleber aufzugeben –fetthaltige und schwer verdauliche Gerichte. Benham verachtete Dr. Kennedy und behauptete, man könnte seine Anordnungen leicht umgehen und ihn im Gegenteil dazu bringen, das zu sagen, was immer wir wollten. Mehr als einmal drohte sie damit, ihre Stellung zu kündigen. Aber ich wollte nicht, dass sie geht. Ich wusste, auch wenn ich es mir nicht eingestehen wollte, dass meine Gesundung nicht gesichert war. Ich hatte kein wirkliches Selbstvertrauen, war viel schwächer als alle anderen um mich herum vermuteten, und zeigte beunruhigende Symptome. Es erschöpfte mich, mich ständig mit ihr zu streiten, was ich ihr eines Tages auch sagte, ebenso, dass sie meine Genesung hinauszögerte. "Ich bin älter als Sie, und ich hasse es, wenn man mir Befehle erteilt oder widerspricht."
"Aber ich bin so viel erfahrener was Krankheiten angeht. Sie wissen, dass ich nur das Beste für Sie will. Sie sind nicht mal stark genug, um die Hälfte der Dinge zu tun, die Sie vorhaben. Sich wickeln Dr. Kennedy um den kleinen Finger, Sie und Mrs. Lovegrove. Er weiß sehr wohl, dass Sie nicht aufstehen und sich mit Menschen treffen sollen. Als nächstes werden Sie noch ins Erdgeschoss gehen wollen. Und dann diese Dinge, die Sie essen!"
"Und nächste Woche werde ich hinuntergehen. Aber ich nehme an, ich werde schon erschöpft sein, bevor ich an der Treppe bin, nur weil ich wieder mit Ihnen darüber streite, ob ich gehen sollte oder nicht."
Zu diesem Zeitpunkt war ich die Nachtschwester erfolgreich losgeworden, und Benham kümmerte sich Tag und Nacht hingebungsvoll um mich. Sie war längst nicht mehr gleichgültig. Dennoch reizte sie mich aufs Äußerste, und wir stritten unerbittlich. Ging es mir allerdings nur ein kleines bisschen schlechter, bekam ich sie nicht mehr aus dem Zimmer. Sie machte mir nie Vorwürfe, das muss ich ihr zugutehalten. Als mir meine Galle ein krankhaft üppiges Abendessen mit Melone und Hummer amerikanischer Art sehr übelnahm, stand sie stundenlang an meiner Seite und probierte jede erdenkliche Medizin – und ohne ein Wort des Vorwurfs.
Nach meiner Blutung hatte ich ein paar Wochen Ruhe vor der Nervenentzündung, aber dann setzte sie wieder ein. Ich schrie nach meinem dereinst aufgegebenen Schlaftrunk, aber Peter Kennedy und Schwester Benham stimmten ausnahmsweise einmal in ihrer Meinung überein und überredeten – oder besser zwangen mich – zur Einnahme von Codein. Die geschätzte Halbschwester meines geliebten Morphiums und ich wurden sofort Freunde. Drei oder vier Tage später verschwand die Nervenentzündung plötzlich und kam nie mehr zurück. Eines Nachts nahm ich zusätzlich meinen Schlaftrunk, und in dieser Nacht sah ich Margaret Capel wieder.
"Wann werden Sie anfangen?", fragte sie sofort.
"Sobald ich einen Griffel halten kann. Momentan zittert meine Hand noch. Außerdem sind Ella oder die Krankenschwester immer bei mir. Ich bin nie allein."
"Sie haben mich ganz vergessen", sagte sie voller unbeschreiblicher Traurigkeit. "Sie wollen meine Geschichte überhaupt nicht mehr schreiben."
"Nein, ich habe Sie nicht vergessen. Und ich werde schreiben. Aber wenn man so krank war –– ." Fast flehte ich sie an.
"Andere Menschen schreiben auch, wenn sie krank sind. Erinnern Sie sich an Green und Robert Louis Stevenson. Und was mich betrifft, ich habe mich nie wirklich wohl gefühlt."
Am nächsten Tag, bevor Dr. Kennedy kam, bat ich Benham, uns beide allein zu lassen. Er kam immer noch täglich, aber sie missbilligte seine Methoden mehr und mehr und sagte mir, dass sie nur im Raum blieb und ihm ihren Bericht erstattete, weil sie es für ihre Pflicht hielt. Die beiden standen sich diametral entgegen. Ihr Verstand arbeitete wissenschaftlich, weswegen sie fest an medizinisches Fachwissen glaubte. Sein Verstand war einfallsreich, manchmal planlos, zweifelnd, aber aufgeschlossen und nachfragend. Beide waren an mir interessiert, hatte mir zumindest Ella versichert. Mittlerweile war sie damit zufrieden, wie mich der Doktor als auch die Krankenschwester versorgten. Mindestens eine Woche war vergangen, seit sie das letzte Mal einen der beiden ersetzen wollte.
Als wir allein waren, sagte Dr. Kennedy dasselbe, was er gesagt hätte, wenn die Krankenschwester neben ihm gestanden wäre:
"Nun, wie geht es Ihnen heute?"
"Hervorragend." Und dann fragte ich ihn ohne Umschweife, obwohl wir seit Wochen nicht mehr darüber gesprochen hatten und in der Zwischenzeit so viel passiert war: "Was haben Sie mit dem Päckchen gemacht? Ich möchte es jetzt haben. Mir geht es bereits ziemlich gut."
"Sie haben sie seitdem nicht mehr gesehen?"
"Doch, immer und immer wieder. Sie denkt, ich drücke mich vor der Verantwortung."
"Geht es Ihnen gut genug, um zu schreiben?"
"Mir geht es gut genug, um zu lesen. Wann werden Sie mir die Briefe bringen?"
"Ich habe sie gebracht, wie ich es versprochen habe, an dem Tag, als Sie krank wurden."
"Wo sind sie?"
"In der ersten Schublade auf der rechten Seite der Kommode." Er drehte sich zu dem Möbelstück um. "Das heißt, wenn sie niemand dort weggenommen hat. Ich legte das Päckchen selbst hinein und sagte der Krankenschwester, dass niemand es anfassen dürfe. Die Utensilien für das Morphium liegen an der gleichen Stelle. Ich weiß nicht, was sie darin vermutet, vielleicht ein neues und genauso nutzloses Medikament oder irgendeinen Apparat; sie hat keine gute Meinung von mir, wissen Sie. Solange Sie die Spritzen erhielten, konnte ich es jede Nacht und jeden Morgen sehen."
"Schauen Sie, ob es noch da ist."
Er ging hinüber und öffnete die Schublade:
"Es ist tatsächlich noch da."
"Oh! Reden Sie nicht wie eine Krankenschwester", sagte ich ungeduldig. "Ich bin gesund genug, um es zu öffnen."
Er brachte es mir und legte es in meine Hände, ein gewöhnliches, in braunes Papier eingeschlagenes Päckchen, mit Kordel verzurrt und mit einem schweren, unbeholfen angebrachten Placken Siegellack gesichert. Hätte ich es nicht sowieso gewusst, ich hätte geschworen, dass er es verpackt hatte.
"Warum lächeln Sie?", fragte er.
"Nur, weil Ihr Päckchen so ordentlich eingepackt ist." Er lächelte zurück.
"Ich habe es in aller Eile verschnürt. Ich wollte nicht in Versuchung kommen, hineinzuschauen."
"Damit bin ich nun Hüter und Testamentsvollstrecker gleichermaßen –– "
"Immerhin war es Margarets Wunsch, dass Sie ihre Papiere bekommen sollten", antwortete er ernst.
"Das hat sie Ihnen aber nicht gesagt. Sie haben nur mein Wort darauf", erwiderte ich.
"Könnte es einen besseren Beweis dafür geben? Woher hätten Sie sonst wissen sollen, dass es diese Aufzeichnungen überhaupt gibt? Warum haben Sie nach ihnen gesucht?"
Als das Päckchen auf der Steppdecke lag, kamen mir alle möglichen Schwierigkeiten in den Sinn. Ich wollte es nur öffnen, wenn ich allein war, und das war ich nie – buchstäblich nie allein, es sei denn, ich sollte schlafen, was aber dank Margaret und dem Codein den vorherigen Halbsatz schon wieder ad absurdum führte! Laut nachdenkend fragte ich Dr. Kennedy:
"Bin ich außer Gefahr?"
Er antwortete unüberlegt und ausweichend:
"Niemand ist jemals wirklich außer Gefahr. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Wagen unterwegs bin, setze ich mein Leben aufs Spiel."
"Oh, ja! Ich habe schon von Ihrer Fahrweise gehört", antwortete ich trocken.
Er lachte.
"Man sagt mir nach, ich sei zu unbekümmert, dabei bin ich nur unglücklich. Mit etwas Glück ––– "
"Und was wäre mit etwas Glück?"
"Werden Sie noch sehr, sehr lange leben. Ich würde mir an Ihrer Stelle keine Sorgen machen. Es geht Ihnen jeden Tag besser."
"Ich mache mir keine Sorgen, ich denke nur an Mrs. Lovegrove. Sie hat zwei Kinder, ein großes Haus, berufliche und andere Verpflichtungen. Werden Sie ihr sagen, dass es mir gut genug geht, um allein gelassen zu werden?" Er antwortete schnell und überrascht:
"Sie will aber gar nicht gehen, sie ist gerne bei Ihnen. Was mich überhaupt nicht wundert."
Er war schon ein äußerst merkwürdiger Mensch. Manchmal hatte ich den Eindruck, er sei nicht "ganz da". Er sagte, was immer ihm in den Sinn kam, und war darüber hinaus noch in vielerlei Hinsicht anders als gewöhnliche Menschen. Ich musste ihm mein Bedürfnis nach Alleinsein erklären. Wenn Ella zurück in die Stadt ging, würde sich Benham bald, so hoffte ich wenigstens, wie eine gewöhnliche Krankenschwester verhalten – vielleicht musste ich sie auch ein wenig dazu "ermuntern." Ich hatte in London genug Krankenschwestern gehabt und kannte ihre Gewohnheiten. Zwei oder drei Stunden am Morgen für ihre sogenannten "Gesundheitsspaziergänge", zwei oder drei Stunden am Nachmittag für ein Nickerchen, ob sie in der Nacht geweckt worden waren oder nicht, und in den Pausen nahmen sie ihre Mahlzeiten zu sich, bei denen sie gerne auch länger verweilten. Das Alleinsein wäre ein leicht zu erringendes Gut, wenn Ella wegginge und es niemanden mehr gäbe, der überwachen oder kommentieren könnte, wie viel Aufmerksamkeit für zwei Guineen pro Woche gekauft werden konnte. Übrigens habe ich Benham falsch eingeschätzt, aber das sei nur am Rande erwähnt. Sie war niemals eine durchschnittliche Krankenschwester und hat sich auch nie so verhalten.
Nachdem dieses in braunes Papier gewickelte Päckchen auf dem Bett lag, lautete mein erstes Ziel, Ella davon zu überzeugen, nach Hause und zu den Kindern zurückzukehren – und das, ohne ihre Gefühle zu verletzen. Sie wäre noch keine fünf Minuten außer Haus gewesen, bevor ich Heimweh nach ihr bekommen hätte. Das war mir klar, aber man kann eben nicht gleichzeitig arbeiten und spielen. Ich hatte nie eine andere Gefährtin als Ella. Trotzdem – arbeite, solange du noch Licht hast. Ich musste unbedingt noch ein weiteres Buch schreiben, und hier lag eines in meiner Hand.
Ich ließ Dr. Kennedy das Päckchen wieder in die Schublade legen. Dann legte ich mich hin und machte Pläne. Ich musste mit Ella über Violet und Tommy reden, ihr Heimweh nach ihnen wecken. Ich fing noch am selben Nachmittag damit an, aber leider kannte mich Ella viel zu gut.
"Wie kommt Violet ohne dich zurecht?"
"Oh, es geht ihr gut."
Bald darauf fragte mich Ella leise, ob es noch jemanden gäbe, den ich gerne loswerden würde.
"Gott bewahre!" Mein Antwort klang beunruhigt und sie verstand sofort – verstand, ohne schmerzlich berührt oder beleidigt zu sein, dass ich allein sein wollte. Eine Sache, die Ella nie ganz begriff, war meine erbärmliche Unfähigkeit, in zwei Welten gleichzeitig zu leben, der realen und der unwirklichen. Wenn ich schreiben wollte, nutzte es nichts, mir dafür bestimmte Stunden oder Zeiten zuzuweisen. Ich wollte dafür den ganzen Tag und die ganze Nacht; ich wollte weder angesprochen noch von meiner Geschichte und meinen neuen Freunden losgerissen werden. Aus diesem Grund habe ich London immer für einige viele Monate im Jahr verlassen und gegen die Küste oder einen Ort im Ausland eingetauscht. London bedeutete für mich, dass ich Ella fast täglich sah oder hörte, entweder am Telefon, oder sogar persönlich.
"Du schreibst doch nicht den ganzen Tag, oder? Wovor versteckst du dich? Sei nicht so albern, du musst manchmal rausgehen. Ich hole dich mit dem Wagen um ––– "
Und dann lockte sie mich ins Theater, in ein Restaurant, oder sonst wohin. Sie dachte, die Leute würden mich gerne kennen lernen, aber ich konnte nur selten feststellen, dass sich irgendjemand für eine Schriftstellerin interessierte, wie viele Auflagen sie auch immer verkauft haben mag. Meine Kraft kehrte zurück, wenn auch langsam. Natürlich hatte Ella Verpflichtungen gegenüber ihren Kindern, was ich ihr manchmal – vollkommen unangebracht – übelnahm. Ich hatte mir immer gewünscht, dass ihr früher Witwenstand keine Hinterlassenschaften mit sich gebracht hätte. Doch gerade jetzt passten mir die Kinder hervorragend in meine Pläne; es war gar nicht nötig, dass ich auf irgendetwas drängte – und das gefiel mir, ich schwelgte sozusagen darin. Und da es mir ja besser ging –––
Ich wollte unbedingt mit diesem Päckchen allein sein. Noch bevor Ella wegging, wagte ich einen zaghaften Versuch.
"Ich möchte noch nicht schlafen, Schwester, lieber noch ein wenig lesen. Da ist ein Päckchen mit Briefen ––– "
"Nein! Nein! Davon will ich überhaupt nichts hören. Um zehn Uhr noch lesen! Was wird Ihnen wohl als Nächstes einfallen?"
"Es würde mir bestimmt nicht schaden", antwortete ich gereizt. "Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass es mir mehr schadet, wenn jedem meiner Vorschläge widersprochen wird."
"Wie auch immer, Sie werden mich nicht dazu bewegen, Ihnen dabei zu helfen, Selbstmord zu begehen. Nachts wird geschlafen, und Ihr Codein haben Sie auch schon gehabt."
"Das Codein ist kein Schlafmittel, es beruhigt und besänftigt mich nur."
"Umso mehr sollten Sie sich nicht von irgendwelchen alten Briefen wachhalten lassen." Sie disputierte, und ich ––– ; schließlich war ich zu müde und humorlos, um darauf zu bestehen. Ich entschied mich, so bald wie möglich alle Krankenschwestern loszuwerden und in der Zwischenzeit nicht mehr mit ihnen zu disputieren, sondern sie zu umgehen. Zu dieser Zeit, bevor Ella ging, stand ich jeden Tag für ein paar Stunden auf und legte mich auf die Couch am Fenster. Ich stellte meine Kräfte auf die Probe und fand schnell heraus, dass ich unter einiger Anstrengung vom Bett zur Couch und von der Couch zum Sessel gehen konnte – ohne mich auf den Arm einer Krankenschwester zu stützen..
"Du wirst auf dich aufpassen?", waren Ellas letzte Worte, die ich ungeduldig mit einem entsprechenden Versprechen quittierte.
"Es ist in Ordnung für mich, dich jetzt allein zu lassen, schließlich hast du deinen Peter, und die Krankenschwester wird auch darauf aufpassen, dass du es nicht übertreibst."
"Du hast deinen Peter." Kann man sich etwas Lächerlicheres vorstellen? Meine unheilbar frivole Schwester war der Meinung, ich hätte mich in diesen Flegel verliebt! Es gelang mir nicht, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ihr Argument war, dass ich zu dem Zeitpunkt, als es mir am schlechtesten ging, keinen anderen Menschen sehen wollte. Und sie bestand darauf, dass es unmöglich Peter Kennedys Fähigkeiten sein konnten, die mich anzogen. Wenn auch etwas kläglich, verteidigte ich ihn, obwohl es stimmte, dass er keine besondere Begabung oder Fähigkeiten in die Waagschale geworfen hatte. Ich erwiderte, er sei mindestens so gut wie alle anderen, und ganz sicher weniger bedrückend.
"Es hat keinen Zweck, mich anzuschwindeln oder es nur zu versuchen. Du bist in den Mann verliebt. Bemühe dich nicht, dem zu widersprechen. Und nein, ich bin kein bisschen eifersüchtig. Ich hoffe nur, dass er dich glücklich machen wird. Die Krankenschwester sagte mir, dass du sie nicht mal im Zimmer haben möchtest, wenn er bei dir ist."
"Hast du vergessen, wie alt ich bin? Es ist wirklich entwürdigend, sogar demütigend, wenn so über einen gesprochen wird ––– "
"Aber das Alter hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Eine Frau ist nie zu alt, um sich zu verlieben. Und außerdem, was sind schon neununddreißig Jahre?"
"In diesem Fall sind es zweiundvierzig", warf ich trocken ein, froh darüber, dass ich meinen Sinn für Humor noch nicht ganz verloren hatte.
"Gut! Von mir aus zweiundvierzig. Jedenfalls wirst du zugeben müssen, dass ich deine Anspielung sehr schnell begriffen habe. Ich werde dich mit deinem Corydon allein lassen."
"Caliban!"
Anm. des Übersetzers: Corydon und Caliban sind Figuren aus Shakespeares Werken.
"Er sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus, aber seine Kleidung ––– . Wenn etwas aus euch wird, musst du ihn zu Poole schicken. Jedenfalls sind seine Füße und Hände einigermaßen gut geraten, und in seiner Unansehnlichkeit liegt sogar eine gewisse Anmut."
"Wirklich, Ella, ich halte das nicht mehr aus. In deinem Kopf dreht sich alles nur um Liebe, sie bestimmt all dein Handeln, lässt dich ungerechte Urteile fällen. Aber was mich betrifft, so bin ich ihr längst entwachsen. Ich bin müde, alt, krank. Peter Kennedy ist wirklich nicht zu beanstanden. Andere Ärzte schon. Er ist ehrlich, schlicht –– "
"Wenn ich das nächste Mal komme, möchte ich alles über seine Qualitäten erfahren. Und glaub' bloß nicht, dass du mich täuschen kannst. Gott segne dich, meine Liebe." Plötzlich wurde sie ernst. "Du weißt, dass ich nicht gehen würde, wenn es dir lieber wäre, wenn ich bliebe, oder wenn ich mir deinetwegen Sorgen machen würde. Du weißt, dass ich jederzeit wiederkommen werde, wenn du mich brauchen solltest. Oh, ich werde meinen Zug verpassen, wenn ich mich nicht beeile. Kann ich dir etwas schicken? Ich werde die Sofadecke nicht vergessen, und wenn dir sonst noch etwas einfällt ––– " Ihr Dienstmädchen klopfte an die Tür und sagte, der Kutscher habe Bescheid gegeben, dass sie sofort kommen müsse. Ihre letzten Worte waren: "Dann nochmals auf Wiedersehen, und sage ihm, dass ich euch meinen Segen gebe. Sage ihm, dass er sich selbst verraten hat. Mir war das alles klar, seit ich den ersten Tag hier war, als er mir sagte, was für eine interessante Frau du doch bist ––– "
"Auf Wiedersehen – und danke für alles. Es tut mir leid, dass dir solche Spinnereien in deinem törichten Kopf herumspuken ––– " Aber sie war weg. Ich hörte, wie sie draußen vor dem Fenster dem Kutscher Anweisungen gab, gefolgt von dem Knirschen der Räder auf dem Kies, als der Einspänner losfuhr.