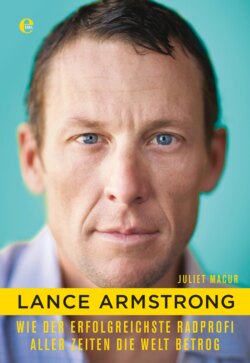Читать книгу Lance Armstrong - Juliet Macur - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
ОглавлениеWer im Jahr 1992 den Medizinschrank des Motorola-Teams öffnete, stieß auf die üblichen Dinge – Heftpflaster, Medikamente gegen Durchfall und Desinfektionsmittel für Schürfwunden –, aber auch auf unerlaubte Substanzen wie Kortison und Testosteron, die dort neben dem gängigen Schmerzmittel Tylenol zu finden waren. (Tylenol ist ein US-Handelsname. Das Medikament mit dem entsprechenden Wirkstoff ist in Deutschland sehr bekannt: Paracetamol. Anm. d. Ü.) Die meisten Fahrer betrachteten diese Mittel aber nicht als Dopingsubstanzen. Im Gegenteil, die Einnahme bedeutete für sie, in einem mörderischen Sport auf seine Gesundheit zu achten.
Kortison, das gespritzt oder in Tablettenform eingenommen werden kann, lindert Muskelkater und wirkt auf steife, schmerzende Gelenke entzündungshemmend. Obwohl verboten, ist die Substanz unter Radsportlern nach wie vor sehr verbreitet, weil sie gegen Schmerzen in den Beinen hilft. Die Fahrer vergleichen den Kortison-Konsum mit der Einnahme von Aspirin bei Kopfschmerzen, und viele Mannschaftsärzte stellen bedenkenlos falsche Rezepte aus.1 Testosteron ist ein Steroid, aber die Fahrer nehmen es nicht für den Muskelaufbau ein. Nach einer harten Trainingsbelastung ermöglicht es ihnen eine schnellere Erholung, sodass sie am nächsten Tag wieder auf die Beine kommen und genauso hart trainieren können. Die Fahrer vergleichen die Einnahme dieser Substanz mit einer Massage oder mit regelmäßiger Flüssigkeitsaufnahme. In der europäischen Radsportszene waren diese Mittel weitverbreitet. Kein Fahrer, der bei der Tour eine Rolle spielen wollte, verzichtete darauf, ob es nun Steroide oder injizierbare Vitamine wie B12, B Komplex oder Folsäure waren.
Die Geschichte des Radsports ist mit der Verwendung leistungssteigernder Mittel verbunden, vor allem bei der Tour de France. Dieses Rennen – eine dreiwöchige Rundfahrt, die über eine Gesamtstrecke von mehr als 3000 Kilometern führt und jedes Jahr im Juli ausgetragen wird – bringt beinahe unmenschliche körperliche Belastungen mit sich, und das ist seit der ersten Tour von 1903 immer so gewesen. Die Fahrer haben aber auch stets Mittel und Wege gefunden, diesen Wettkampf erträglicher zu gestalten. Im Jahr 1904 stiegen Fahrer aus dem Sattel und verschafften sich Mitfahrgelegenheiten in Autos, Zügen oder Bussen, um die Strecke abzukürzen. Alle Etappensieger und die ersten vier des Gesamtklassements, insgesamt 29 Teilnehmer, wurden in jenem Jahr disqualifiziert. Von Anfang an war die Tour mit Lüge und Betrug verbunden.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzten die Fahrer auf Substanzen wie Äther, Kokain und Strychnin, um das Schmerzempfinden zu dämpfen.2 Manche von ihnen kehrten in Kneipen ein und konsumierten dort Wein und andere alkoholische Getränke. Sie setzten auf abenteuerliche Mixturen auf Kokainbasis, um ihren Körper weiterzutreiben, auch wenn der Verstand längst etwas anderes signalisierte. Die Fahrer glaubten, sie könnten leichter atmen, wenn sie etwas Strychnin (das so hochgiftig ist, dass es als Rattengift verwendet wird) und/oder Nitroglyzerin zu sich nahmen (Letzteres wird Herzinfarktpatienten verabreicht, um das Herz anzuregen). Henri Pélissier, der Tour-Sieger von 1923, und sein Bruder Francis, die bei der Tour 1924 nach der dritten Etappe aus dem Rennen ausstiegen und anschließend dem Journalisten Albert Londres von der Tageszeitung Le Petit Parisien ein vielbeachtetes Interview gaben, bestätigten den Missbrauch dieser Substanzen. Die Story erschien unter der Überschrift »Les Forçats de la Route« (Die Sträflinge der Landstraße).3 Henri Pélissier gestand Londres: »Ihr habt ja keine Ahnung, wie es bei der Tour de France zugeht. Sie ist das reinste Martyrium. Selbst der Kreuzweg hat nur 14 Stationen, aber wir haben 15 Etappen. Wir leiden vom Start weg bis ins Ziel.« Pélissier zeigte dem Journalisten den Inhalt der Tasche, die er während des Rennens mitgeführt hatte: Kokain für die Augen, Chloroform fürs Zahnfleisch, Pomade, um die Knie zu wärmen, und Pillen, die Pélissier als »Dynamit« bezeichnete.
Amphetamine wurden Mitte der Vierzigerjahre populär und führten in der Folge zu gefährlichen Unfällen.4 Der französische Fahrer Jean Malléjac stürzte mit seinem Rad bei der Tour von 1955 zehn Kilometer vor dem Gipfel des Mont Ventoux, des berühmten kahlen Berges, der sich bis zu einer Höhe von 1900 Metern über die Landschaft der Provence erhebt, und fiel auf die Felsbrocken am Straßenrand.5 Ein Fuß hing noch im Pedalriemen fest, der andere zuckte konvulsivisch durch die Luft. Malléjac war 15 Minuten lang ohnmächtig, und der Tour-Arzt diagnostizierte einen durch Amphetamin ausgelösten Kollaps.6 Roger Rivière (1936 –1976), ein weiterer französischer Fahrer, landete bei der Tour 1960 mit seinem demolierten Rad auf dem Grund einer Schlucht in den Cevennen, nachdem er bei einer Abfahrt über eine Mauer gestürzt war. Dabei verletzte er sich an der Wirbelsäule.7 Die Ärzte fanden in seinen Trikottaschen Schmerzmittel, die seine Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt und seine Reflexe so sehr verlangsamt haben könnten, dass ihm ein Bremsfehler unterlief. Seine Beine waren gelähmt, er blieb für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt. Zwei Jahre später mussten elf Fahrer die Tour nach der Einnahme von Morphium aufgeben. Die Tour und der Dopingkonsum gingen, der wachsenden öffentlichen Aufmerksamkeit zum Trotz, Hand in Hand. Der fünffache Tour-Sieger Jacques Anquetil war berühmt für seinen offenen Umgang mit dem eigenen Ernährungsplan: »Man kann die Tour nicht nur mit Mineralwasser gewinnen … Alle dopen.«8 Nichts war zu diesem Zeitpunkt illegal.
Allerdings war die Dopingpraxis im Jahr 1963 so gefährlich geworden, dass eine Gruppe von Fahrern, Ärzten, Rechtsanwälten, Journalisten und Sportfunktionären Tests auf illegale Substanzen verlangte.9 Frankreich verabschiedete zwei Jahre später das erste nationale Antidopinggesetz, und bei der Tour begannen die Tests. Die Fahrer sträubten sich unter Anquetils Führung vehement dagegen.10 Noch vor der ersten Tour-Etappe taten sie sich zusammen und skandierten: »Wir pissen nicht in Reagenzgläser!« Zu ihrem Protest gehörte auch ein Spaziergang mit Rad auf den ersten 50 Metern dieser Etappe. Félix Lévitan, der Co-Direktor der Tour, bezeichnete die Fahrer als »eine Bande von Drogensüchtigen«, die es darauf anlegte, »den Radsport zu diskreditieren«.
Dann folgte einer der schwärzesten Tage in der düsteren Geschichte des Radsports. Am 13. Juli 1967 fuhr der Brite Tom Simpson nicht weit vom Gipfel des Mont Ventoux entfernt plötzlich im Zickzack. Schließlich ging er zu Boden, rief aber einem Mechaniker zu: »Hilf mir hoch, hilf mir hoch. Ich will weiterfahren. Hilf mir hoch, stell mich auf.«11 Zuschauer halfen ihm wieder aufs Rad, aber nach nur 100 Metern geriet er wieder ins Schlingern. Er hielt seinen Lenker noch fest, als er ins Koma sank. Drei Stunden später war Tom Simpson tot. Dem Autopsiebericht war zu entnehmen, er sei an einem Hitzschlag gestorben, der zu einem Herzinfarkt geführt habe.12 Aber seine Trikottaschen erzählten eine andere Geschichte. Dort steckten leere Ampullen mit Amphetaminresten.
Don Catlin, Gründer des UCLA Olympic Analytical Laboratory – des ersten Antidopinglabors in den Vereinigten Staaten –, hatte den Wirkstoff Erythropoietin (Kurzform: EPO) von Anfang auf der Liste. Als die Substanz 1989 als Medikament auf dem US-Markt auftauchte und zur Behandlung von Nierenpatienten und von Blutarmut bei Aidskranken verwendet wurde, war sie in der Sportszene längst bekannt. EPO ist ein hochwirksames Hormon, das die Bildung roter Blutkörperchen anregt. Mehr rote Blutkörperchen bedeuten mehr Ausdauer.
Vor allem im Radrennsport erwies sich dieses neue Mittel als Zaubertrank. Die Sportler mussten sich jetzt nicht mehr der gefährlichen und logistisch schwierigen Prozedur einer Bluttransfusion unterziehen, wenn sie die Zahl der roten Blutkörperchen erhöhen wollten. Durch einfache Injektionen konnten sie, wie es in einer unveröffentlichten schwedischen Untersuchung hieß, ihre aerobe Ausdauer um durchschnittlich acht Prozent verbessern.13 Die Untersuchung besagte, dass sich auf diese Weise ein Lauf von 20 Minuten Dauer um 30 Sekunden verkürzen ließ. Im Radsport konnte die Einnahme von EPO den Unterschied zwischen einem Gesamtsieg bei der Tour de France und dem Scheitern an der Qualifikation für das eigene Tour-Team ausmachen.
Allerdings gab es auch einen furchterregenden Nachteil. EPO erhöhte den Hämatokritwert – den prozentualen Anteil der roten Blutkörperchen am Gesamtblut, der auch eine Messgröße für die Blutdicke ist. Der normale Hämatokritwert liegt beim Menschen üblicherweise bei 42 bis 48 Prozent. Durch die Einnahme von EPO steigerten einige Radrennfahrer ihren Hämatokritwert in den Bereich der 50er-Prozentwerte oder noch weiter. Bjarne Riis, der Gewinner der Tour de France von 1996, erhielt sogar den Spitznamen »Mister 60 Prozent«, weil sein Hämatokritwert durch die EPO-Einnahme angeblich bis in diesen Bereich hochgetrieben wurde.14 Solche Werte waren mit Gefahren verbunden. Wenn die Sportler bei der EPO-Zufuhr überdosierten, machte die Substanz das Blut dickflüssig und zäh, was zu einem Schlaganfall oder zu Herzversagen führen kann, zumal Flüssigkeitsverlust, wie er bei langen Rennen oft auftritt, das Blut zusätzlich verdickt.
Ende der Achtzigerjahre kauften Radsportler die Substanz auf dem Schwarzmarkt. Dann gab es die ersten Toten. Fünf niederländische Fahrer starben 1987 an Herzproblemen.15 Connie Meijer, eine niederländische Fahrerin, fiel am 17. August 1988 bei einem Kriterium-Rennen in Naaldwijk bei Rotterdam in Ohnmacht und starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Diagnose: Herzinfarkt. Sie wurde nur 25 Jahre alt. Einen Tag später starb Bert Oosterbosch, ein weiterer niederländischer Fahrer, im Alter von 32 Jahren im Schlaf. Auch bei ihm lautete die Diagnose Herzinfarkt. Ärzte und Hämatologen mutmaßten, EPO-Missbrauch könne im Zeitraum von 1988 bis 1992 beim Tod von mindestens 18 europäischen Radprofis eine Rolle gespielt haben.16 Zehn Todesfälle wurden Herzkrankheiten zugeschrieben. Die Radsportzeitschrift VeloNews schrieb, im Radsport sei »eine Atombombe« detoniert. Auch der mediale Mainstream berichtete jetzt über diese Todesfälle. Die New York Times brachte die Schlagzeile: »Stamina-Building Drug Linked to Athletes’ Deaths« (Ausdauer-Dopingmittel führt zu Tod von Athleten).17
Catlin schlug beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) Alarm. In seiner Eigenschaft als Mitglied der medizinischen Kommission des IOC drängte er auf eine Untersuchung des Sachverhalts. Eine Nachweismethode gab es noch nicht. Catlin vertrat die Auffassung, dass das IOC etwas unternehmen müsse, und zwar sofort, weil Leben auf dem Spiel standen. Mit einem Untersuchungsteam des IOC reiste er zu Recherchen nach Europa. Dort fand er jedoch niemanden, der bereit gewesen wäre, über das Thema EPO zu sprechen. Familienangehörige verweigerten die Zusammenarbeit. Fahrer behaupteten, sie hätten noch nie davon gehört.18 Das sollte heißen: Lass uns in Ruhe. Immer wieder appellierte der Dopingfahnder an seine Gesprächspartner: Haben Sie keine Angst vor einer Aussage. Wir versuchen das Leben anderer Fahrer zu retten. Bitte helfen Sie uns. Doch es kam nichts. Catlin war überzeugt, dass einige dieser Leute nicht nur das Andenken von Freunden, Familienangehörigen und Teamkollegen in Ehren hielten – sie »schützten« auch ihren Sport. Ein Dopingskandal jagte den anderen. Es musste etwas getan werden. Catlin unternahm seinen Vorstoß im Jahr 1988. Aber die Mauer des Schweigens konnte er nicht durchbrechen. Sieben Jahre später nahm Lance Armstrong zum ersten Mal EPO.19
Als Armstrong 1992 bei Motorola unterschrieb, war er bereits mit Trainern von zweifelhaftem Ruf zusammengekommen. Der Erste war Eddie Borysewicz. Der aus Polen stammende Borysewicz lernte sein Handwerk in den Sportakademien des Ostblocks. 1985 stand er im Mittelpunkt eines der größten Dopingskandale in der olympischen Geschichte der USA. Man beschuldigte ihn, in seiner Eigenschaft als Trainer der US-Olympiamannschaft 1984 Fahrer zu Bluttransfusionen genötigt zu haben, um die Konzentration der roten Blutkörperchen zu erhöhen und damit die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Blutes zu steigern, was wiederum eine bessere Ausdauerleistung ermöglicht. Wenn solche Transfusionen nicht fachgerecht vorgenommen werden oder die Blutkonserven nicht bei der richtigen Temperatur gelagert werden, kann sogenanntes Blutdoping ernsthafte Gesundheitsbeschwerden bis hin zum Tod bewirken. Das Internationale Olympische Komitee verbot diese Praxis nicht ausdrücklich (bis 1988), aber in seinen Regeln war festgehalten, dass die Sportlerinnen und Sportler keine Substanzen zu sich nehmen und sich keinen Verfahren unterziehen durften, durch die ein Wettkampf auf unfaire Weise beeinflusst werden konnte. Ob verboten oder nicht: Borysewicz und weitere Teamfunktionäre waren anwesend, als sieben Mitglieder des US-Olympia-Radsportteams von 1984 in einem Hotelzimmer des Ramada Inn in Los Angeles geduldig darauf warteten, bis die Reihe an sie kam, sie sich auf ein Bett legten und Blut von einem Verwandten oder einem anderen Menschen mit der gleichen Blutgruppe verabreicht bekamen.20 Zwei Fahrer wurden anschließend krank. Vier weitere gewannen Medaillen, darunter auch eine goldene.21 Als Monate später die Öffentlichkeit von diesen Bluttransfusionen erfuhr, beschädigte das Borysewiczs Ruf ebenso wie das Image des Radsports. »Eddie B. führte harte Dopingpraktiken in den amerikanischen Radsport ein, und danach war in dieser Sportart nichts mehr so, wie es vorher war«, sagt Andy Bohlmann, der von 1984 bis 1990 für das Antidopingprogramm bei der United States Cycling Federation, wie der nationale Radsportverband damals hieß, zuständig war.
Im Jahr 1990 wurde Chris Carmichael, ein ehemaliger Profifahrer des 7-Eleven-Teams, zum Cheftrainer des Nationalteams ernannt, der für Dutzende von Fahrern zuständig war, unter anderem auch für Armstrong und drei weitere vielversprechende junge Talente aus dem Junioren-Nationalteam. Diese drei Nachwuchsfahrer waren Greg Strock, Erich Kaiter und Gerrik Latta. Alle drei sagten später aus, Betreuer des Nationalteams hätten sie ohne ihr Wissen bereits im Teenageralter gedopt.22 Einer von ihnen beschuldigte Carmichael direkt. Die drei Fahrer gaben zu Protokoll, man habe ihnen Substanzen gespritzt, die von den Teambetreuern als Vitamine oder »Kortisonextrakt« bezeichnet worden seien. Außerdem habe man ihnen bei Rennen nicht näher bezeichnete Tabletten verabreicht, die in Schokoriegeln steckten, und sie hätten Wasser getrunken, dem verbotene Aufputschmittel beigemischt worden war.
Strock, inzwischen Medizinstudent, stellte Jahre später fest, dass es so etwas wie ein »Kortisonextrakt« gar nicht gab. Er erkannte, dass seine Trainer ihm möglicherweise etwas Verbotenes gespritzt hatten, was vermutlich die Autoimmunerkrankung ausgelöst hatte, die seine Radsportkarriere 1991 beendete. Er erinnerte sich an die Landesmeisterschaften 1990, zu denen – nach seiner Erinnerung – Carmichael mit einer Aktentasche voller Medikamente und Spritzen erschienen war. Angeblich verabreichte er Strock unter der Aufsicht von René Wenzel, einem weiteren Trainer, eine Injektion ins Gesäß. Strock gab an, Carmichael auch bei anderen Rennen mit der Tasche gesehen zu haben, mit der er ausgesehen habe wie ein Pharmareferent auf dem Weg zu seiner Kundschaft. Strock, Kaiter und Latta verklagten USA Cycling, und bei den beiden Erstgenannten kam es zu einer außergerichtlichen Einigung.23 (Das Ergebnis von Lattas Verfahren ist nicht bekannt.) Carmichael zahlte Strock angeblich 20 000 Dollar, um seinen Namen aus diesem Prozess herauszuhalten.24
Und wie stand Lance Armstrong zu Carmichael? Mir erzählte er, sie seien wie Brüder gewesen. Armstrongs Porträt prangte später auf der Hülle eines Trainingsvideos von Carmichael. Zu vielen von Carmichaels Büchern steuerte er Vorworte bei. Alle diese Publikationen wurden damit beworben, dass Carmichael der führende Kopf hinter Lance Armstrongs Erfolg war. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, konnten vom Trainer des weltbesten Radsportlers lernen, wenn Sie an einem von Carmichaels einwöchigen Trainingslagern teilnahmen. Die Gebühr: läppische 15 000 Dollar.
J. T. Neal fungierte während der gesamten Neunzigerjahre als Armstrongs wichtigster Soigneur bei kleineren Rennen im Inland sowie bei Trainingslagern des Nationalteams. Aber in Europa und bei den großen Rennen fiel die Ehre, Armstrong abzufrottieren, einem Mann namens John Hendershot zu. In der europäischen Betreuerszene galt Hendershot als cool und abgezockt zugleich. Seine Kollegen beneideten ihn um das Geld, das er verdiente, und um das Ansehen, das er genoss. Wo er auftauchte – in der Zuschauermenge bei Rennen oder zu Hause in Belgien –, wandten sich die Leute um, um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Die Teams wollten ihn haben. Armstrong wollte ihn. J. T. Neal sagte, Hendershot sei ihm »wie ein Gott« vorgekommen, er bezeichnete ihn »als den besten Betreuer, den es je gab«.
Hendershot, amerikanischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Belgien, war Heilmasseur, Physiotherapeut und ein Mann, der Wunder wirkte. Wenn er die Hand auflegte, brachte das einen erschöpften Fahrer, für den alles nur noch Schmerz war, ins Leben zurück. Wer seine Empfehlungen in Sachen Essen und Schlafen befolgte, fühlte sich morgens wie neugeboren. Hendershot kannte alle Geheimnisse eines Soigneurs. Darüber hinaus verfügte er über ein Spezialwissen, das er sich im Lauf der Jahre angeeignet hatte. Wenn es um Arzneimittel und Dopingkultur im Radsport ging, war er, so Neal, in seinem wahren Element. Seine besondere Begabung war ein Händchen für Chemie. Fast ein Jahrzehnt lang bereitete sich Hendershot zu Hause in seinem selbst eingerichteten Labor auf Rennen vor. Er mixte und vermengte Substanzen, stimmte sie aufeinander ab und hatte dabei nur ein Ziel vor Augen: Er wollte die Fahrer schneller machen.25 Aus Substanzen wie Ephedrin, Nikotin, hochkonzentriertem Koffein, Mitteln, die die Blutgefäße erweitern, Blutverdünnern und Testosteron zauberte er Cocktails, die er selbst als »verrücktes Gebräu« bezeichnete, und suchte nach Mitteln und Wegen, den Fahrern während eines Rennens einen körperlichen Leistungsschub zu verschaffen. Seine Mischungen füllte er in winzige Fläschchen ab, die er den Fahrern noch am Start in die Hand drückte. Manchmal injizierte er sie auch.
Mit dieser Vorgehensweise stand er nicht allein da. Betreuer in ganz Europa stellten ihre eigenen, potenziell gefährlichen Hausmacher-Gemische her und tranken oder spritzten sie sich zunächst selbst. Sie waren ihre eigenen Laborratten. Auch Hendershot, der keinerlei medizinische oder wissenschaftliche Ausbildung vorzuweisen hatte, erlernte die Kunst des Dopens von Radrennfahrern, indem er die Wirkung der Mittel an einer menschlichen Versuchsperson beobachtete – an sich selbst. Wenn sein Herz so schnell und so laut schlug, dass es sich anfühlte wie ein entgleister Güterzug, wusste er, dass er mit dieser Rezeptur danebenlag. Das würde bei den Fahrern, die unter einer enormen körperlichen Belastung standen, nicht funktionieren. Er wollte »heiße« Fahrer, aber bis zum Herzinfarkt durfte das nicht gehen. Es dauerte nicht lange, bis er seine Mixturen und Pillen auch an den Fahrern ausprobierte, auch an Armstrong.26 Als dieser nach den Olympischen Spielen von 1992 ins Profilager wechselte und bei Motorola, einem der beiden großen amerikanischen Teams, unterschrieb, verlangte er nur den besten Betreuer. Man brachte ihn umgehend mit Hendershot zusammen. Sie waren das perfekte Paar. Betreuer wie Fahrer waren bereit, bis an die Grenzen zu gehen.27 »Wir bewegten uns auf dem schmalen Grat zwischen Sieg und Tod im Sattel«, erinnert sich Hendershot.
Hendershot sagt, den Fahrern in seinen Teams habe es freigestanden, Dopingmittel zu nutzen. Sie konnten »nach dem Ring greifen oder auch nicht«. Er habe jedenfalls keinen einzigen Profirennfahrer kennengelernt, der es nicht zumindest ausprobiert habe. Für Fahrer, die auf pharmazeutische Hilfe verzichteten, war der Sport kaum – in vielen Fällen unmöglich – auszuüben, zum Beispiel bei der Tour de France, dem dreiwöchigen Etappenrennen. Hendershot war überzeugt, dass Radsportler höchstens vier Jahre sauber fahren konnten, danach waren sie nicht mehr konkurrenzfähig. In einem gedopten Peloton konnten saubere Fahrer dem Mannschaftskapitän vielleicht während der ersten Woche eines Etappenrennens helfen, etwa indem sie an der Spitze des Feldes mitfuhren, um das Tempo zu bestimmen, oder beim Betreuungsfahrzeug Trinkflaschen abholten, aber dann mussten sie erschöpft aufgeben. Eine Karriere dieser Art dauerte nicht lange.
Als Armstrong 1992 bei Motorola einstieg, war ein System, das den Fahrern den Dopingmissbrauch erleichterte, im Team bereits fest etabliert – und wahrscheinlich in der gesamten Sportart. Hendershot sagte, er habe regelmäßig eine Liste von Dopingmitteln und fingierte Rezepte beim Apotheker in seinem Wohnort Hulste in Belgien vorgelegt, um diese Verschreibungen einzulösen und weitere Mittel für die Fahrer zu beschaffen. Der Radsport zählt in Belgien seit Generationen zu den beliebtesten Sportarten im Land. Der Apotheker fragte Hendershot nicht, woher die Nachfrage nach einer so enormen Menge von Medikamenten kam. Im Gegenzug schenkte ihm Hendershot ein von allen Fahrern signiertes Mannschaftstrikot oder verschaffte ihm Zutritt bei großen Rennen, zu denen er einen VIP-Ausweis erhielt, der alle Türen öffnete. Der Betreuer verließ die Apotheke mit den Taschen voller EPO, Wachstumshormon (HGH), Blutverdünner, Amphetamine, Kortison, Schmerzmittel und Testosteron, einem besonders beliebten Präparat, das er an die Fahrer ausgab »wie Süßigkeiten«.
Armstrong nahm im Jahr 1993 alle diese Substanzen zu sich – wie fast alle anderen Fahrer im Team, sagt Hendershot. Gefragt nach Armstrongs Einstellung, zitiert er ihn mit der Bemerkung: »Das ist das Zeug, das ich nehme, es gehört zu dem, was ich tue, dazu.« Armstrong sei auch deshalb ohne zu zögern in das Teamprogramm eingestiegen, weil alle anderen dabei waren. »Es war wie ein gemeinsames Abendessen mit der Mannschaft«, sagt Hendershot und fügt hinzu, er habe das Gefühl gehabt, dass praktisch alle Mitarbeiter im Team über das Dopingprogramm Bescheid wussten, »Ärzte, Betreuer, Fahrer, Teammanager, Mechaniker – alle«. Es sei eine normale Sache gewesen, er habe niemals irgendetwas im Verborgenen getan. Nachdem er den Fahrern im Mannschaftshotel ihre Injektionen verabreicht hatte, warf er die Mülltüte mit den benutzten Spritzen und Ampullen einfach in einen Abfallbehälter des Hauses.
Hendershot verabreichte Armstrong niemals EPO oder Wachstumshormon, anderen Fahrern des Teams schon. Aber er wusste, dass auch Armstrong diese Substanzen zu sich nahm. Hendershot sagte, ein geheimer Vorrat dieser beiden Dopingmittel sei 1995 ins Trainingslager der Mannschaft nach Südfrankreich gebracht worden. Fahrer wie Armstrong verschafften sich ihr Doping über verschiedene Kanäle – über Hendershot, den eigenen Arzt oder über einen Arzt, der für das Team arbeitete, oder indem sie die gewünschten Mittel selbst einkauften. Alle Fahrer brachten das, was sie hatten, zu Hendershot, der es der jeweiligen Person entweder durch Spritzen oder in Form eines von ihm selbst hergestellten Gemischs verabreichte, das getrunken oder injiziert oder über eine unter ärztlicher Aufsicht gelegte Infusion zugeführt wurde. Manchmal gab es die Substanzen auch in Form von Tabletten, die ebenfalls von Hendershot ausgeteilt wurden.
Nach Hendershots Einschätzung hatte Anfang der Neunzigerjahre weniger als die Hälfte der Profiteams einen Arzt im festen Mitarbeiterstab. Diese Mannschaften waren den anderen einen Schritt voraus. »Doping schafft tendenziell gleiche Wettkampfbedingungen, aber je besser dein Arzt ist, desto besser bist du selbst«, sagt Hendershot. Er setzt hinzu, dass bei der Dopingkultur, die damals herrschte, seiner Ansicht nach so gut wie alle Ärzte Dopingmittel an die Fahrer ausgegeben haben müssen.
Trotzdem lebte Hendershot in ständiger Sorge, irgendetwas, das er an die Fahrer ausgab, könnte ihnen schaden oder sie vielleicht sogar umbringen. Vor allem, wenn die Substanzen von den Fahrern selbst in Infusionsbehälter gefüllt worden waren, oder wenn die Ärzte der Fahrer Gemische herstellten, die Hendershot anschließend verabreichte. Er fürchtete, dass er haftbar gemacht werden könnte, wenn einmal etwas schiefging. Deshalb spielte er die Sache vor sich selbst herunter. Wenn er die Dopingmittel an die Fahrer ausgab, sagte er sich: »Du bist kein Drogendealer. Das hier ist nicht organisiert. Es ist keine große Sache.« Er wusste, dass das nicht die Wahrheit war.
Der Soigneur rechtfertigte sein Tun, indem er sich sagte, dass der gesamte Vorgang unter der Aufsicht von Max Testa stand, einem Italiener, der nach wie vor im Radsportbereich tätig ist und in Utah eine sportmedizinische Klinik betreibt (Stand: Dezember 2013).28 Testa sagte mir 2006, dass er seinen Fahrern die Anweisung gab, EPO einzunehmen, ihnen aber niemals selbst Dopingmittel verabreicht habe. Wenn die Einnahme von Dopingmitteln also vom Team selbst nicht zwingend angeordnet wurde, war sie doch zumindest quasioffiziell. Hendershot vertraute darauf, dass Testa die körperliche Unversehrtheit der Fahrer sicherstellen würde. Er glaubte, dass diesem Mediziner – im Unterschied zu anderen im Radsport tätigen Ärzten – die Gesundheit der Fahrer wichtig war, wichtiger als Siege oder Geld.29 Hendershot formulierte das allerdings so: Ein Arzt, der die Ausgabe von Dopingmitteln an die Fahrer verweigerte, arbeitete nicht lange in dieser Sportart.
Armstrong schätzte Testa so sehr, dass er nach Italien umzog, um in der Nähe des Arztes zu sein, der seine Praxis in der nördlich von Mailand gelegenen Stadt Como hatte. Bald nach seinem Einstieg bei Motorola hatte Armstrong während der Rennsaison seinen Wohnsitz in Como. Er brachte seinen guten Freund Frankie Andreu mit, und mit der Zeit schlossen sich ihnen weitere Fahrer an, unter anderem George Hincapie aus New York und Kevin Livingston, der aus dem Mittleren Westen stammte. Sie alle wurden Testas Patienten.30 Alle fuhren später auch für Armstrongs Siegerteams des United States Postal Service bei der Tour de France. Hendershot geht davon aus, dass keiner dieser Fahrer das Gefühl hatte, etwas Unrechtes zu tun, wenn er dopte. Wo begann in einem Sport, in dem die Pharmakologie so allgegenwärtig war, der Betrug? Es ist kein Betrug mehr, wenn alle es tun. Armstrong war von der Richtigkeit dieser Aussage felsenfest überzeugt.31 Er zögerte nicht, dachte kein zweites Mal darüber nach, hinterfragte nichts. Armstrong griff nach dem Ring, wie es Hendershot getan hatte.32
20. April 1994. Beim Flèche Wallonne, einem klassischen Eintagesrennen, das durch das Hügelland der Ardennen führt, steigen gleich drei Fahrer des italienischen Teams Gewiss-Ballan in ihren hellblau-rot-marineblauen Trikots auf das Siegertreppchen. Zwei von ihnen halten Blumensträuße über den Kopf und winken damit der Zuschauermenge zu. Armstrong kocht vor Wut.
Die Gewiss-Fahrer feierten ihren Erfolg auf seine Kosten. Er war nur 36. geworden und volle zwei Minuten und 32 Sekunden nach den Siegern über den Zielstrich gerollt. Etwa 50 Kilometer vor dem Ziel hatten sich die drei aus dem Hauptfeld abgesetzt und, wie Armstrong das später formulierte, »alle demoralisiert«. Sie forcierten das Tempo, während das Peloton hinter ihnen zu einem winzigen Fleck am Horizont schrumpfte, und sausten über die schmalen, abschüssigen Straßen, bis sie schließlich den Schlussanstieg erreichten, die sogenannte Mauer von Huy (Mur de Huy), einen schweren, etwa 1,3 Kilometer langen Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 10 und einer maximalen Steigung von 26 Prozent. Sie fuhren die »Mauer« zum Zielort Huy hoch, als wäre sie flach wie eine Tischplatte. Moreno Argentin sauste als Erster über die Ziellinie, gefolgt von seinen Teamkollegen Giorgio Furlan und Jewgeni Berzin auf den Plätzen zwei und drei.
Bei diesem Rennen in Belgien, im Frühjahr 1994, wurde das erschöpfte Peloton Zeuge einer faszinierenden Leistungssteigerung, die viele Leute in dieser Sportart EPO zuschrieben. Der Mannschaftsarzt der Siegermannschaft berichtete ihnen davon. Er erzählte es sogar der ganzen Welt. Nach dem Rennen interviewte Jean-Michel Rouet, ein Reporter der französischen Sportzeitung L’Équipe, den Arzt Michele Ferrari und fragte ihn, ob seine Fahrer EPO nehmen würden. »Ich verschreibe das Zeug nicht«, sagte Ferrari. »Aber man kann es zum Beispiel in der Schweiz rezeptfrei kaufen. Machen Sie nicht mich dafür verantwortlich, wenn ein Fahrer das tut. EPO verändert die Leistungsfähigkeit eines Fahrers nicht grundsätzlich.«33 Der Reporter hakte nach: »Es ist auf jeden Fall gefährlich! In den letzten Jahren sind zehn niederländische Fahrer gestorben.« Darauf sagte Ferrari, der lange Zeit jede Art von Doping durch seine Sportler bestritt, etwas, das ihm noch jahrelang zu schaffen machen sollte: »EPO ist nicht schädlich. Der Missbrauch ist schädlich. Wer zehn Liter Orangensaft trinkt, gefährdet seine Gesundheit auch.« Mit anderen Worten: Das alles gehört zu einem ausgewogenen Frühstück.
Doch unter den Nichteingeweihten herrschte Verwirrung. Armstrong, Andreu, Hincapie und Livingston – vier Fahrer, die später den Kern des amerikanischen Radsports bilden sollten – bedrängten ihren eigenen Mannschaftsarzt Max Testa mit Fragen.34 Wie wirkt EPO? Ist es gefährlich? Glauben Sie, dass die anderen Teams es nehmen? Können Sie uns bei der Einnahme anleiten? Testa versuchte, sie davon zu überzeugen, dass sie dieses Mittel nicht bräuchten. Er sagte den Fahrern, ihre natürlichen Fähigkeiten seien ausreichend, und es sei nur ein Gerücht, dass alle Fahrer EPO nehmen würden. »Die Leute wollen mit diesem Zeug nur Geld verdienen, ihr braucht es nicht. Untersuchungen zeigen, dass es nicht wirklich hilft.«35 Testa gewann dennoch den Eindruck, dass EPO auf die Dauer unvermeidlich war. Also gab er den Versuch auf, seine Fahrer davon abzuhalten. Eines Tages überreichte er jedem von ihnen einen Umschlag, der Untersuchungen zu EPO sowie Anweisungen für die Einnahme der Substanz enthielt.36 Die Literatur, die er bereitstellte, lieferte den Fahrern Informationen, wie viel EPO sie wann einnehmen sollten, damit sie nicht überdosierten und sich selbst schädigten oder vielleicht sogar den eigenen Tod herbeiführten. »Wer eine Schusswaffe benutzen will, sollte lieber eine Gebrauchsanweisung lesen und nicht irgendjemand auf der Straße befragen«, sagte er mir.37 Testa räumte zwar ein, den Gebrauch von Dopingmitteln erleichtert zu haben, bestreitet aber nach wie vor, jemals solche Substanzen ausgegeben zu haben.
Die Trainingsfahrt am 18. März 1995 war eine lockere Spritztour, bei der die Motorola-Fahrer stundenlang dahinrollten und ihre Beinmuskulatur auflockerten. Am Vortag, auf dem Rückweg vom Frühjahrsklassiker Mailand – San Remo, hatte Armstrong, der als 73. ins Ziel gekommen war, im Gespräch mit seinem langjährigen Freund und Weggefährten George Hincapie gemeckert: »Das ist scheiße. Die anderen dopen, und wir gucken in die Röhre.«38
Als das Team am folgenden Tag am Comer See unterwegs war, brachte Armstrong die Sache erneut aufs Tapet. Er war 23 Jahre alt und hatte bereits die Straßenweltmeisterschaft und eine Etappe bei der Tour de France von 1993 gewonnen. Aber das war für ihn nur der Anfang. Er trat mit jedem Tag ungestümer auf und würde sich von einer Horde europäischer Schlappschwänze nicht in Grund und Boden fahren lassen, nur weil diese Jungs eine Wunderdroge nahmen und er nicht. Armstrong nahm sich einen Teamkollegen nach dem anderen vor. »Ich werde nass gemacht, wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen ein Programm entwickeln.«39 Die anderen wussten, was er damit meinte. Auch sie waren der Ansicht, die Zeit für EPO sei gekommen.40 Die neue Substanz war allgegenwärtig. Die Fahrer hatten Thermoskannen bei sich, die mit Eis und winzigen EPO-Ampullen gefüllt waren.41 Kling, kling, kling. Man konnte es hören, wenn die Ampullen gegen das Eis stießen. Kling, kling, kling. In dieser Phase des Radrennsports war das die Hintergrundmusik für die gesamte Sportart.
Armstrong hätte sich theoretisch entscheiden können, als Einziger im Team EPO zu nehmen, aber das hätte ihm nicht viel genützt. Der Radsport ist, dem äußeren Erscheinungsbild zum Trotz, eine Mannschaftssportart. Jedes Team hat üblicherweise einen Kapitän, der die Tagesordnung bestimmt und von den anderen Fahrern unterstützt wird. Bei Motorola war das Armstrong, der beste Allround-Fahrer im Team. Die übrigen Mannschaftsmitglieder sind Domestiken – Helfer im Sattel. »Domestique« ist das französische Wort für »Diener«. Die Fahrer tun alles, um dem Kapitän zum Sieg zu verhelfen, wobei Mannschaftstaktik und Aerodynamik eine Rolle spielen. Die Domestiken fahren abwechselnd vor dem Kapitän her – oder, bei Seitenwind, neben ihm –, um ihm Windschatten zu bieten und ihn auf diese Weise Kraft sparen zu lassen. Im Windschatten muss der Kapitän bis zu 40 Prozent weniger Energie aufbieten als bei einer Alleinfahrt, bei der er voll im Wind steht. Das Ziel dieser Taktik besteht darin, den Teamkapitän so ausgeruht wie möglich bis zum entscheidenden Punkt eines Rennens zu begleiten. An diesem Punkt kann er sich dann absetzen und bei einem mehrtägigen Rennen die Etappe gewinnen oder im Kampf um das Trikot des Spitzenreiters und den Gesamtsieg Zeit auf die Konkurrenten gutmachen. Die Domestiken verbrauchen ihre ganze Kraft im Dienst des Kapitäns, der dann oft alleine ausreißt, während sie darum kämpfen, den Zielstrich noch zu erreichen. Aber je stärker sie sind und je länger sie mithalten können, umso größer die Siegchancen des Mannschaftskapitäns.
Armstrong stellte seinen Domestiken im Jahr 1995 ein Ultimatum: Wenn sie es in diesem Jahr ins Team für die Tour de France schaffen wollten, mussten sie mit der Einnahme von EPO beginnen.42 Du willst das nicht? Dort ist die Tür. Armstrong übernahm die Führungsrolle. Es war sein Erfolg, der auf dem Spiel stand. Das Motorola-Programm war ganz auf ihn ausgerichtet. Ein 73. Platz bei einem wichtigen Rennen würde potenzielle Sponsoren nicht überzeugen. Motorola hatte bereits angekündigt, den Sponsorenvertrag zum Saisonende auslaufen zu lassen. Die Mannschaft stand unter dem Druck, einen neuen Geldgeber finden zu müssen.
Als Hendershot die Betreuerrolle übernahm, wurde J. T. Neal Armstrongs persönlicher Assistent. In Como erledigte Neal Botengänge und nahm Armstrong viele Dinge ab, während dieser Rennen fuhr oder trainierte. In den Jahren, in denen Armstrong früh aus der Tour de France ausstieg – 1993, 1994 und 1996 –, holte Neal ihn ab und brachte ihn nach Como. Von Saison zu Saison organisierte er Wohnungswechsel. Er führte ihm den Haushalt. Einmal beglich er eine noch ausstehende Stromrechnung, die Armstrong und Andreu so lange nicht bezahlt hatten, bis der Strom abgestellt worden war. Er reparierte den Wäschetrockner. Nach Armstrongs Rückkehr von der Tour begann Neal mit Massage-Behandlungen, um seinen Schützling auf die Weltmeisterschaft im Herbst vorzubereiten. Die Männer verbrachten viel Zeit miteinander. Neal führte Armstrong in den Museen von Mailand in die Welt der bildenden Kunst ein. Manchmal saßen sie einfach nur vor Armstrongs Wohnung und nahmen mit Blick auf den Comer See eine kalorienarme Mahlzeit ein, zum Beispiel Thunfisch mit Balsamico-Essig und Olivenöl.
Besuche bei Testa standen regelmäßig auf der Tagesordnung. Hendershot gab zwar an, er habe Armstrong bereits kurz nach dessen Vertragsunterzeichnung bei Motorola im Jahr 1992 leistungssteigernde Substanzen gespritzt, doch Armstrong selbst behauptet, er habe bis zur Weltmeisterschaft 1993 nicht gedopt.43 Er sagte, Testa habe ihm Synacthen gegeben, ein Mittel, das die Bildung von Glucocorticoiden (Steroidhormone) in der Nebennierenrinde fördert.44 Synacthen, sagen die Fahrer, sorge für ein Gefühl der Stärke und lindere etwas die Schmerzen, die mit einer anspruchsvollen Fahrt verbunden sind. Das Mittel stand dem Motorola-Team bereits zur Verfügung, als Armstrong seine Mannschaftskollegen zur Einnahme von EPO drängte.45 Hendershot sagte, Armstrong sei bei dieser Weltmeisterschaft »so sauber wie immer« gewesen.
Neal hatte den Eindruck, es sei Testas Aufgabe, bei Armstrong jede nur verfügbare Spritze zu setzen. Testa legte Armstrong ständig Infusionen mit Substanzen, die der Arzt als »Leberreiniger« bezeichnete, die offizielle Bezeichnung dieser Mittel – und damit auch die Antwort auf die Frage, ob sie verboten waren oder nicht – ist allerdings unklar.46 Steven Swart, ein Teamkollege aus Neuseeland, der seine ersten Rennen in Europa bereits 1987 fuhr, lebte nicht in Como und traf deshalb nicht so regelmäßig mit Testa zusammen wie die amerikanischen Fahrer, aber er hatte von Armstrongs Dopingkonsum gehört. In der überschaubaren Radsportszene machten Gerüchte – vor allem solche, die sich auf Doping bezogen – schnell die Runde.
Swart, ein ernster, stämmiger Mann, sah es so, dass Armstrong von seinen Teamkollegen nur verlangte, was die Mannschaftsleitung offiziell nicht zu fordern wagte. Jim Ochowicz, ein zweimaliger Olympiateilnehmer im Bahnradfahren, der als Pate des amerikanischen Radsports gilt, hatte das 7-Eleven-Team gegründet, die erste amerikanische Mannschaft, die zu Rennen in Europa antrat. Als Motorola als Sponsor einstieg, blieb er beim Team. Ochowicz hatte als Erster die Vorstellung, die Amerikaner könnten die alte Radsportgarde in Europa herausfordern, und übernahm es selbst, sie in die Tat umzusetzen. 7-Eleven war 1986 die erste Mannschaft aus den USA, die zur Tour de France antrat, und Davis Phinney, einer ihrer Fahrer, gewann sogar eine Etappe. Ochowicz war jahrelang der wichtigste Ansprechpartner in den USA zu Fragen, die den internationalen Radsport betrafen. Er verhandelte mit Sponsoren und den europäischen Renndirektoren. Im Gespräch mit Journalisten spielte er sein Wissen über das interne Geschehen in dieser Sportart gerne herunter.
Wenn Ochowicz nach Armstrong und EPO oder anderen leistungssteigernden Substanzen gefragt wurde, setzte er eine Miene auf, als wollte er fragen: Wie können Sie an so etwas auch nur denken? Dann lächelte er nervös und sagte: »Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll« (2005) oder »Ich kenne die Antwort nicht« (2009) oder »Die Antwort lautet, dass ich keine Ahnung habe« (2010).47 Er hat bestritten, in irgendwelchen Betrug im Team verstrickt gewesen zu sein oder von solchen Dingen gewusst zu haben. Über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg dachte ich nach solchen Interviews immer wieder, dass Ochowicz entweder ein geübter Lügner oder aber der ahnungsloseste Mensch war, der je in der Kling-Kling-Welt des Radsports unterwegs war. Es ist unglaubwürdig, dass Ochowicz von den Dopingpraktiken im Team – weder von Gerüchten noch von Tatsachen – keine Ahnung gehabt haben soll. Er gehörte zu Armstrongs engstem Kreis, wurde von ihm als sein »Ersatzvater« bezeichnet. Ochowicz war Armstrongs Trauzeuge und ist der Pate seines ersten Sohnes. Hendershot sagte, wenn Ochowicz vom Doping wusste, das Geschehen aber ignorierte, müsse man ihn wohl als die skrupelloseste Person im ganzen Postal-Team bezeichnen, denn es würde bedeuten, Ochowicz verließ sich darauf, dass Ärzte und Betreuer darauf achteten, dass die Fahrer nicht überdosierten und tot vom Rad fielen.
Armstrong gab an, der EPO-Konsum bei Motorola habe im Mai 1995 bei der Tour DuPont begonnen, dem bekanntesten Etappenrennen in den Vereinigten Staaten.48 Nachdem er in den beiden vorgehenden Jahren jeweils Zweiter der Gesamtwertung gewesen war, wurde er in diesem Jahr der zweite amerikanische Sieger nach Greg LeMond. Mit dem Erfolg war eine große Summe verbunden: 40 000 Dollar. Nimmt man die Bonuszahlungen hinzu, verdiente Armstrong sogar 51 000 Dollar. Er teilte sie mit seinen Teamkollegen.
Swart erklärte, er habe Testas Dopinganweisungen im Frühjahr 1995 erhalten. Er und Andreu seien daraufhin in die Schweiz gefahren, um die Substanz zu kaufen. Sie nahmen sie bei der Tour de Suisse, die kurz vor der Tour de France stattfindet. Swart sagte, er habe EPO zum letzten Mal nach dem Prolog der Tour de France 1995 genommen. Bei dieser Tour tauchten jeden Morgen und jeden Abend Teammitarbeiter im Mannschaftshotel auf und brachten Taschen voller Eis für die Thermoskannen der Fahrer. Manchmal waren sie total erledigt, weil die Jagd nach dem Kühlmittel in Gegenden, in denen Getränke meist ungekühlt serviert werden, den ganzen Tag gedauert hatte.49
An einem Ruhetag kamen Armstrong und viele seiner Teamkollegen in einem Hotelzimmer zusammen, um Blutproben abzugeben, die anschließend in einer Zentrifuge geschleudert wurden. Die Zentrifuge trennte das Blut in drei Bestandteile: Blutplasma, rote und weiße Blutkörperchen. Sobald das geschehen war, konnten die Fahrer ihren Hämatokritwert bestimmen. War der Wert zu hoch, bedeutete das, dass sie zu viel EPO zu sich genommen und sich damit vielleicht der Gefahr eines Herzinfarkts ausgesetzt hatten. (Die Fahrer hatten Geschichten von Kollegen gehört, die nachts den Wecker stellten und Gymnastik machten, um zu verhindern, dass ihr durch EPO verdicktes Blut im Schlaf einen Herzstillstand herbeiführte.) Die Hämatokritwerte der Fahrer hätten nach der Hälfte der Tour und so vielen schweren Streckenkilometern eigentlich deutlich unter dem Normalzustand liegen müssen. Durch die EPO-Zufuhr produzierte ihr Körper jedoch genau jetzt zusätzliche rote Blutkörperchen. Ihre Hämatokritwerte sahen aus, als hätten sie keinen einzigen Kilometer zurückgelegt. Sie waren frisch.
Swart sah, dass die meisten seiner Teamkollegen Hämatrokritwerte von über 50 hatten.50 Sein eigener war nach seiner Erinnerung mit 47 Prozent der niedrigste von allen. Andreus habe etwa bei 50 gelegen. Andrea Peron, ein Italiener, habe mit 56 Prozent den höchsten Wert aufgewiesen.51 (Es gibt keinerlei Erkenntnisse zu Doping bei Peron.) Armstrong hatte 52 oder 54, er lag mindestens zehn Prozentpunkte über seinem Normalwert. Auch mit diesem Vorteil beendete Armstrong, ein starker Fahrer bei Eintagesrennen, die Tour auf dem 36. Platz der Gesamtwertung und war fast eineinhalb Stunden langsamer als der Sieger Miguel Indurain.
Mitten in der Nacht erhielt Kathy LeMond einen Anruf. Die Frau des amerikanischen Radsportstars Greg LeMond hörte Schreie und Weinen, als sie in ihrem Haus in Belgien den Hörer abnahm.52 Dann hörte sie, wie jemand rief: »Er ist tot! Er ist tot! Ich wollte ihm helfen, aber er ist schon tot! Ich habe ihn berührt – er ist kalt! Er ist tot!«
Es war die Stimme von Annalisa Draaijer, der amerikanischen Frau des 26 Jahre alten niederländischen Radprofis Johannes Draaijer. Ihr Mann war drei Tage zuvor von einem Rennen nach Hause zurückgekehrt, und in jener Nacht hörte sie, wie er im Bett ein gurgelndes Geräusch von sich gab. Sie versuchte ihn zu wecken, aber sein Körper war schlaff. Er war an ihrer Seite gestorben. Sie wusste nicht, an wen sie sich in dieser Situation wenden sollte. Greg LeMond war zusammen mit Draaijer für das niederländische Team PDM gefahren. Die beiden Frauen hatten sich angefreundet, weil sie beide Englisch sprachen. Sobald Draaijers Tod bekannt wurde, gab es Spekulationen, dass EPO das Blut des Radprofis zu Schlamm verdickt und einen Herzinfarkt verursacht hatte. Es wurde niemals bewiesen, dass Johannes Draaijer 1990 an EPO-Missbrauch starb. Aber für Greg LeMond gibt es keine einleuchtendere Erklärung. »Wofür ist er gestorben?«, fragt LeMond. »Für nichts ... Alle wussten, was vor sich ging, aber niemand tat etwas dagegen. Niemand.«53