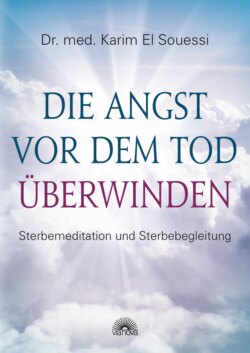Читать книгу Die Angst vor dem Tod überwinden - Karim El Souessi - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление| 6 | Sich sterblich erfahren und neu leben lernen |
In einem seiner Filme sagt Woody Allen: „Nicht, dass ich Angst hätte vor dem Sterben – ich wäre nur gerne nicht dabei, wenn es so weit ist.“ Sterbemeditation geht einen anderen Weg. Sich sterblich erfahren kann ein gutes Mittel sein, nicht nur die Einstellung zum Stress im Alltag zu verändern, sondern auch die Angst vor dem Tod zu meistern. Die Filmemacherin Doris Dörrie schreibt über ihre Methode zur Stressreduktion: „Ich stelle mir den Tod vor, seh mich als Skelett an seiner Seite und frage mich dann selbst als Tote, was ich von dem halte, was ich gerade mache.“ Diese Einstellung führe nicht selten dazu, dass ihr das, was sie gerade meint tun zu müssen, in Anbetracht der kurzen Lebenszeit auf Erden manchmal „ziemlich lächerlich“ erscheint. Zu dieser Einstellung kam sie erst, nachdem ihr Mann 1996 an Leberkrebs verstarb und sie gezwungen war, die Familie allein zu versorgen. Alle Verzweiflung brachte sie schließlich an den Punkt, alle Vernunftgedanken und Appelle über Bord zu werfen und sich zu sagen: „Das Einzige, was für mich stimmte, war: hinsetzen, Klappe halten und auf den Atem achten, sonst nichts.“45
Buddha sagte einmal: „So wie die Schritte des Elefanten gewaltiger sind als die anderer Tiere, ist die Sterbemeditation erhabener als andere Meditationen … Jung und alt, töricht und weise, reich und arm – alle sterben, so wie jeder Tonkrug, groß und klein, gebrannt und ungebrannt, irgendwann zerbricht. Entsprechend endet alles Leben mit dem Tod.“
Der buddhistische Mönch Atisha (980-1055 u.Z.), ein wichtiger Erneuerer des Buddhismus in Tibet, brachte die buddhistische Meditation und Sterbemeditation nach Tibet und entwickelte sie dort weiter. Im tibetischen Buddhismus ist die Meditation über Tod und Vergänglichkeit die dritte von 21 Meditationsweisen. Geshe Gyatsang Gyatso glaubt, dass viele Menschen gerade deshalb, weil sie so stark an weltlichen Dingen und Aktivitäten hängen, das eigene Sterben ausblenden. Dies sei aber „das größte Hindernis bei der Erkenntnis“ der wahren Natur des Seins. „Um dieses Hindernis zu überwinden, sollten wir über den Tod meditieren.“46
Der tibetische Mönch und Meditationslehrer Sogyal Rinpoche verweist darauf, dass man „erst dann angstfrei und in völliger Sicherheit sterben könne, wenn man die wahre Natur des Geistes erfasst habe“; nur diese Erfahrung … und beibehaltene Meditationsübung könne „den Geist im sich auflösenden Chaos des Todes stabil halten. Dann könne man dem Tod mit Freude begegnen.“ Sein Lehrer Dudjom Rinpoche habe oft die Geschichte von einem kranken Yogi erzählt, dessen Arzt wusste, dass es bald zu Ende geht. Der Yogi habe ihn gedrängt, ihm das Schlimmste zu sagen. Zu seiner Verwunderung soll der Yogi ganz begeistert und so voller Vorfreude wie ein kleines Kind auf Weihnachten gewesen sein und ausgerufen haben: „Welch süße Worte, welch freudige Nachricht!“ Danach soll er in den Himmel geblickt haben und auf der Stelle in tiefer Meditation gestorben sein.47
Bei der Sterbemeditation geht es darum, sich dem Unabwendbaren zuzuwenden und sich aus dem Erleben des Getrenntseins von der Schöpfung heraus zu bewegen in eine grenzenlose Seins-Erfahrung, wo wir der Angst vor dem Tod besser begegnen können, ohne sie verdrängen zu müssen. Wenn wir den Tod nicht mehr als Grenze erfahren, bleibt nur noch das Verweilen im Einen. Die irakische Sufi-Heilige Rabi’a al Adawiyya drückte es so aus:
„Ich sehe kein Leiden, ich sehe nur Gott … Ich bedauere nicht das Leid, das ich erfahren habe, ich trauere nur dem Leid nach, das ich nicht habe erfahren dürfen.“48
Sie wehrte sich gegen die Anbetung unnützer Gegenstände, die nichts mit Gott zu tun hätten, und soll ausgerufen haben: „Was nützt mir die Kaaba, wenn ich sie hätte? Das berühmteste Heiligtum dieser Welt – Gott – ist nicht drinnen, er ist nicht draußen. Die Wahrheit ist, dass er sie nicht braucht.“
Johann Wolfgang von Goethe schreibt im „West-Östlichen Diwan“:
„ Und so lang du das nicht hast,
dieses Stirb und Werde,
bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.”49
Dieses Stirb und Werde findet sich nicht in der Anbetung äußerer Gegenstände, sondern im eigenen Inneren. Mit Recht verweist der amerikanische Management-Trainer und Autor S. R. Covey darauf, dass das Paradies „kein Ort ist, wo man hingeht, sondern ein Bewusstseinszustand“. Dieser Bewusstseinszustand entsteht nicht, wenn wir unsere Sehnsucht nach Glück durch die Befriedigung materieller Wünsche oder durch die Suche nach irgendeinem weltlichen Ort des Glücks zu stillen versuchen und damit eher noch vertiefen. Auch die Flucht vor dem Alltag hilft nicht. Wir finden nirgendwo, was wir eigentlich suchen: einen stillen Geisteszustand, einen Bewusstseinszustand voller Gleichmut und Gelassenheit, in dem „jeder Tag ein guter Tag ist“50 und der uns hilft, auch schlimmes Leid in Ruhe und Gelassenheit zu ertragen. Zwanghaftes Festhalten an Perfektionismus und Zeitdruck, an selbstgesteckten Zielen und am „Funktionierenmüssen“ sind große Hindernisse. Wir sollten den Mut haben, weniger zu funktionieren und mehr zu sein wie die Kinder. Was hat uns früher einmal zum Lachen und Leuchten gebracht? Worin waren wir so vertieft, dass eine vollkommene, eine heilige Stille entstand?
Es geht darum, dass wir uns dieses Paradies zurückholen, indem wir unser Anhaften an allzu festen Zielen lösen und zulassen, dass Stille entsteht, anstatt unser Glück in äußeren Dingen, Zielen und dem Anklammern an Bindungen zu suchen. „Das größte Glück, das dir zuteilwerden kann, ist das Bewusstsein, dass du nicht unbedingt Glück brauchst“, schrieb der US-amerikanische Schriftsteller William Saroyan, und schon Aristoteles lehrte vor 2000 Jahren, dass jeden Menschen etwas anderes glücklich macht. Kranke sehen in der Gesundheit das höchste Gut, Arme im Reichtum, manch alter Mensch im Jungsein. Wir glauben vielleicht, dass uns die interessante Reise, der vollkommene Lebenspartner oder der Besitz eines Hauses glücklich macht. Dabei jagen wir äußeren Dingen hinterher, Dingen, die allesamt vergänglich sind und uns bestenfalls kurze Augenblicke der Freude ermöglichen.
Abb. 6: Der Prophet Mohammed im Siebenten Himmel vor Gott
Genauso können das Festhalten an erlebtem Leid oder die Sorge um zukünftiges Leid zu endlosen Beschäftigungen werden und den Blick auf die Endlichkeit des Daseins verdecken. Der verstorbene Kabarettist Hanns-Hermann Kersten drückt dies in seinem Gedicht „Ganz still und stumm“ eindrücklich aus:
Wir sitzen still auf unserm Stern,
und wer uns lieb hat, hat uns gern.
Und wer uns hasst, der lässt es bleiben.
So kann man sich die Zeit vertreiben.
Wenn sich die Erde dreht und dreht,
dann merkt man, wie die Zeit vergeht.
Zermürbend wirkt die Rotation.
Wo bleibt der Tod? Da kommt er schon.51
Wenn Sören Kierkegaard in seiner Rede „An einem Grabe“ fordert, den Tod ins Leben mit Ernsthaftigkeit einzubeziehen, dann will er zu Bedachtheit aufrufen: „Der Tod im Ernst [bedacht] gibt Lebenskraft wie nichts anderes, er macht wachsam wie nichts anderes.“52 Ohne die Begrenzung des Todes, so Wilhelm Schmid, wäre unser Leben bedeutungslos, denn „es gäbe keinen Grund, sich um ein schönes und erfülltes Leben zu sorgen. Und gelänge es einst, das Leben ewig dauern zu lassen, schwände die Anstrengung, es wirklich zu leben, dramatisch, und die Individuen brächten ihr Leben wohl erst recht damit zu, auf ‚das Leben’ zu warten.“53