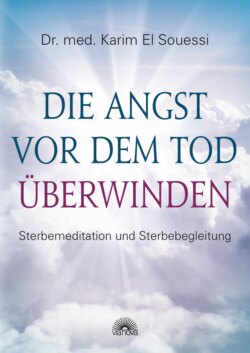Читать книгу Die Angst vor dem Tod überwinden - Karim El Souessi - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление| 1 | „Kein Selbst, keine Probleme“ |
Mit diesem etwas provokanten Ausspruch will der buddhistische Wald-Mönch Ajahn Chah deutlich machen, dass ein Ich ohne Ich-Verhaftung keine Probleme mehr hat. Aber dagegen könnte man auch wie der demenzkranke Vater in Arno Geigers Roman „Der alte König in seinem Exil“14 einwenden: „Das Leben wäre ohne Probleme auch nicht leichter.“
Nach zen-buddhistischen Vorstellungen werden wir als ein Niemand geboren, werden zu einem Jemand, um am Ende des Lebens wieder zu einem Niemand zu werden. Ein Dōka-Gedicht des japanischen Zen-Meisters Ikkyū Sōjun (1394-1481) drückt es so aus:
Wir essen, verdauen, schlafen und stehen auf;
Das ist unsere Welt.
Alles, was uns danach zu tun noch übrig bleibt,
Ist zu sterben.15
Nichts Besonderes also – selbst wenn wir zu Jemand geworden sind, sind wir aufgerufen, diesem Jemand keine übermäßige Bedeutung beizumessen, damit wir am Ende unseres Lebens erkennen, wie es der japanische Zen-Meister Dogen (1200-1253) ausdrückte, „dass die Augen waagrecht, die Nase senkrecht sitzen“. Dogen schreibt weiter: „Von niemandem in die Irre geführt, kam ich mit leeren Händen zurück. Ich kam ohne eine Spur des Buddha-Gesetzes zurück und lasse der Zeit ihren Lauf.“16
Ich möchte diesem Jemand, der ich selbst bin, nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Da es aber um sehr persönliche Themen wie Tod und Sterben geht, möchte ich Ihnen doch einige Erlebnisse aus meinem Leben erzählen, die mich geformt haben und die Grundlage meiner Weltsicht bilden.
Mein Vater war eingebürgerter US-Amerikaner ägyptischer Abstammung, meine Mutter Deutsche. Ich wurde 1961 geboren und wuchs überwiegend in Deutschland auf. Meine Erziehung war von engen muslimischen und christlichen Wertvorstellungen geprägt, auch wenn das Religionsverständnis meiner Eltern eher ein oberflächliches war. Diskussionen gab es über Schweinefleisch, Jesus als einzigen Sohn Gottes, die Jungfräulichkeit Marias, die Heilige Dreifaltigkeit, den Ramadan und vieles mehr. Meine außerhäusliche Erziehung verlief überwiegend katholisch, ich war auch lange als Messdiener tätig, verließ die Kirche aber mit 23 Jahren, weil buddhistische und mystische Texte mich stärker anzogen. Auch der frühe Tod meiner Eltern und der Unfalltod meiner Schwester mit 20 Jahren haben mich geprägt: Beide Ereignisse konfrontierten mich drastisch mit der Vergänglichkeit und der Frage, welchen Sinn das Leben hat. Bei meinem Vater musste ich selbständig entscheiden, die künstliche Beatmung abzustellen. Nach ägyptischem Brauch wusch ich den Leichnam, wickelte ihn in Leinentücher ein und richtete im Grab Kopf und Körper nach Mekka aus. Das half mir, Abschied von ihm zu nehmen.
Meditation sowie ein Nahtod-Erlebnis mit 33 Jahren führten mich dazu, den Sterbeprozess anders zu begreifen. Drei Lichtgestalten begleiteten mich durch eine Art Tunnel in ein gleißend helles Licht, bis eine Stimme rief: „Es ist noch nicht Zeit!“ Da ließen sie mich los, so dass der Seelenkörper wieder in den physischen Leib eintrat.
Wie die buddhistische Madhyamaka-Tradition (Schule des Mittleren Weges) halte ich es für möglich, dass es eine gewöhnliche Wirklichkeit, im Sanskrit Nirmana-kaya (Körper der Verwandlung, irdischer Körper) und eine ultimative oder absolute Wirklichkeit (Dharma-kaya, Körper der großen Ordnung) gibt. Aus feinstofflichen Bereichen könnte es durchaus eine Wiedergeburt in den irdischen Körper geben.
Im Kontext meiner Suche erlernte ich T’ai Chi, Qi Gong und Akupunktur in Deutschland und China und interessierte mich für Parapsychologie, Auraarbeit und andere esoterische Wege. Ich besuchte unter anderem eine Sufi-Gruppe sowie andere religiöse Gruppierungen (Bahai, Oomoto, Krishnamurti, Yesudian/Haich, Transzendentale Meditation, Osho, Sai Baba, u.a.) – alles, was mit Spiritualität zu tun hatte, zog mich an. Mit der Zen-Meditation begann ich 1978 und nahm früh an Zen-Meditationskursen teil, reiste viel in Europa, Mexiko, den USA, Japan, Korea, Thailand sowie in Indien. Im Laufe der Jahre erhielt ich Unterricht von asiatischen, indischen und christlichen Zen-Lehrern, die in Asien Meditation erlernt hatten, unter anderem von Pater Enomya Lasalle, P. Victor Löw, Paul Shepherd, P. Willigis Jäger, Sr. Ludwigis, den japanischen Äbten Ekai San, Meister Deshimaru, Kubota Roshi und Yamada Ryoun Roshi. Ebenso konnte ich bei den koreanischen Zen-Meistern Su Bong Se Nim und De Seung Se Nim Meditationskurse besuchen, sah Meister Shen Yeng in Taiwan, übte bei dem Vipassana-Mönch Tiradhamo und dem indischen Jesuitenpater und Zen-Meister P. Arul Arokiasamy (AMA Samy), dessen Schüler ich seit 1990 bin. Bei all den Reisen war mir die Weltsprache Esperanto ein großer Helfer, ich erhielt durch Esperantisten auf der ganzen Welt viel Unterstützung bei der Suche nach spirituellen Lehrern.
Das Medizinstudium zwang mich zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit. Es gab berührende Momente während der Nachtdienste auf den Stationen mit alten, schwerstkranken Patienten. Hier musste ich mich ständig mit dem Tod beschäftigen, es gab keine Möglichkeit mehr, das Sterben auszublenden, wie es sonst in unserer Kultur üblich ist. Wie im Buch der Zen-Priesterin und Anthropologin Joan Halifax „Being with Dying“17 beschrieben, hörte die ‚Glocke des Todes’ in diesen Nächten nie auf zu schlagen. Zerstreuung und Ablenkung waren nicht möglich, weil es kaum noch Apparate zu betreuen oder Medikamente zu verabreichen gab.
Dieses Buch entstand aus dem Wunsch, diese Erfahrungen und Lehren weiterzugeben und andere Menschen dabei zu unterstützen, leichter, gelassener und friedlicher mit dem leidvollen und oft tabuisierten Thema ‚Sterben’ umzugehen.
Sich den Sterbeprozess, auch den eigenen, immer vor Augen zu halten, ist kein Plädoyer für Nachlässigkeit gegenüber der eigenen Gesundheit oder gar Suizidbeihilfe, wie dies derzeit vielfach diskutiert wird. Selbst der Entwurf eines neuen § 1921 a im Bürgerlichen Gesetzbuch, der vorsieht, dass volljährige und einwilligungsfähige Personen, die an einer unmittelbar zum Tode führenden Erkrankung leiden, ihren Arzt um Suizidbeihilfe bitten können, ist umstritten, da heute fast alle Schmerzen und selbst extreme Luftnot in den Griff zu bekommen seien, wie der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Prof. Dr. med. Lukas Radbruch, betont.18
Für den in Deutschland wohl berühmtesten Geist-Heiler Bruno Gröning (1906-1959) war es eine spirituelle Pflicht, Menschen statt beim Sterben bei der Selbstheilung bis zum Lebensende zu unterstützen. Körperliche Ordnung war für ihn gleichbedeutend mit göttlicher Ordnung, deshalb sollte auch das einzelne Lebewesen – ganz gleich, ob die Heilungsversuche zum Weiterleben führten oder nicht – vor seinem Heimgang einen körperlich-seelisch geordneten Zustand anstreben. Da jeder lebende Organismus bemüht ist, einen ungeordneten bzw. kranken körperlichen Zustand bis in den Sterbevorgang hinein zu ‚reparieren’ und man oft nicht genau sagen kann, wie lange ein Mensch noch lebt oder ob er gar wieder gesund werden wird, hielt er es für richtig, dass jeder einzelne dieses Bemühen unterstützt.19 Ich halte es als Arzt für wichtig, sich auf allen Ebenen um das körperlich-seelische Wohl eines Todkranken zu bemühen, ihn nicht aufzugeben, für jeden Ausgang offen zu sein und ihn zum gegebenen Zeitpunkt zu unterstützen, den Sterbeprozess gut anzunehmen.20
Da Krankheit mitunter auch psychische Auslöser haben kann, sollte man sich auch fragen, ob die organische Störung aufgrund dysfunktionaler oder destruktiver Denk- und Verhaltensweisen entstanden ist. Heilung und Ordnung beziehen sich stets auf den ganzen Menschen mit seiner Körperlichkeit, seiner Psyche und seiner spirituellen Verfassung. Daraus können sich für das eigene Leben neue Wege entwickeln, um zur Gesundung in einem ganzheitlichen Sinn zu kommen. Es ist durchaus möglich, dass eine Erkrankung, die psychisch mitbedingt ist, zwar auf der emotionalen und mentalen Ebene ‚aufgelöst‘ wird, körperlich aber trotzdem weiter fortschreitet, weil der somatische Prozess nicht mehr aufhaltbar ist. Selbst Buddha soll sinngemäß einem Mönch, der gesehen hatte, wie ein Junge einen Stein nach ihm warf, und sich darüber gewundert hatte, weil er glaubte, Buddha habe sein schlechtes Karma ganz aufgelöst, geantwortet haben, dass die Materie aufgrund ihrer Trägheit stets hinterherhinke.
Umgekehrt klagten etliche Heiler, wie zum Beispiel Jiddu Krishnamurti, darüber, dass sich körperlich geheilte Menschen in ihrem Gefühls- und Seelenleben oft überhaupt nicht wandelten. Krishnamurti hörte als Konsequenz daraus schließlich sogar ganz auf zu heilen.21
Krankheit hat aber auch eine andere Seite. Schon Plinius der Jüngere schreibt seinem Freund Maximus, dass wir „… (1) die besten Menschen sind, wenn wir krank sind. Denn wen quälen, wenn er krank ist, Habgier oder Leidenschaft? (2) Der Kranke ist nicht Sklave der Liebe, er strebt nicht nach Ehren, kümmert sich nicht um Reichtum und er ist zufrieden, wie wenig er auch besitzt, da er es ja doch zurücklassen muss. Jetzt erinnert er sich daran, dass es Götter gibt, dass er ein Mensch ist. Er beneidet niemanden, niemanden bewundert er, niemanden verachtet er, und nicht einmal böses Geschwätz erweckt seine Aufmerksamkeit oder erheitert ihn: er träumt nur von Bädern und Heilquellen. (3) Das ist seine größte Sorge, sein größter Wunsch, und er nimmt sich vor, wenn es ihm gelingen sollte, davonzukommen, in Zukunft ein angenehmes und ruhiges, das heißt ein ungefährdetes und glückliches Leben zu führen. (4) Ich kann also […] zusammenfassen, dass wir fortfahren sollen, in gesunden Tagen so zu sein, wie wir während einer Krankheit versprechen, uns in Zukunft zu verhalten. Lebe wohl!“22
Wenn wir durch Krankheit aus dem alltäglichen Getriebe, aus unserer gewohnten Ordnung herausgerissen werden, ändert sich unser Verhältnis zur Zeit. Ohne große Erwartungen und Pläne erfahren wir die Stunden nun anders. Das Jetzt, die Gegenwart, dehnt sich aus und unsere Wünsche und Bedürfnisse reduzieren sich auf das Notwendigste. Man wird mitunter stiller und rückt näher an den Zustand der Formlosigkeit heran, erlebt sich möglicherweise als dünnhäutiger oder feiner und transparenter. Das Bewusstsein für die Anbindung an etwas Größeres, Unfassbares und zugleich Vertrautes rückt stärker in den Vordergrund.
Für den Mystiker Henri le Saux wurde der Herzinfarkt zu einer spirituellen Erfahrung und zu einer Befreiung aus den irdischen Ketten. In einem Brief schrieb er: „Wirklich, eine Tür öffnete sich im Himmel, als ich am Straßenrand lag. Aber ein Himmel, der nicht das Gegenteil der Erde ist, etwas, was weder Leben noch Tod ist, sondern einfach Sein, Erwachen … jenseits aller Mythen und Symbole.“23