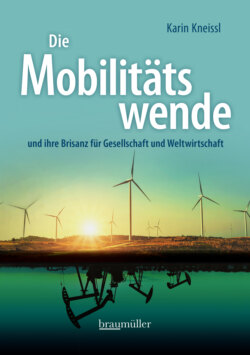Читать книгу Die Mobilitätswende - Karin Kneissl - Страница 10
1. KAPITEL: WENN AUTOFABRIKEN ZU MUSEEN WERDEN
ОглавлениеTurin – die Zeitenwende – vom Erfinderreichtum zum Stillstand in Deutschland – Detroit und die Risiken für Bratislava. Europas Niedergang und Chinas Aufstieg – die Rolle Afrikas als neue globale Produktionsstätte. Ein historischer Rückblick auf Erreichtes, wir leben noch vom Erfindergeist ante 1914. Ein kritischer Ausblick auf den Stillstand in der europäischen Automobilindustrie, die Folgen für die Zulieferer, mögliche Massenarbeitslosigkeit in diesem Sektor.
Die größte und modernste Autofabrik der Welt befand sich vor dem Ersten Weltkrieg in Turin, der einstigen Residenzstadt der italienischen Könige. Die Mitbegründer der Fiat-Werke, die Industriellenfamilie Agnelli, sollten im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer Art republikanischen Königsfamilie in Italien aufsteigen. Begründet wurde das Industrieimperium von Giovanni Agnelli (1866–1945), der im Jahr 1899 die „Società Italiana per la Costruzione e il Commercio delle Automobili Torino“, aus der später die „Fabbrica Italiana di Automobili Torino“, weltweit als Fiat bekannt, hervorging. Turin und Fiat sind eng mit dem italienischen Wirtschaftswunder verbunden. Doch mit dem Abzug der Industrie nach Süditalien und Osteuropa begann sich auch die Stadt zu entleeren, so fiel die Bevölkerung seit den 1980er-Jahren um rund ein Drittel auf unter eine Million Menschen.
Vom Piemont und Turin hatte die Einigungsbewegung Italiens zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihren Anfang genommen. Italien sei nur ein geographischer Begriff, soll der österreichische Staatskanzler Klemens Metternich einst abschätzig über das Land gesagt haben. Die italienischen Nationalisten mit ihrer offenen Rebellion gegen die Herrschaft der Habsburger bereiteten dem Kutscher Europas, wie der mächtige Stratege Metternich damals genannt wurde, ständig Probleme. Der Nationalstaat Italien, der seit 1861 offiziell existiert, nahm in dieser eleganten Stadt mit ihren großzügigen Boulevards und schönen Plätzen seinen Anfang. Stolz auf den Aufbau einer italienischen Nation zeitigten dann auch hier der italienische Erfindergeist und vor allem das Gespür für attraktives Design und originelle Werbung zu Erfolgen im Dienste der aufstrebenden italienischen Industrie.
1912 begann mit der Produktion des Fiat Zero die Großserienproduktion. 1916 errichtete Fiat das Automobilwerk im Stadtteil Lingotto. Die Produktionsanlage war die größte und fortschrittlichste ihrer Zeit, die Architektur der Anlage fasziniert gleichermaßen durch ihre Größe und Ästhetik. Auf dem weitläufigen Dach befand sich eine Rundkursteststrecke, die Autos konnten durch das gesamte Gebäude fahren. Heute ist die Fabrik ein eher stilles Einkaufszentrum, mit viel Sorgfalt renoviert, aber es fehlt das Flair des „Immer-schneller-immer-Weiter“ und der „industria“, was auf Latein ja nichts anderes als Fleiß bzw. Unternehmergeist bedeutet. Wo Benzinduft und Schweiß in der Luft lagen, atmet der Besucher heute die Aromaluft des leeren Kaufhauses. Das einstige Industrieviertel von Turin spiegelt auf tragische Weise die Deindustrialisierung in Europa wider. Zu Beginn der 1970er-Jahre produzierte und verkaufte Fiat sowohl weltweit wie auch in Europa mehr Autos als VW und war damit der größte Automobilkonzern Europas. Tempi passati – „es war einmal“ auf Italienisch.
In dem Bezirk befindet sich heute ein Automobilmuseum, das Museo Nazionale dell’Automobile. Es gehört im Vergleich zu den vielen Automuseen, die sich von Zwickau mit dem August-Horch-Museum, das dem Gründer von Audi gewidmet ist, über das Porsche-Museum am Mattsee in Salzburg bis nach Hamburg und Paris ziehen, zu den wirklich gelungenen Museen seiner Art. Wenn aus Autofabriken Museen werden, dann stimmt aber etwas nicht. Denn trotz aller Anmut der lebenswerten Stadt am mächtigen Fluss Po ist die Identitätskrise überall spürbar. Mailand stellt heute das elegante Turin, das das Zentrum von Ingenieurskunst war, in den Schatten. Anstelle des Autobaus traten Finanz- und Versicherungswesen. Der Niedergang der Automobilindustrie und anderer Betriebsstätten veränderte diese wichtige Wirtschaftsregion Norditaliens, die mit Bayern gleichbedeutend als Wirtschaftsmotor und Arbeitgeber in der Europäischen Union (EU) ist.
Fiat als alleinstehende Marke, die sich dann noch den Rennstall Ferrari leistete, musste bereits in den letzten Jahrzehnten an den großen Fusionswellen mitwirken. Aus Fiat wurde 2014 Fiat Chrysler Automobiles, wozu folgende Marken gehören: Fiat, Alfa Romeo Chrysler, Jeep, Ram, Dodge, Lancia, Maserati. Fiat Chrysler (FCA) hatte unter seinem charismatischen Manager Sergio Marchionne auf große Investitionen in Elektroantriebe verzichtet. Erfolge erzielte der Konzern mit den großen Spritschluckern der Marken Jeep und Ram in den USA. Im Herbst 2019 erfolgte dann die Megafusion mit der französischen Traditionsfirma Peugeot SA, der neben Peugeot auch Citroën, DS, Vauxhall und seit 2017 das einstige deutsche Flaggschiff der Autoindustrie, Opel, angehören. Gemeinsam sollen sie – so die Fusionspläne im zunehmend rauen Umfeld – fortan pro Jahr 8,7 Millionen Autos verkaufen und dabei einen Umsatz von 170 Milliarden Euro erzielen. Ob die 400.000 Mitarbeiter ihre Stellen behalten, ist in der verschärften Autokrise von 2020 noch zweifelhafter geworden. Nur noch Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund sind größer als der neue Autogigant, vorerst die Nummer vier in der Liste der Autoriesen.
Beim Gang durch das sehr ansprechend gestaltete Automobilmuseum in Turin durchstreift man die europäische Geschichte in all ihren Facetten, ihren wirtschaftlichen Höhen, den vielen kriegerischen Einbrüchen und der gesellschaftlichen Reaktion. Aus großen Limousinen der 1920er und 1930er wurden nach dem Krieg dann Minifahrzeuge wie der Topolino. Die Autos jener Epochen hatten ihren Charakter, ihr unverwechselbares Äußeres und ihre ganz spezielle Entstehungsgeschichte. Bezeichnend sind die Anekdoten, die sich um die Entwicklung des Käfermodells von Volkswagen und den 2CV von Citroën ranken. Die Abkürzung 2CV (Deux Chevaux) steht für die französische Version von Zwei Pferdestärken. Im Deutschen wurde das sehr französische Auto liebevoll Ente genannt. Eine der Legenden, die mir, der stolzen Lenkerin einer Ente, von einem passionierten Käferfahrer einst berichtet wurde, besagt folgende Geschichte: Als die Deutschen im Sommer 1940 Paris besetzten, sollen sich Berliner Ingenieure sogleich auf den Weg zu den Citroën-Werken gemacht haben. Man wusste von der Idee des Gründers André Citroën, ein Auto in Auftrag gegeben zu haben, das einen neuen Kundenkreis, nämlich die wichtige Landbevölkerung ansprechen sollte. Mit der Wirtschaftskrise und Verarmung der Franzosen in den 1930er-Jahren war das bisherige Geschäftsmodell teurer Limousinen nicht mehr tragbar. Zielvorgabe war, ein günstiges Fahrzeug zu entwickeln, sodass zwei Bauern mit rund 30 Stundenkilometern über einen Feldweg fahren könnten, ohne dass die Paletten roher Eier, die an Bord waren, zerbrachen. Immerhin war der weit überwiegende Teil der französischen Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Eine solche Kundschaft wollte erschlossen werden. Zeitgleich wurde während der NS-Herrschaft in Deutschland die Automobilindustrie vorangetrieben. Bereits im Juni 1934 beauftragte der „Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie“ (RDA) Ferdinand Porsche mit der Konstruktion eines „Volkswagens“. Einige Monate später stand der erste Prototyp mit luftgekühltem Boxermotor, es folgten intensive Testfahrten von 2,4 Millionen Kilometern. 1938 wurde nach Überarbeitungen das Serienmodel mit dem charakteristischen Brezelfenster, Trittbrettern und Stoßstangen präsentiert. Die Anekdote, die mir einst erzählte wurde, besagt nun, dass kurz nach dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in Paris deutsche Ingenieure sich eben auf den Weg zu den Citroën-Werken machten, um sich über den Stand der Konstruktion des dortigen Bauernautomobils kundig zu machen. Die Franzosen sollen – so die Legende – sofort alle Entwürfe vernichtet haben. Die erste Ente lief dann nach dem Krieg vom Stapel. Die Geschichte mag auch nur Legende sein, aber sie illustriert den Zeitgeist der Autokonstrukteure. Vielleicht träumte mancher VW-Ingenieur schon von einem deutsch-französischen Automodell, gewissermaßen das Beste aus beiden Mechanikerwelten.
Der Firmengründer verstarb bereits 1935, das Unternehmen fiel an den wichtigsten Gläubiger: Michelin. Citroën war ein Meister der Hydraulik, die für viele Jahrzehnte die Marke auszeichnen sollte. Legendär waren eben jene Citroën-DS-Limousinen, die zwischen 1955 und 1975 gebaut wurden und in so manchem französischen Filmepos auftraten. Am Steuer saßen ein Alain Delon oder Lino Ventura, das perfekte Auto mit einer ganz besonderen Geschichte machte Filmkarriere.
Im von den Alliierten besetzten Deutschland wurden im Auftrag der britischen Militärregierung Volkswagen produziert. 1946 waren es 10.000 Autos, 1951 wurde der Volkswagen bereits in 29 Länder exportiert, über 250.000 Fahrzeuge. 1962 waren es fünf Millionen Volkswagen, die einige Jahre später in der Werbung offiziell zum Käfer wurden und auch wieder Filmgeschichte schrieben. Wer war nicht von dem autonom fahrenden und so gefühlvollen Herbie auf der Leinwand begeistert? 1978 lief der letzte in Deutschland gebaute Käfer im Werk Emden vom Band. Die Produktion in Mexiko ging dann 2003 zu Ende. Damit fand ein besonderes Kapitel der Autogeschichte ihr industrielles Ende.