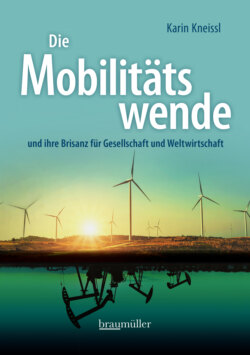Читать книгу Die Mobilitätswende - Karin Kneissl - Страница 13
Die Werkbank, der Absatzmarkt und der Technologieführer China
ОглавлениеErst 1949 wurde die Volksrepublik China nach einem blutigen Bürgerkrieg und langen militärischen Auseinandersetzung mit der japanischen Besatzungsmacht wieder ein souveräner Staat. Jahrhunderte kolonialer Einmischung hatten die wirtschaftliche Entwicklung und die Ausdehnung des Staatsgebiets mitbestimmt. Der nationale Zerfall infolge der Opiumkriege der Europäer nimmt in der nationalen Selbstwahrnehmung einen gewichtigen und emotionalen Stellenwert ein. Diese europäischen Einmischungen wirken bis heute nach. So manche zeitgenössische Denkschule des neuen/alten chinesischen Nationalismus sinnt auf eine späte Retourkutsche. Letztere könnte sich über die chinesische Infrastruktur in Europa und damit die nächste Generation der Mobilität anbahnen. Denn die harte Konkurrenz für die europäische Industrie ist in China entstanden. Die Sorge deutscher Autokonzerne, von China noch an die Wand gefahren zu werden, geht seit geraumer Zeit um. Verschlafen wurde in Europa allerhand. Als ich Ende 2017 das Amt der österreichischen Außenministerin antrat, setzte ich drei Prioritäten, eine davon war ein Asien-Schwerpunkt. Sich mit der Region zu befassen, ihr Augenmerk zu widmen, war bedauerlicherweise viele Jahrzehnte vernachlässigt worden. Die Entwicklung der Automobilindustrie nahm ich in viele Gesprächstermine mit, da es mich einfach interessierte, wie dieser wichtige Wirtschaftszweig in unsere politischen Beziehungen hineinspielte und umgekehrt.
Das einstige Reich der Mitte, feudal und abgeschottet, erfand sich neu im Namen des Kommunismus ab 1949. Die Kulturrevolution brachte die Menschen, im Kollektiv und jeden Einzelnen, mit vielen Rückschlägen an den Rand der Existenz. Doch China arbeitete sich zurück in die Weltwirtschaft. Mit der Öffnung des Landes ab 1979 begann ein völlig neues Kapitel, das zwar 1989 mit der Niederschlagung der Studentenproteste einen Bruch erlebte, aber danach doch weiterging. China würde einige Jahrzehnte für Imitation, Billigproduktion und „Absatzmarkt für Rohstoffe“ stehen.
Doch fast unbemerkt wurde China zum globalen Investor, der nach Plan vorgeht, wenn er sich auch oft genug mit Versuch und Irrtum sehr pragmatisch in einem Sektor ein- und hocharbeitet. Die international angelegten Investitionen, ob auf dem afrikanischen Kontinent oder in Mitteleuropa, erfolgten zunehmend mit geopolitischen Ambitionen. Anders als Japan, oft Vorbild und historisch gehasster Nachbar, ist China nicht nur geschäftlich, sondern mit politischer Kraft tätig. Der chinesische Traum, den Xi Jinping, seit 2017 Präsident auf Lebenszeit, dem chinesischen Volk verheißt, bedeutet die Rückkehr Chinas als Führungsmacht. Dass die nächste Ära der Globalisierung eine unter chinesischer Ägide werden würde, verkündete Xi Jinping bereits in Davos im Jänner 2017. Dass sich damit auch die Arbeitsweise in wichtigen Industriebetrieben deutlich an chinesischen Vorgaben orientieren würde, spürten u. a. deutsche Automobilkonzerne immer mehr. Von einem fairen Zugang zu gleichen Bedingungen war immer weniger zu spüren. Was Diplomaten in den Handelsgesprächen als „fair level playing field“ bezeichnen, war kaum vorhanden. Denn während chinesische Investoren zu 100 Prozent westliche und andere Firmen aufkauften, sind nichtchinesische Käufer bei ihren Bemühungen in China mit Joint Ventures unter 50 Prozent, vielen politischen Beschränkungen und Kontrollen durch entsandte Regierungsvertreter in den Betrieben konfrontiert. Beim BOAO-Forum, dem „asiatischen Davos“ in Hainan, im April 2018 versprach Xi Jinping umfassende Lockerungen bei Beteiligungen ausländischer Firmen, insbesondere in der Autoindustrie. Die erste Reaktion der Autobauer war voller Jubel, doch de facto wurde die chinesische Dominanz gerade in dieser Branche immer heftiger.
Als Außenministerin begleitete ich damals Bundespräsident Alexander Van der Bellen und unsere große Delegation quer durch China; es war ein Staatsbesuch der Superlative mit einem mulmigen Gefühl. Bereits einige Monate zuvor hatte ich in meinem Buch „Die Wachablöse“ den Ausverkauf europäischer Betriebe an China kritisch gesehen, so bestätigte jene intensive Besuchswoche meine Skepsis an der heftigen chinesischen Umarmung. An einem „Memorandum of Understanding“, wie es bereits zuvor schon einige europäische Staaten im Rahmen der „16+1“-Kooperation mit China formalisiert hatten, hatte ich als außenpolitische Ressortchefin kein Interesse. Wir behielten diesen Kurs dann auch als Regierung bei, wenngleich es nicht einfach war, dies mit allen Regierungsmitgliedern in dieser Form zu handhaben.
Die Malaise auf europäischer Seite hat sich indes verschärft. So dürfen deutsche Autokonzerne in China beim Bau der scheinbar zukunftsträchtigen Elektroautos oftmals nur mehr die Karosserie verantworten. Das Kernstück, die Batterie, fertigen die chinesischen Partner. Sie verfügen mittlerweile nicht nur über die weltgrößten Betriebsstätten dieser Art, sondern haben die wesentlichen Konzessionen für strategische Rohstoffe wie Lithium erworben. Europäische Autobauer hinken gerade beim Zugang zu diesen Rohstoffen nach. Doch darüber hinaus bahnt sich ein grundsätzlicher Konflikt an: China ist angetreten, auch in der Autobranche zur Nummer eins aufzusteigen. In den chinesischen Führungsetagen hat man zu einem viel früheren Zeitpunkt als in Europa begriffen, dass es um Mobilität in ihrer Gesamtheit geht. In den „Smart Cities“, die der chinesische Wirtschaftsboom im letzten Jahrzehnt schuf, als China die Lokomotive der Weltwirtschaft war, wird Mobilität von Grund auf neu gedacht. Wer einmal dazu von chinesischer Seite mit eindrucksvollen Zahlen gebrieft wurde, verspürt, wie groß bereits der Abstand zwischen dem Technologieführer China und dem Rest der Welt ist. Hinzu kommt eine gesellschaftspolitische Dimension, die derartige Reißbrettentscheidungen ermöglicht, denn hier steht das Kollektiv über dem Individuum. Die Mobilität wird vom Kollektiv für das Kollektiv gemacht. Denn die Staus auf den Stadtautobahnen in den chinesischen Megastädten kosten Prozentpunkte der Volkswirtschaft. Noch wirkt manches anarchisch in China, aber die Ausweitung der totalen Kontrolle war bereits vor der Pandemie im Gange und hat sich über einen technischen Sprung im Namen von Gesundheit und Sicherheit zur digitalen Diktatur verdichtet. Das Konzept findet auch Akzeptanz in vielen anderen Staaten, wo kritisches Denken auf dem Rückzug ist. Diese Entwicklung reduziert sich nicht auf die Volksrepublik China, denn auch in unseren Gesellschaften werden Stimmen laut, im Namen der Gesundheit sehr viel Privatsphäre aufzugeben. Was mit dem „War on Terror“ im Jahr 2001 in den USA begann, findet nun so manche bedenkliche Fortsetzung.
Vieles wurde in unseren Breiten verschlafen, manches wider besseren Wissens verabsäumt. Aber nicht alles war absehbar, vor allem nicht die Geschwindigkeit, mit der China den Rest der Welt industriell überrollen würde. Die Auslagerung von Produktion nach Asien hat im Zuge der Covid-Pandemie die massive Abhängigkeit Europas u. a. in der Pharmabranche offengelegt. Wenn 60 Prozent der weltweit verfügbaren Antibiotika in China erzeugt werden, dann sollte Risikostreuung kein Schlagwort mehr sein.