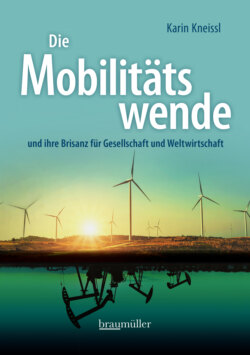Читать книгу Die Mobilitätswende - Karin Kneissl - Страница 17
Ausblick auf die Automobilindustrie und ihre Zulieferer
ОглавлениеDie Wirtschaftskrise, von der Pandemie losgetreten, wird uns einige Jahre beschäftigen. Der Ausgang dieser Krise mit den gesellschaftlichen Verwerfungen ist ungewiss. Millionen von Arbeitslosen werden kaum schicksalsergeben auf bessere Zeiten hoffen; die Rückkehr der sozialen Frage, die bereits in der arabischen Welt seit 2011 brodelt, kann auch in so manchem europäischen Wohlfahrtsstaat noch für Verwerfungen sorgen. Die Zukunft der Autoindustrie wird daher für den sozialen Frieden eine gewisse Rolle spielen, da sie ein wichtiger Arbeitgeber ist und bislang als Motor für die Forschung wirkte.
Die deutschen Autobauer und Zulieferer machten im Jahr 2019 weltweit einen Inlands- und Auslandsumsatz von 445 Milliarden Euro. Die Automobilindustrie steht für Millionen Arbeitsplätze in Europa. Österreich ist mit seinen Standorten in Oberösterreich und der Steiermark wesentlich als Zulieferer tätig, was wiederum 250.000 Arbeitsplätze schafft. Deutschlands drittgrößter Automobilzulieferer, ZF Friedrichshafen, beschäftigte bis Anfang 2020 konzernweit 148.000 Menschen. Infolge der Coronakrise wurde im Mai 2020 ein Personalabbau von bis zu 15.000 Menschen angekündigt. Die düsteren Prognosen des Jahres 2019 wurden infolge der globalen Rezession dann noch schlechter. Denn noch zu Jahresende 2019 hatte ZF versprochen, Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten, während die Konkurrenten Bosch und Continental und viele weitere spezialisierte Subunternehmer bereits 2019 einen radikalen Umbau angekündigt hatten. Die Ursachen für die schlechte Auftragslage sind bekanntermaßen in der sinkenden Automobilnachfrage und dem Wandel zur Elektromobilität zu finden.
Ursache für die wachsenden Problemen der Zulieferer sind aber die Autohersteller, denn sie machen die Vorgaben. Diese lauteten in der deutschen Autoindustrie: große Autos mit viel Hubraum, denn hier lässt sich die Marge verdienen.
These Eins und Schlussfolgerung:
Die bereits vor der Pandemie angeschlagene europäische Automobilindustrie wird ihre historische Vormachtstellung an China abtreten, das auf dem afrikanischen Kontinent produzieren lässt.
Ein Annus horribilis, also ein Ausnahmejahr an Problemen, ist 2020 angebrochen.
Die aktuelle Rezession, die laut Weltwährungsfonds mit jener von 1929 vergleichbar sei, wird die Autoindustrie schwer treffen und damit für viele Regierungen zum Testfall werden. Es verändert sich das Geschäftsmodell Autobranche von der Produktion, den erforderlichen Rohstoffen bis zum Autohändler grundlegend. Die Deindustrialisierung ist weit fortgeschritten; Arbeitsplätze in anderen Branchen zu finden, wird schwierig werden. Doch inmitten dieser Pandemie wird nun auch in Europa – wie zuvor schon in den USA – der Ruf immer lauter, Produktion und Lieferketten zu überdenken. Backshoring als Kontrastprogramm zum Offshoring, das mit dem Siegeszug der Globalisierung zur Auslagerung wesentlicher Industriebranchen in Billiglohnländer in Asien führte, ist das neue Credo.
Die Folgen für die Beschäftigten bzw. für die europäische Industrie in ihrer Gesamtheit können heftig ausfallen. Der Staat als Manager ist ein altes Thema, um das herum Revolutionen und Kriege stattgefunden haben. Wie wird es sich mit der Umsetzung des EU-Green-Deals und den Vorgaben zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor verhalten? Primat der Wirtschaft oder doch Primat des Staates, das sind alte Fragen, die wieder neu beantwortet werden wollen.
VW-Käfer aus dem Jahr 1966