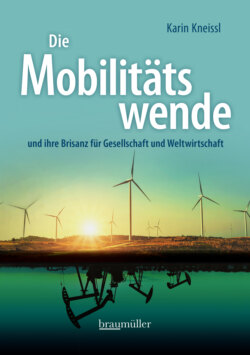Читать книгу Die Mobilitätswende - Karin Kneissl - Страница 16
Österreich und der Wandel vom Wegbereiter zum Zulieferer
ОглавлениеAuch in Österreich muss man die Museen besuchen, um eine Ahnung einstiger Größe zu erheischen. Das gilt nicht nur für die kaiserlichen Sammlungen von Juwelen und Kunstwerken, oft Geschenke der jeweiligen zeitgenössischen Potentaten, welche die Republik in den Bundesmuseen beherbergt. Besonders spürbar wird der Wandel der letzten 120 Jahre in den technischen Sammlungen. Fest eingegraben in meinen Erinnerungen aus Kindertagen der frühen 1970er-Jahre ist mein Staunen beim Betrachten des „Marcus-Wagens“ im Technischen Museum Wien. Dieses Gerät aus Holz und Eisen mit seinen Kutschenrädern wurde als das älteste Automobil der Welt vorgestellt. Siegfried Marcus (1831 bis 1898) war aus Mecklenburg nach Wien gekommen, wo er zunächst telegrafische Apparate entwickelte und sich dann dem Motorenbau immer mehr zuwandte. Sein irrtümlich auf 1877 datiertes Auto wurde später, jedenfalls nicht vor 1888 geschaffen. Marcus experimentierte zeitgleich wie andere Pioniere an einem Automobil mit Explosionsmotor. Mir sollte der „Marcus-Wagen“ nicht mehr aus dem Sinn gehen. Für Automuseen entwickelte ich jedenfalls ein Faible, denn die dort ausgestellten Exponate haben einfach Charakter und lassen träumen, v. a. ist es sympathisch, wenn man das eine oder andere Modell gar noch selbst erlebt hat.
Beim Besuch des weitläufigen Motorradmuseums in Vorchdorf in Oberösterreich zogen nicht nur die vielen exquisiten Exponate mein Interesse an; fast noch mehr faszinierten mich die Informationstafeln über hunderte Motorradfirmen, die in der Zwischenkriegszeit in Wien die Zweiradindustrie beflügelten. Welcher Erfindergeist und v. a. welche unternehmerische und technische Vielfalt hatten in dieser Branche einst bestanden? Bis in die 1990er-Jahre existierte mit den Steyr-Daimler-Puch-Werken ein Unternehmen, das zwar infolge staatlichen Missmanagements sehr herabgewirtschaftet war, aber als Marke aufgrund der Qualität seiner Produkte, der Vielfalt an Patenten und der Treue seiner Kunden in sich ein Wert war. Die Palette reichte von Pkw über Autobusse zu Lkw und geländegängigen Traktoren. Der von Porsche entwickelte Steyr XII galt als einer der besten Bergwagen; der Steyr 50 war der Vorläufer des deutschen Volkswagens. Die Motorräder von Puch, wie die legendäre Puch 250, waren besonders populär. Einer meiner ersten Beiträge für das Wirtschaftsressort der deutschen Tageszeitung „Die Welt“, für die ich damals als freie Korrespondentin zu arbeiten begonnen hatte, war die Auflösung der Steyr-Werke im Frühjahr 1999; eine Reihe von Ausgliederungen war bereits erfolgt. Der austrokanadische Unternehmer Frank Stronach hatte gleichsam ein Schnäppchen mit dem Erwerb einzelner Unternehmensanteile, von Immobilien und Lizenzen, gemacht. Die verbleibende Steyr-Daimler-Puch-Fahrzeugtechnik in Graz wurde mit der Firma Magna verschmolzen, die bis heute ein wichtiger Zulieferbetrieb für die deutsche Autoindustrie ist. Für mich war das Interview mit einem der letzten Manager im Steyr-Gebäude auf dem Schwarzenbergplatz in Wien vor dessen Abriss eine düstere, aber zugleich bezeichnende Erfahrung, wie in Österreich Geschäfte gemacht werden. Mangelnde Transparenz, unklare Anbote und in sich geschlossene Zirkel erlebte ich damals in Wien. Ingenieure, die für ihr Unternehmen lebten, mit Begeisterung forschten und an neuen Antrieben tüftelten, durfte ich noch in Steyr antreffen. Eine gewachsene Struktur, die einst die tüchtige Familie Werndl in Steyr im 19. Jahrhundert aufgebaut hatte, wurde zur Jahrtausendwende endgültig zerschlagen. Ich erlaube mir diesen Exkurs aus folgendem Grund:
Österreichs Industrie ist heute reduziert auf ihre Rolle als Zulieferer. Im weltweiten Globalisierungsindex, der die Einbindung einer Volkswirtschaft in die Weltwirtschaft misst, liegt Österreich von 185 Ländern auf Platz fünf. Dieser Spitzenplatz wurde stets als großer Vorteil dargestellt. Doch mit dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft infolge eines globalen Lockdowns und der großen Verwundbarkeit in der Position als Zulieferer wird eben diese Exponiertheit zum großen Handicap, denn im Gegensatz zu großen Ländern, wie Polen, Frankreich u. v. a. m., fehlt Österreich der Binnenmarkt.
Unternehmertum in Zeiten der Pandemie ist ein Hasardspiel, v. a. wenn man Mittelständler ist. Inmitten der Umbrüche und der Finanznot, der Sorge um Mitarbeiter sowie um die eigene Existenz ist es sehr schwer, neu zu denken sowie sich wieder etwas zu trauen. Was Europa einst auszeichnete, war der intensive Wettbewerb der besten Köpfe, der Querdenker und Freigeister. Diese Epoche scheint untergegangen, es dominiert die Monokultur. Diese ist ebenso anfällig für Infektionen, wie es die landwirtschaftliche Monokultur sein kann.