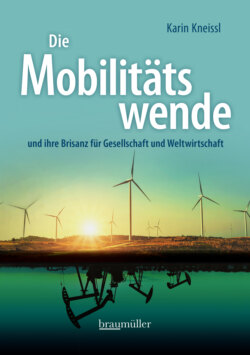Читать книгу Die Mobilitätswende - Karin Kneissl - Страница 15
Automobilproduktion auf dem afrikanischen Kontinent
ОглавлениеSeit einigen Jahren bediene ich gerne folgenden Vergleich, der mir während eines Arbeitsaufenthalts in Angola angesichts der massiven chinesischen Präsenz durch den Kopf ging: So wie auf dem iPhone steht „Designed in California, assembled in China“, könnte auf dem Auto der Zukunft die Inschrift lauten: „Designed in China, assembled in Africa“. Die neue Werkbank der Welt ist im vergangenen Jahrzehnt südlich der Sahara entstanden. Wesentlich hierfür waren und sind asiatische Investoren, wobei indische und arabische Händler traditionell im Osten und Süden des Kontinents seit Jahrhunderten verankert sind. Die umtriebigen chinesischen Investoren, die politisch schlau stets auf die Schicksalsgemeinschaft der einstigen von Kolonialmächten ausgebeuteten Entwicklungsländer pochten, waren bald überall auf dem Kontinent unterwegs. Sieben Tage die Woche, das gesamte Jahr über waren und sind chinesische Arbeiter und Angestellte unterwegs – ohne die Sonderprivilegien westlicher „Expats“, wie die von ihren Firmen mit wohldotierten Sonderverträgen entsandten Arbeitnehmer heißen. Aus Billigproduktion wurde Hightech und afrikanische Partner waren darin bald eingebunden. Nun lässt sich trefflich streiten, ob die afrikanischen Völker von einer Art chinesischer Kolonialisierung überrollt werden, oder ob China schon viel früher als alle anderen auf „Handel zwischen Partnern“ umgeschwenkt ist. Tatsache ist, dass die EU erst 2016 – und dies wieder einmal unter dem Titel Migration – begriff, wie geografisch nahe dieser Kontinent liegt. Seither wird die Liste der EU-Afrika-Foren unter dem Titel „Lasst uns Handel treiben“ immer dichter. Aus dem gönnerischen Ansatz der Entwicklungshilfe soll nun endlich mit unverzeihlicher Verspätung ein ebenbürtiges Miteinander im Sinne von Geschäftsinteressen werden. Ich hatte immer schon den Eindruck, dass wir Europäer, von einigen Ausnahmen abgesehen, viel zu spät und zu halbherzig umdenken. Zwar gibt es genug afrikanische Unternehmer und noch viel mehr besonders tüchtige Geschäftsfrauen, die einer chinesischen Zwangsumarmung gerne entkommen möchten und nach alternativen Kunden suchen. Doch für europäische Unternehmer stellt sich neben den vielen rechtlichen Auflagen die Hürde, überhaupt Geschäfte anzubahnen. Großkonzerne, die Briten, Franzosen oder auch Portugiesen mit Expertise und Geschäftskontakten anstellen, konnten bislang die größeren Aufträge v. a. afrikanischer Regierungen erhalten. Zudem haben sich türkische Unternehmen in den letzten 20 Jahren u. a. im Servicesektor klug etabliert. Traditionell erfolgreich war immer schon die libanesische Diaspora, deren Vertreter zu so manchem Vermögen, v. a. im frankophonen Westafrika, gelangten.
Dank chinesischer Investitionen haben sich viele Gesellschaften auf diesem Kontinent aus der extremen Armut hochgearbeitet. Hightech wird heute in Rwanda, dem nicht unumstrittenen Vorzeigeland, in Uganda und Tansania produziert. Ob es nun TV-Geräte oder Computer sind, das Auto der Zukunft wird nicht ein Benziner mit Bordcomputer sein. Vielmehr lautet der Anspruch der Chinesen wie auch der US-Amerikaner gleichermaßen, Autos in rollende Computer zu verwandeln. Ähnlich wie das Smartphone werden diese Geräte dann durch Aktualisierung der Software verbessert.
Dass der afrikanische Markt für Autobauer interessant sein muss, lässt sich mit folgenden drei Argumenten illustrieren:
a. Der afrikanische Markt ist am wenigsten erschlossen, hier werden Autos sowohl im städtischen Nahverkehr mangels öffentlichen Transports wie auch v. a. für das Land benötigt.
b. Die Bevölkerungspyramide spricht für eine wachsende Nachfrage von Autofahrern in den kommenden Jahrzehnten, während Europa und auch China vergreisen, nicht anders als Japan, wo mehr Windeln für die Altenpflege als für Babys produziert werden.
c. Die Rohstoffe für die zukünftigen Antriebstechniken finden sich eher im rohstoffreichen Afrika als im rohstoffarmen Europa, das einst mit dem technischen Vorsprung punkten konnte. Dieser Vorsprung ging jedenfalls in der Autoindustrie verloren.
Meines Erachtens ist noch unklar, ob das Elektroauto die entscheidende Antwort sein wird oder ob im Zuge eines notwendigen offenen Forschens doch noch andere Antriebe oder völlig neue Fortbewegungsformen kommerziell entwickelt werden. Für den Stadtverkehr und gewisse Mittelstrecken soll die E-Mobilität die Zukunft weisen, dann aber für viele Umweltbewusste doch eher als elektrisches Fahrrad. In so manchem Konzern und vor allem auf Ebene der Europäischen Kommission versteift man sich auf das Elektroauto, was wiederum von der chinesischen Nachfrage der letzten Jahrzehnte angetrieben wird. Die Europäer folgten auch hier den Chinesen und nicht umgekehrt.
Forschungskooperationen betreiben chinesische Firmen trotz politischer Autokratie um vieles offener, intensiver und jedenfalls konsequenter als dies selbst innerhalb der EU der Fall ist. Zudem kehren die Absolventen von internationalen Universitäten seit bald 15 Jahren wieder nach China heim und stehen nicht mehr – wie einst – jenen Forschungseinrichtungen zur Verfügung, wo sie ihren Abschluss gemacht haben. Es spricht grundsätzlich vieles für eine chinesische Technologieführerschaft, die mit den Möglichkeiten der afrikanischen Partner eine neue Lieferkette für zukünftigen Automobilbau ermöglicht. Das sogenannte Baukastensystem, wonach wesentliche Bestandteile für die Marken eines Konzerns gemeinsam produziert werden, wird bei zukünftigen Flotten von Elektroautos noch mehr zum Einsatz kommen. Allein die neuen Möglichkeiten des dreidimensionalen Druckens von Bestandteilen werden ihren Anteil am Aufbau von Lieferketten in Subsahara-Afrika haben. Volkswagen und Renault sind bereits seit Jahren in einigen afrikanischen Staaten vertreten. Ein chinesischer Mittelklassewagen oder Kompakt-Van könnte zu einem sehr wettbewerbsfähigen, i. e. niedrigen Preis in Rwanda oder anderswo in der Seenregion Ostafrikas gebaut und vertrieben werden. Die Betriebsstätten in Europa hätten dann das Nachsehen, dies würde Deutschland ebenso wie Frankreich und deren nach Ost- und Mitteleuropa ausgelagerte Zulieferer sehr hart treffen. Die letzte in Europa verbliebene Schlüsselindustrie wäre nach den Zäsuren der letzten Jahrzehnte definitiv Geschichte. Es blieben dann Automobilmuseen mit interaktiven Schauräumen, um sich vorzustellen, wie Autos einst in Turin, Stuttgart oder in Paris hergestellt wurden. Zudem wären mit einem Schlag Millionen Arbeitsplätze in Europa weg.
Neugieriges Staunen, manchmal auch eine Prise Arroganz oder Unverständnis, schlägt mir entgegen, wenn ich diese These durchargumentiere. Das erklärt sich wohl aus dem immer noch vorherrschenden mitleidigen Blick auf den sogenannten Süden. Die Lieferketten werden sich aus vielen weiteren Gründen auf dem afrikanischen Kontinent neu gestalten. Dazu gehören der Durst nach Veränderung junger Generationen wie auch die zunehmend verbesserten Arbeitsbedingungen in Staaten, wie Rwanda und Sierra Leone, wo zudem Menschen in Führungspositionen tätig sind, die Genozide, Kriegsmassaker und vieles mehr überlebt haben, die menschlich einfach beeindruckend sind. Nordamerikanische und europäische Firmen werden manches heimholen, um vermeintlich Arbeitsplätze zu sichern, doch Robotik und Digitalisierung werden kaum einen solchen Schub für den Arbeitsmarkt, egal ob für Fachkräfte oder Logistiker, zulassen. Besonders werden diese Transformationen in der Autowirtschaft die Zulieferer zu spüren bekommen.