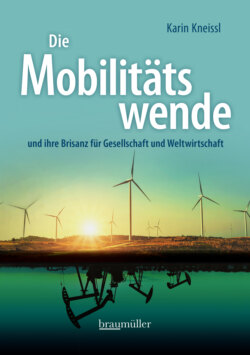Читать книгу Die Mobilitätswende - Karin Kneissl - Страница 11
Autopioniere setzen die Trends
ОглавлениеIn Europa waren es die Porsches, Daimlers, Peugeots, Citroëns oder Agnellis, um nur einige unter den prominenten Namen anzuführen, die all ihr Tun und Denken dem Automobil und damit den völlig neuen Möglichkeiten individueller Mobilität widmeten. Ohne eine Bertha Benz und ihre erste Fernfahrt im August 1888 wäre die Autonation Deutschland um einiges ärmer. Indem sie ihren Mann überraschte, absolvierte die bemerkenswerte Frau hinter der mobilen Revolution 180 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim und retour im Benz-Patent-Motorwagen. Ihre beiden Söhne halfen beim Schieben des Gefährts, wenn es bergauf ging. Sie improvisierte mit dem Strumpfband und der Hutnadel eine Reparatur. So gelang ungeplant die erste Probefahrt der Welt mit einem Automobil dank einer praktisch denkenden Frau. Bei ihrer Rückkehr soll sie ihrem Mann Carl, einem begnadeten Ingenieur, folgende Ratschläge gegeben haben: Ein dritter Gang und vor allem ein Rückwärtsgang wären unbedingt noch einzubauen.
Frauen, die sich hinters Steuer und damit neue Maßstäbe setzten, waren in Europa und in den USA gleichermaßen unterwegs. Und dennoch war die Frau am Steuer in den ersten Jahrzehnten eher die Ausnahme. Dass auch Mädchen den Führerschein machen, musste sich gesellschaftlich erst durchsetzen, ebenso wie Frauen als Taxilenkerinnen oder am Steuer eines Autobusses. Zuvor hatten Frauen durch Jahrhunderte ihre Mühe, das Recht zu erlangen, ein Pferd zu besteigen.
Bertha und Carl Benz
Die Meinung einiger Skeptiker zu Beginn, dass das Automobil keine Zukunft habe, weil es nicht ausreichend Chauffeure gebe, war bald widerlegt. Frauen mussten sich zwar vielerorts noch in ihrer Rolle als Autolenkerinnen durchsetzen, in Saudi-Arabien bekanntlich auch im Jahre 2020. Denn das wahhabitische Königreich war bislang de jure der einzige Staat weltweit, der Frauen das Autofahren bei Strafe untersagte. Die Wirtschaftskrise in der Petromonarchie sowie die Kosten für Fahrer zwangen aber auch hier zum Umdenken. Es sind immer öfter gut ausgebildete Frauen und nicht die Männer, die für den Broterwerb sorgen, sie müssen also zu ihrer Arbeitsstätte fahren. Der Mittelstand kann sich die Lohnkosten für den Chauffeur kaum mehr leisten. Auch wenn Frauen theoretisch nun selbst Auto fahren dürfen, ein Recht, wofür viele Aktivistinnen drakonisch bestraft wurden, so ist die männliche Vormundschaft für saudische Frauen weiterhin aufrecht. Das Recht auf Mobilität muss man sich auch im 21. Jahrhundert erkämpfen. Für die Frauen in Saudi-Arabien ist die Möglichkeit, ein Auto selbst lenken zu dürfen, jedenfalls eine Errungenschaft, deren Wert für jene nur schwer nachvollziehbar ist, für die das Auto in unserer Zeit zur Angriffsfläche schlechthin geworden ist. Dabei verkörperte das Auto gerade in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts symbolhaft den Anstieg der Lebensqualität.
Hinter diesem Aufbruch stand der Autopionier Henry Ford, dem es nach vielen Rückschlägen gelang, ein neues Konzept zu erstellen. Vorrangig waren der Herstellungsprozess und eine sichere Lieferkette. Anders als den europäischen Autopionieren ging es ihm nicht um das ganz besondere Modell, ob für die Rennstrecke oder den finanzkräftigen Käufer. Henry Ford baute in seinem Heimatstaat Michigan, in Detroit ein Autoimperium auf, das industrielle und gesellschaftspolitische Maßstäbe setzte. Während Autos in Europa in den ersten Jahrzehnten teure Luxusobjekte einiger weniger waren, verfolgte Henry Ford das Ziel, ein robustes und leistbares Auto für den alltäglichen Gebrauch zu erzeugen. Diese neue Mobilität sollte die Erfüllung des „American Dreams“ sein, den auch die Biographie des Autopioniers Ford widerspiegelt. Das Modell Ford T war das 1911 weltweit am meisten verkaufte Fahrzeug. 60 Prozent des Automarkts deckte eben dieses Modell ab.
Der pragmatische und damit auch völlig neue Zugang zum Automobil des Henry Ford lässt sich an folgenden zwei Zitaten gut ablesen: „Jeder Kunde kann sein Auto in einer beliebigen Farbe lackiert bekommen, solange die Farbe, die er will, schwarz ist.“ Die Ford-Modelle, die den „American Dream“ auf Jahre hinaus begleiten würden, waren aus dem einen Guss, den die Arbeiter auf den fahrenden Fließbändern von Detroit herstellten. Fords Credo blieb: „Ein vernünftiges Auto soll seinen Besitzer überallhin transportieren – außer auf den Jahrmarkt der Eitelkeiten.“ Auch wenn wir in der historischen Betrachtung Ford mit dem kapitalistischen Zeitalter unmittelbar verbinden, so entsprach Ford vielmehr dem verantwortungsvollen Unternehmer. Er erhöhte Löhne, organisierte eine ordentliche Lehre und Berufsschule – ein völliges Novum in jener Zeit – und sorgte für Standards in seinen Betrieben – das stand im Gegensatz zum Zeitgeist und der Weltanschauung vieler Geldgeber. Als jemand, der sich hart hochgearbeitet hatte, von der Mühsal täglicher Arbeit auf dem Acker bis zum Chefingenieur bei Thomas A. Edison, glaubte er fest an die Verbesserung menschlicher Lebensqualität durch die Mechanisierung und den damit verbundenen Fortschritt. Sein Ford-T-Modell war ein zuverlässiges Auto, dessen hohe Qualität das Verkaufsargument schlechthin war. Und dennoch verstand sich Ford zudem auf kluges Marketing, denn die Werbespots der Firma Ford von 1911 sollten in der kommerziellen Werbung Maßstäbe setzen. Detroit war Ford und Ford war Detroit. Es war eine ganz besondere Unternehmensgeschichte, die im Henry-Ford-Museum für den Besucher mit historischen Exponaten aufbereitet ist. Ähnlich wie in der einstigen Autostadt Turin wurde auch in Detroit ein ehemaliges Fabriksgelände für museale Zwecke umgewidmet.
Das erschwingliche Familienauto prägte im „Hydrocarbon Age“ des billigen Treibstoffs nach 1945 den Lebensstil, die Urbanisierung und damit die gesellschaftliche Entwicklung. Die USA standen für die permanente Automobilität. Das Lebensmodell „Suburbia“ trat seit den 1950er-Jahren einen Siegeszug um die Welt an. „Man“ zog in die Vorstädte, ins Haus mit Garten, pendelte zum Arbeitsplatz wie man bereit war, mit dem Auto und nicht mehr zu Fuß sämtliche Wege, ob zur Schule oder zum Einkaufen, zu machen. Je teurer der innerstädtische Wohnraum wurde, umso mehr wurde auch in vielen europäischen und anderen Städten der sogenannte „Speckgürtel“, die Peripherie jenseits der Außenringautobahnen, als relativ günstiger Wohnraum erschlossen. Diese Entwicklung stellte die Urbanisierung der letzten Jahrhunderte auf den Kopf. Lebte und arbeitete man einst in einem bestimmten Viertel, konnte man nun dank individueller Automobilisierung täglich weite Distanzen pendeln. Was einst US-Amerikaner in Kalifornien auf sich nahmen, wurde im Großraum Paris genauso en vogue. Und auch der aufstrebende Mittelstand in China oder Indien war offenbar bereit, im neuen Statussymbol, dem eigenen Geländeauto, dank Luftkühlung täglich mehrere Stunden im Stau zu verbringen. Der Coronapandemiestillstand des Frühjahrs 2020 ließ manche Autobahnen so leer erscheinen, wie meine Generation der 50 plus sie noch aus den Zeiten des Erdölschocks von 1973 in Erinnerung hatte. Damals vervierfachte sich der Preis binnen Wochenfrist, was die Menschen zwang, ihre Autos stehen zu lassen. Das Arbeits- und Wohnmodell „Suburbia“ ist mit den Zielen des Klimaschutzes schwer in Einklang zu bringen. Der Digitalisierungsschub und die Verpflichtung zum Homeoffice, infolge der Pandemie, könnten langfristige Spuren hinterlassen. Die Mobilitätswende hat viele Ursachen und eine davon wird eine veränderte Praxis des täglichen Pendelns sein, wo es möglich ist. Dass dies nicht nur mit der Verfügbarkeit von öffentlichem Verkehr, sondern auch mit verlässlichem Internet und Stromversorgung zu tun hat, wurde Anfang 2020 weltweit deutlich.
Doch zurück zu den Glanzzeiten der US-Automobilindustrie, die auch vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs und des Wettlaufs der Ideologien ihre Rolle hatte. Denn während es in der DDR oder in anderen Staaten des Ostblocks, bis zum Fall des Kommunismus 1989, ein nur schwer erfüllbarer Lebenstraum war, auf einen fahrbaren Untersatz wie einen Trabi hinzusparen, konnte sich in den USA wie auch in vielen Teilen Westeuropas bald jeder junge Mensch sein eigenes Auto leisten. Die Ente, der 2CV, wurde zum Auto der Hippiebewegung und revolutionsbegeisterter Altsemestriger, mit dem Käfer fuhren im deutschen Wirtschaftswunder Familien mit Kind und Kegel ans Meer. Jenseits des Eisernen Vorhangs war die automobile Fortbewegung ein Traum, den sich viele oft erst über Kredite in den 1990er-Jahren zu erfüllen begannen. Detroit aber wurde vor 70 Jahren zur Heimat der amerikanischen Autoindustrie, weil sie als „Motor City“ der gemeinsame Standort von Ford, General Motors und Chrysler war. Nicht umsonst nennt man die slowakische Hauptstadt Bratislava manchmal das Detroit von Mitteleuropa, denn auch hier entstand – ähnlich wie in Ungarn und Rumänien – ein Autocluster.
Es war aber der Aufstieg der japanischen Hersteller, v. a. von Toyota und Honda, der der US-Automobilindustrie schwer zu schaffen machte. Die Erdölkrise von 1973 versetzte der Automobilwirtschaft wie auch der Luftfahrt einen schweren Schlag. Im Oktober 1973 vervierfachte sich der Rohölpreis innerhalb von drei Wochen. Auslöser war ein Krieg im Nahen Osten, die Intervention der USA zugunsten Israels und ein Boykott der arabischen Förderländer der OPEC, der Organisation Erdöl exportierender Länder, gegenüber bestimmten, v. a. westlichen Staaten.
Der Preisanstieg führte zu einer Erschütterung der damaligen Weltwirtschaft, die noch längst keine globale war. Aber der schwere Preisschock, der auf eine bereits vom Zermürbungskrieg der USA in Vietnam erschöpfte Volkswirtschaft traf, führte in Nordamerika und gleichermaßen in Westeuropa zu großen Verwerfungen. Wer damals schon Autofahrer war oder die langen Gesichter der Eltern bei der Tankstelle in Erinnerung hat, der fürchtet seither hohe Erdölpreise mit ihren vielen Auswirkungen. Von Arbeitsloslosigkeit hörte ich damals zum ersten Mal, als mein Vater als Pilot seine Arbeit verlor. Die Wirtschaft und auch die Gesellschaften konnten sich von dieser Krise ein wenig erholen, bis die Erdölpreise dann Anfang 1979 infolge der Revolution im Iran, einem der wichtigsten Erdöllieferanten jener Ära, erneut in die Höhe schnellten. Mobilität, ob im Auto oder per Flieger, die Sommercharterflüge kamen gerade auf, wurde wieder ein Luxus. Das würde sich rund 30 Jahre später infolge der Intervalle mit niedrigem Erdölpreis, dem Aufkommen der Billigfluglinien sowie der sogenannten „Shared Economy“ im Beherbergungsbetrieb, wie „Airbnb“, und Reservierungsplattformen für eine gewisse Dauer wieder ändern.