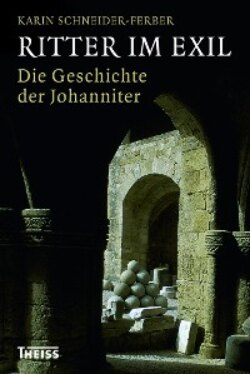Читать книгу Ritter im Exil - Karin Schneider-Ferber - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Triumphe und Desaster: Die militärische Bedeutung der Johanniter in Palästina
ОглавлениеUnübersehbar beherrscht die syrische Kreuzfahrerburg Crac des Chevaliers, die auf einem 755 Meter hohen Bergrücken über dem Akkar-Tal thront, das gesamte Umland. Wer von der Küstenregion über die sogenannte Homs-Pforte, einen mäßig ansteigenden Pass, ins Landesinnere reiste, kam an ihr und ihrer Besatzung nicht vorbei. Mit ihren doppelten Mauern und massiven Wehrtürmen, den raffinierten Wehrgängen, dem Wassergraben, der gleichzeitig als Zisterne diente, und dem schräg aufgeschütteten Glacis vor der Oberburg bildete sie einen ausgeklügelten, nahezu uneinnehmbaren Festungsbau, der bis heute eine imposante Erscheinung geblieben ist und den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes genießt. „Was der Parthenon für die griechischen Tempel und Chartres für die gotischen Kathedralen ist, das ist der Crac des Chevaliers für die mittelalterliche Burg: das alles überragende Beispiel einer der größten Bauten aller Zeiten“, urteilte der Burgenkenner Thomas S. R. Boase.9 Und in der Tat: Die Kreuzfahrerburg besticht durch ihre baulichen Raffinessen, die normannische, byzantinische und lokale Bautraditionen vereinte. Ein beeindruckender 130 Meter langer Eingangstunnel mit Kehrtwendungen und einer 180-Grad-Haarnadelkurve, dessen sanft ansteigende Treppenstufen selbst Pferden den Einritt ermöglichten, führte vom Außenbezirk zur Oberburg. Die stattlichen Vorratsgebäude und Stallungen, aber auch der repräsentative, mit einem Kreuzrippengewölbe gedeckte „Große Saal“ erinnern daran, dass hier eine Besatzung von rund 2000 Personen Aufnahme finden konnte.
Die stolzen Herren dieser Festung waren bis 1271, als der Mameluckensultan Baibars sie einnahm, die Ritter des JohanniterordenS. 1142 hatten sie die Burg vom Grafen Raimund II. von Tripolis übertragen bekommen und dann Zug um Zug in drei Bauphasen zwischen 1150 und 1250 zu einem Bollwerk gegen die muslimischen Gegner ausgebaut. Nichts zeigt die Umwandlung der ehemaligen Spitalbruderschaft in einen Ritterorden besser als der Aus- und Umbau dieser Burg. Der Crac des Chevaliers beherrschte das Umland, schützte die Städte und Dörfer des Küstengebiets vor Überfällen und bildete gleichzeitig ein Symbol der Macht für die Ordensritter.
Aus ihrer militärischen Bedeutung für das Heilige Land bezogen die Johanniter ihr Selbstbewusstsein. Denn der Crac des Chevaliers war nicht die einzige Festung, die sie besaßen. Weitere mächtige Burgen wie Belvoir im Jordantal, das zeitweise als Hauptsitz dienende Margat oder auch das zwischen Küste und Jerusalem gelegene Belmont standen unter ihrer Aufsicht. Diese Trutzburgen bestachen durch ihre Größe und außergewöhnliche Architektur. Die auf quadratischem Grundriss errichtete Burg Belvoir lag auf der Naphtali-Hochebene rund 550 Meter über dem Jordantal mit freiem Blick auf den See Genezareth. Nicht umsonst bedeutete der Name „schöne Aussicht“. Aber nicht des schönen Blicks wegen ließen sich die Johanniter hier 1168 nieder. Sondern wegen der strategischen Bedeutung der Grenzfestung, die zuvor im Besitz einer fränkischen Adelsfamilie gewesen war. Die Ordensritter bauten sie zu einer außergewöhnlichen Anlage mit zwei quadratischen, ineinandergesetzten Verteidigungsringen aus. Die Türme des Außenkastells erhoben sich bis zu 25 Meter über das Grabenniveau; die starken Außenmauern erreichten eine Dicke von drei Metern. Das äußere Kastell selbst wurde von einer umlaufenden, spitztonnengewölbten Halle von sechs bis sieben Metern Breite gebildet, deren Außenmauern Schießscharten und Ecktürme trugen. Im Inneren der gewaltigen Anlage gab es nicht nur großzügige Lager-, Versammlungs- und Wohnräume, sondern auch Rittersäle und eine Kapelle sowie eine Küche mit drei Backöfen, zwei Zisternen und eine Wäscherei. Das Bollwerk aus dunklem Basaltgestein hielt lange dem Ansturm der muslimischen Truppen stand. Erst 1189 wurde die Burg dem erfolgreichen Sultan Saladin übergeben.
Die Ritter des Johanniterordens zählten neben ihren „Kollegen“ vom Templer- und Deutschen Orden bald zum militärischen Rückgrat der christlichen Kreuzfahrerstaaten. Nicht nur ihrer Burgen wegen, die sich wie Glieder einer Kette den Küstenstreifen entlangzogen und zusammen mit einer Reihe von kleineren Forts eine Art „Sicherheitssystem“ bildeten, sondern auch wegen ihrer geschätzten kämpfenden Brüder. Denn anders als die in regelmäßigen Abständen eintreffenden bunt zusammengewürfelten Kreuzfahrerheere aus Europa stellten sie die einzigen dauerhaft im Heiligen Land stehenden Truppeneinheiten dar. Überdies waren sie mit den klimatischen und geografischen Verhältnissen der Region vertraut und kannten die Taktik der muslimischen Feinde am besten. Ihr Wissen und ihre Erfahrung, aber auch ihre eiserne Disziplin hoben sie von den häufig untereinander zerstrittenen und von unklaren Hierarchien gehemmten Kreuzfahrerheeren wohltuend ab. Die Ordensritter leisteten bei ihrem Eintritt in die Gemeinschaft ihrem Großmeister einen Gehorsamseid, der sich unter anderem auch auf den militärischen Bereich auswirkte und ein eigenmächtiges Vorpreschen auf dem Schlachtfeld verhinderte. Harte Strafen trafen jene Ordensritter, die sich nicht an die Signale ihrer Bannerführer hielten oder aus der Kampfformation ausbrachen. Überdies konnten sie personellen wie materiellen Nachschub gut über ihre Niederlassungen in Westeuropa organisieren, sodass sie das Potenzial der „alten Heimat“ wesentlich besser nutzen konnten als jede andere Macht im Heiligen Land. Nach verlustreichen Schlachten füllten sie ihre Reihen schneller wieder auf, während es oft Jahre oder Jahrzehnte dauerte, bis ein neuer Kreuzzug ausgerufen und finanziert war.
Im Zuge der Militarisierung schälte sich seit Ende des 12. Jahrhunderts eine veränderte Ordensstruktur der Johanniter heraus. Der karitative Dienst trat hinter den militärischen Erfordernissen zurück. Das größte Prestige lag nun bei den Ritterbrüdern, die schwer bewaffnet und zu Pferd in den Kampf zogen. Sie stammten aus dem Adel und standen an der Spitze der Ordenshierarchie, da sie auch die wichtigsten Führungsämter innerhalb des Ordens besetzten. An zweiter Stelle folgten die Priesterbrüder, die als geweihte Kleriker die geistliche Versorgung der Gemeinschaft übernahmen und meist ebenfalls aus dem Adel stammten. Sie übernahmen in der Regel nur geistliche Ämter wie das des später hoch angesehenen Konventspriors. Im Rang deutlich untergeordnet waren die Servienten, die dienenden Brüder, die nicht aus dem Adel stammten, sondern bei Eintritt in den Orden nur eheliche Geburt und tadellosen Lebenswandel nachweisen mussten. Die dienenden Brüder nahmen vielfältige Aufgaben war. Es gab unter ihnen solche, die kämpften, aber auch andere, die vorwiegend praktische Tätigkeiten im Hospitaldienst und in der Güterverwaltung ausführten. Sofern sie kämpften, trugen die Servienten leichtere Bewaffnung als ihre Gefährten aus dem Adelsstand, sie besaßen auch weniger Pferde als diese, waren aber wie die Voll-Ritter dem Marschall unterstellt. Obwohl die dienenden Brüder nur wenige und untergeordnete Ämter im Orden bekleideten, bildeten sie doch eine tragende Säule im Ordensgefüge. Sowohl im militärischen Bereich als auch im Spitaldienst wäre ihr Beitrag nicht wegzudenken gewesen.
Neben den Vollmitgliedern des Ordens, die alle die Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegten, gab es eine ganze Reihe von Personengruppen, die dem Orden nur zeitweise oder lose verbunden waren und auch keine ewigen Gelübde ablegten. Dazu zählten die „Ritter auf Zeit“, die sich nur für ein Jahr zum Dienst an der Waffe verpflichteten und dies als Akt der Buße ansahen, oder auch die sogenannten „Confratres“ oder „Donaten“, Laienbrüder und -schwestern, die den Orden vor allem finanziell unterstützten, aber auch gelegentlich im Ordenshaus mitlebten, in jedem Fall aber in die Gebetsgemeinschaft des Ordens aufgenommen wurden und seinen geistlichen Schutz genossen. Dazu bereicherte eine Vielzahl an Hilfskräften – Knechte, Diener, Ärzte, Söldner, Knappen, Schiffsleute – die Ordensgemeinschaft. Wie bei anderen Orden üblich, bildete sich auch bei den Johannitern ein weiblicher Zweig aus, der allerdings auf kontemplative Aufgaben beschränkt blieb. Die Johanniterschwestern lebten in strenger Klausur und betätigten sich von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht in der Kranken- und Armenpflege.
Die hohe Kompetenz der Johanniter in militärischen Fragen bescherte ihnen zwar großes Ansehen im Heiligen Land wie in Europa, was sich an steigenden Spenden- und Landzuweisungen bemerkbar machte, doch gleichzeitig mussten sie einen immensen Blutzoll für ihre Einsatzbereitschaft bezahlen. Da sie teilweise bis zu 60 Prozent der christlichen Heere in der Levante stellten, waren ihre Verluste an Menschenleben entsprechend hoch. Die aus Europa eintreffenden Kreuzfahrerheere unterstützten die Orden zwar in vielfältiger Weise. Diese stellten indes nicht nur mit ihren eigenen Ritterbrüdern einen Großteil der Kerntruppen der Heere, sondern verstärkten sie mit auf eigene Kosten angeworbenen Fußsoldaten und Berittenen, einheimischen Bogenschützen, den Turkopolen, sowie den Kontingenten, die sie aus ihren Grundherrschaften rekrutierten. Dazu sicherten sie den Vormarsch von ihren Burgen aus, stellten Belagerungsmaschinen zur Verfügung und unterstützten die „Landoperationen“ mit ordenseigenen Schiffen von der Seeseite her.
In der Schlacht von Hattin 1187 gegen Sultan Saladin rekrutierten Johanniter und Templer fast ihren gesamten Truppenbestand, zusammen etwa 600 Ritter. Die fränkische Armee, die insgesamt etwa 1200 Ritter umfasste, wurde in dieser verlustreichen Schlacht fast vollständig aufgerieben. Wer nicht im Kampf starb, der wurde anschließend von Saladin hingerichtet, denn die Angehörigen der Ritterorden galten ihm als besonders kampftüchtig und sollten daher nicht am Leben bleiben. „Auf Befehl des Sultans (…) wurden die gefangenen Templer und Hospitaliter gesammelt, um getötet zu werden“, berichtet der Chronist Ibn al-Atir.10 „Er ließ sie besonders umbringen, weil sie die tüchtigsten Krieger unter den Franken waren; so schaffte er der Bevölkerung Erleichterung von ihnen.“ In der Schlacht von La Forbie bei Gaza 1244 erlitten die drei Ritterorden gegen die aus dem Osten einfallenden Chwarismier wiederum herbe Verluste. Insgesamt 1000 kämpfende Brüder kamen bei dem blutigen Kampf ums Leben, darunter 328 Johanniter. Da zudem Tausende von Fußsoldaten und Bogenschützen auf dem leichenübersäten Schlachtfeld blieben, war die Kampfkraft des Königreichs Jerusalem deutlich geschwächt.
Der Rückzug aus dem Heiligen Land vollzog sich schleichend, aber unaufhaltsam. Bereits nach dem Fall Jerusalems (1187) mussten die Johanniter und die Templer ihre Hauptquartiere nach Akkon verlegen. Mehr noch als der kurdischstämmige Saladin aus der Dynastie der Ayyubiden machte den Ordensrittern der Mameluckensultan Baibars zu schaffen, der 1260 in Ägypten die Macht ergriff und Zug um Zug die christlichen Kreuzfahrerstaaten in Bedrängnis brachte.
Die Mamelucken, die als Militärsklaven aus der südrussischen Steppenlandschaft nach Ägypten gekommen waren, erwiesen sich als äußerst kampfgeübte Zeitgenossen. Baibars, von Geburt her vermutlich Kiptschak-Türke und im Alter von 14 Jahren in die Sklaverei verkauft, fiel vor allem durch seine kompromisslose Härte gegenüber seinen Feinden auf. Dazu trieben ihn jedoch nicht allein seine rohe Veranlagung, sondern vor allem strategische Erwägungen. Denn der Einfall der Mongolen in die Levante im Jahr 1260 bedeutete für die ganze Region eine tödliche Gefahr. Nur mit äußerster Mühe war es den Mamelucken gelungen, in der Schlacht von Ain Dschalud in der Nähe von Nazareth den Sturm aus der Steppe abzuwehren. Doch trotz des teuer erkauften Sieges fürchtete Baibars, dass sich die christlichen Vorposten in Palästina und Syrien mit den Mongolen verbünden könnten. Da die Kreuzritterheere seit den Verlusten von La Forbie deutlich geschwächt waren, zeigte sich Baibars wild entschlossen, sie endgültig von der Landkarte zu beseitigen. Ein Feldzug nach dem anderen folgte: Caesarea, Arsuf, die Festung Safad, Ramla, Jaffa, die mächtige Hafenstadt Antiochia erlagen der Reihe nach seinem Ansturm. Dabei wandte der Mameluckensultan eine Strategie der „verbrannten Erde“ an. Obstbäume und Getreidefelder wurden niedergebrannt, Städte komplett zerstört, die Zivilbevölkerung wurde massakriert oder in die Sklaverei verkauft. Bei der Eroberung Antiochias sollen bis zu 17.000 Menschen ermordet worden sein, Zehntausende gerieten in die Sklaverei.
Baibars ließ an seiner Entschlossenheit, die fremden Herren aus dem Land zu treiben, keinen Zweifel, als er im Februar 1271 begann, die Festung Crac des Chevaliers zu belagern, die als uneinnehmbar galt – wenngleich sie nur noch schwach besetzt war. Mit einem riesigen Heer und zahlreichen Wurfmaschinen lagerte er vor ihren Toren und ließ die äußeren Befestigungsmauern einen Monat lang sturmreif schießen. Nachdem ein kleiner Teil der südlichen Außenmauer eingebrochen war, verlegte er sich angesichts der Stärke der Hauptburg jedoch auf eine List. Er ließ den ausharrenden Johannitern einen gefälschten Brief ihres Ordensmeisters zukommen, der sie zur Kapitulation aufforderte. Angesichts ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit boten die verbliebenen Ritter am 8. April 1271 die Übergabe der Burg gegen die Garantie des freien Abzugs an. Der Crac des Chevaliers war verloren.
Baibars stoppte nur der Tod, der ihn 1277 in Damaskus ereilte. Doch seine Nachfolger setzten die Eroberungspolitik fort. 1285 fiel das gut befestigte Margat, 1287 Latakia, 1289 Tripolis. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann die letzte Bastion Akkon fiel. Diese Aufgabe vollendete al-Aschraf Khalil mit mameluckischer Gründlichkeit: Nachdem er im Winter rund 100 Wurfmaschinen aus dem ganzen Land mithilfe von Ochsenkarren vor Akkon hatte bringen und dort zusammenbauen lassen, begann er am 5. April 1291 die Belagerung der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt. Die großen Katapulte mit den sprechenden Namen „der Siegreiche“ oder „der Wütende“ warfen zentnerschwere Geschosse auf die Stadtmauern; Pfeile und kleinere Steinkugeln prasselten wie nie enden wollende Hagelschauer auf die Verteidiger herab. Die Mamelucken „arbeiteten“ mit großer Disziplin. Sie kämpften in vier Schichten Tag und Nacht. Die Verteidiger hatten schon zu diesem Zeitpunkt keine Chance mehr. Ein Ausfall unter dem Großmeister der Templer scheiterte, der Beschuss der Belagerungsarmee durch ein Schiffskatapult erwies sich als wirkungslos. So blieb den verschreckten Bewohnern nichts anderes übrig, als den Generalangriff der immer näher heranrückenden Gegner zu erwarten. Schließlich unterminierten sie die Stadtmauern und erzwangen sich durch eine Bresche beim Königsturm den Zugang zur inneren Mauerlinie. Am 18. Mai leitete das Schlagen der Kampftrommeln den letzten Akt in Akkons Untergang ein. Die Krieger des Sultans drangen durch zwei Stadttore ins Innere der Metropole. Die einst blühende Stadt versank in einem Blutbad.