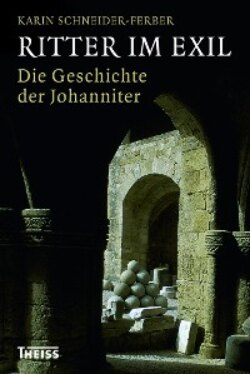Читать книгу Ritter im Exil - Karin Schneider-Ferber - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Katastrophe: Die Niederlage von Akkon
ОглавлениеDie Apokalypse fand an einem Freitag statt. Schon vor Morgengrauen kündete sie sich vernehmbar durch das Schlagen von Kriegstrommeln an. „Und als der Freitag kam, noch vor Tagesanbruch, ertönte sehr laut eine große Pauke, und beim Ton dieser Pauke, die eine schreckliche und gewaltige Stimme hatte, griffen die Sarazenen die Stadt Akkon von allen Seiten an“, berichtet ein anonymer Augenzeuge, den man „Templer von Tyrus“ nennt, über den Schicksalstag der christlichen Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land, den 18. Mai 1291.1 Welle um Welle rückten die Männer des Mameluckensultans al-Aschraf Khalil auf die Stadtmauer der Stadt Akkon in Galiläa vor. Zuerst die Schildträger, dahinter die Soldaten, die griechisches Feuer verschossen, zuletzt Speerträger und Bogenschützen, die ihre Wurfgeschosse so dicht abschossen, „dass es wie ein Regen war, der vom Himmel kam“.
Die bereits seit sechs Wochen belagerte und durch riesige Katapulte und Wurfmaschinen sturmreif geschossene Festungsstadt, die nur von etwa 800 bis 1000 christlichen Rittern und 14.000 Fußkämpfern verteidigt wurde, hielt dem Ansturm der weit überlegenen muslimischen Kräfte nicht stand. Die Mamelucken überwanden den äußeren Mauerring, erzwangen sich durch zwei Tore des inneren Rings in der Nähe des „Turmes der Verdammnis“ den Zugang in die Stadt und ergossen sich ins Stadtzentrum. „Das Werfen des Feuers und das Schießen der Pfeile hörten nicht auf, und der Kampf von Mann gegen Mann dauerte bis zur dritten Stunde“, berichtet der anonyme Kriegsteilnehmer über den weiteren Fortgang des Geschehens. Für die Verteidiger der Stadt, zu denen neben kleineren militärischen Kontingenten aus Europa und des Königreichs Jerusalem und Zypern als kampferprobte Elite die Ritter des Templer- und des Johanniterordens sowie des Deutschen Ordens zählten, gab es nichts mehr zu wenden. Der Großmeister der Tempelritter, Guillaume de Beaujeu, wurde im Kampfgetümmel von einem Speer tödlich verletzt, Jean de Villiers (reg. 1285–1293), der Großmeister der Johanniter, musste mit einem Lanzenstich zwischen den Schulterblättern von den Mauern getragen werden.
Panikartig flohen die Bewohner Akkons zum Hafen, um auf einem der begehrten Schiffe dem Chaos zu entfliehen. Doch die wenigsten konnten sich retten, darunter König Heinrich II. von Jerusalem und Zypern, Otto von Grandson, der Befehlshaber eines englischen Kontingents, und der schwer verwundete Jean de Villiers, die in letzter Minute über den Seeweg entkamen. Die meisten Bewohner wurden in den engen Gassen der Altstadt von den wütenden Eindringlingen getötet. Der muslimische Chronist und Augenzeuge Abu’l-Fida berichtet über den Schrecken, den die Stadt an diesem Tag durchlebte: „Als die Muslime eindrangen, floh ein Teil der Bevölkerung auf den Schiffen, während viele andere sich in einigen stark befestigten Türmen der Stadt verschanzten. Die Muslime richteten in Akkon ein ungeheures Blutbad an und machten unermessliche Beute.“2 Ein Konvent der Dominikaner ging mit dem Hymnus „Veni Creator Spiritus“ auf den Lippen in den Tod. Angehörige des Franziskaner- und des Klarissenordens wurden niedergemetzelt, Frauen und Kinder gerieten in Gefangenschaft, um als Sklaven verkauft zu werden. Nur die befestigten Türme der Ritterorden boten noch einigen Schutz. Vor allem der wehrhafte Turm der Templer war baulich dazu angetan, sich noch einige Tage als letzte Bastion des Widerstandes zu halten.
Angesichts der zahlenmäßigen Überlegenheit der Sultansarmee konnte jedoch nichts darüber hinwegtäuschen, dass der 18. Mai 1291 das Ende Akkons und damit der christlichen Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land insgesamt markierte. Denn mit dem Fall Akkons, des einzigen bedeutenden festen Stützpunkts, der den europäischen Kreuzfahrern noch geblieben war, ging die (Rück-)Eroberungspolitik der aus Ägypten vorstoßenden Mameluckensultane ihrem endgültigen Sieg entgegen. Die Kreuzfahrer aus Übersee mussten sich aus Palästina und Syrien zurückziehen und das Land den neuen Machthabern überlassen.
Der letzte blutige Akt im Drama von Akkon spielte sich zehn Tage später, am 28. Mai, in der Festung der Templer ab. Sultan Khalil hatte seinen Soldaten den Befehl gegeben, die Mauern des Turmes zu untergraben. Verhandlungen mit dem Ziel einer friedlichen Übergabe war am Ende kein Erfolg beschieden. Die Templer öffneten zwar nach der Zusicherung freien Abzugs die Tore, doch leisteten sich die hereinströmenden muslimischen Kämpfer gewalttätige Übergriffe auf schutzsuchende Frauen, weshalb die Tempelritter die Tore wieder verschlossen und ihre Gegner niedermachten. Unter dem Druck der Angreifer brach der Turm kurz darauf zusammen, wie der anonyme Gewährsmann der Templer überliefert: „Die Sarazenen drangen mit so viel Menschen in den Turm ein, dass die Stützen, die ihn hielten, nachgaben. Das Gemäuer fiel, und diejenigen Tempelbrüder und Sarazenen, die drin waren, kamen um.“3 Der Rest der Besatzung wurde von den Leuten des Sultans enthauptet. Auch die Johanniter mussten sich in ihrem Turm ergeben und wurden trotz der Zusicherung freien Abzugs allesamt umgebracht.
Muslimische Chronisten hielten erstaunt fest, dass sich fast 100 Jahre nachdem der englische König Richard Löwenherz auf dem Dritten Kreuzzug sein Versprechen an der muslimischen Besatzung Akkons gebrochen hatte, die Geschichte nun unter umgekehrten Vorzeichen wiederholte. „Es ist wunderbar zu sehen, dass Gott der Erhabene Akkon am gleichen Tag und in der gleichen Stunde zurückerobern ließ, in der es auch die Franken genommen hatten“, berichtet der ägyptische Chronist Abu’l-Mahasin im 15. Jahrhundert. „Sie nahmen Akkon Freitag, den 17. Gumada II., um die dritte Stunde des Tages in Besitz und sicherten den Muslimen in der Stadt ihr Leben zu, dann brachten sie sie verräterisch um. Nun schenkte Gott den Muslimen ihrerseits, Freitag, den 17. Gumada II., um die dritte Stunde die Stadt zurückzuerobern; der Sultan gewährte den Franken Sicherheit und ließ sie dann umbringen, wie es die Franken mit den Muslimen getan hatten; so rächte sich Gott der Erhabene an ihren Nachkommen.“4 Nach der Katastrophe von Akkon fielen die letzten Außenposten christlicher Herrschaft in Tyrus, Sidon, Beirut, Atlik und Jubail kampflos und innerhalb von vier Wochen wie Kartenhäuser in sich zusammen. Nur die auf der Insel Ruad vor Tortosa ausharrenden Templer hielten ihren Vorposten noch bis 1303.
Für die unterlegenen Ritter war es – sofern sie überhaupt überlebt hatten – ein Abschied aus dem Heiligen Land ohne Wiederkehr. Sie sahen einem unsicheren Exil entgegen. Denn die Ära der christlichen Kreuzfahrerstaaten, die rund 200 Jahre zuvor mit der Eroberung Jerusalems 1099 begonnen hatte, war mit dem Fall Akkons endgültig beendet. Die Sehnsucht nach Jerusalem hörte zwar in Europa auch nach 1291 nicht auf, doch alle Pläne zur Rückeroberung des Heiligen Landes scheiterten an den realen Machtverhältnissen im Vorderen Orient. Die Kreuzzugsidee verlagerte sich an andere Schauplätze und richtete sich gegen andere Gegner. Vor allem die türkischen Osmanen, die ab dem 14. Jahrhundert sowohl auf dem Mittelmeer als auch auf dem Balkan in Richtung Westen vorstießen, schälten sich als neue Hauptgegner für das christliche Europa heraus.
Für jene, die zuvor ihr Lebenselixier aus der Präsenz im Heiligen Land gezogen hatten – die großen Ritterorden der Templer, der Johanniter und des Deutschen Ordens –, bedeutete die Vertreibung aus ihren „Stammplätzen“ eine tragische Zäsur. Angetreten, die Pilger aus dem Abendland zu schützen und zu versorgen und die christlichen Herrschaftsgebiete in Palästina und Syrien gegen den Ansturm der Muslime zu verteidigen, stürzten sie nun in eine ernsthafte „Sinnkrise“. Die Phase der Heimatlosigkeit erzwang eine Neuorientierung in geografischer wie ideeller Hinsicht. Das ebenso ungewollte wie dauerhafte Exil überstanden die Johanniter dabei am besten. Während die Templer dem Machthunger des französischen Königs Philipp IV., des Schönen, erlagen, der den Orden zwischen 1307 und 1312 gewaltsam zerschlug, um das Ordensvermögen an sich zu bringen, und sich die Deutschordensritter fernab ihres Herkunftsgebietes in Preußen und Livland ein eigenes Herrschaftsterritorium schufen, bewahrten die Johanniter in der Verbindung von Hospitaldienst und Türkenabwehr ihren ursprünglichen Auftrag am reinsten. Vor allem ihr karitatives Engagement um Arme und Kranke sicherte ihnen die nachhaltige Anerkennung ihrer Glaubensgenossen. Bis heute zehren der (evangelische) Johanniter- und der (katholische) Malteserorden als „Erben“ des mittelalterlichen Ritterordens von diesem sozialen Prestige.
Allerdings war diese Entwicklung nach ihrer Vertreibung aus dem Heiligen Land keineswegs absehbar. Für die vertriebenen Johanniter bedeutete der 18. Mai 1291 wie für die Angehörigen der anderen Ritterorden auch einen dramatischen Schicksalstag, der sie in eine ungewisse Zukunft führte. Zunächst wurde die Insel Zypern ihr Rückzugsgebiet. Angst und Verzweiflung sprechen aus dem Brief, den der schwer verletzte Großmeister Jean de Villiers von seinem Krankenlager aus in diesen Tagen an seinen Mitbruder und Prior von St-Gilles, Guillaume de Villaret, schrieb: „Ich und ein paar unserer Brüder, die meisten verwundet und unheilbar verletzt, entkamen nach dem Willen Gottes, und wir wurden auf die Insel Zypern gebracht. Am Tag, da dieser Brief verfasst wird, sind wir noch immer hier, zutiefst betrübt, gefangen in gewaltigem Schmerz.“5 Der Schmerz sollte so schnell nicht nachlassen. Die nahe Küstenlinie des Heiligen Landes vor Augen, schien die Wiedergewinnung des „verlorenen Paradieses“ zwar in greifbarer Nähe, doch die Realität sah anders aus.