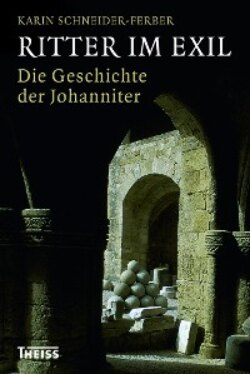Читать книгу Ritter im Exil - Karin Schneider-Ferber - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wellenreiter: Galeeren und Segelschiffe
ОглавлениеFür den Aufbau ihrer Flotte griffen die Johanniter auf die im Seekrieg bewährten Schiffsformen ihrer Zeit zurück. Die geruderte Galeere, die sich aus der byzantinischen Dromone entwickelt hatte, stand im Mittelalter als wichtigstes Kriegsschiff zur Verfügung. Geringer Tiefgang, hohe Manövrierfähigkeit und Schnelligkeit zeichneten diesen Schiffstyp aus, der bis weit ins 18. Jahrhundert hinein Verwendung fand. An jeder Seite der über 40 Meter langen und nur etwa fünf bis sechs Meter breiten Schiffe befanden sich 20 bis 25 Ruderbänke, an denen drei oder mehr Ruderer saßen, die dem Schiff einen von Flauten und Windstärke unabhängigen Antrieb gaben. Der „Eigenantrieb“ war der große Vorteil der Galeere gegenüber den Segelschiffen, die stets auf günstige Windverhältnisse warten mussten. Um die Mannschaften außerhalb der Kampfhandlungen zu schonen, besaßen die Galeeren zusätzlich zwei Masten für Segel, mit denen sich bei günstigem Wind wegen der leichten Schiffsbauweise hohe Geschwindigkeiten von bis zu elf Knoten erzielen ließen. War die Rudermannschaft ein eingespieltes Team, konnte sie taktische Manöver ausführen, die den plumpen Segelschiffen verwehrt blieben: abrupte Kurs- und Geschwindigkeitsänderungen, Wendungen oder Rückwärtsfahrten. Auch das Vordringen in seichtere Küstengebiete oder das überraschende Vorpreschen aus Buchten war mit diesen leichten Schiffen möglich.
Als waffentechnische „Spezialität“ besaß die Galeere einen über der Wasserlinie liegenden Rammsporn, dessen Länge sich nach der Anzahl der Ruderbänke richtete und im Falle einer 25-Bank-Galeere sechs Meter betrug. Der mit einer Metallspitze verstärkte Rammbock diente jedoch weniger dem Rammen und Versenken des feindlichen Schiffes als vielmehr dessen Enterung. Kurz vor dem finalen Zusammenstoß der feindlichen Schiffe versuchte die Besatzung der Galeere beizudrehen und durch den aufprallenden Rammbock Ruder oder Schiffswand des gegnerischen Bootes bis zur Manövrierunfähigkeit zu beschädigen. Ziel der Seeoperationen war in der Regel nämlich die Einnahme der kostbaren Schiffe, die man in den eigenen Bestand überführte, nicht ihre totale Zerstörung.
Zu diesem Zweck führten die Galeeren auch Waffen an Bord, die im Landkampf benutzt wurden. Steinschleudern, Armbrüste, Feuertöpfe mit griechischem Feuer, später auch Kanonen dienten dazu, das gegnerische Schiff erst „sturmreif“ zu schießen, bevor es mit Enterhaken herangezogen und im Kampf Mann gegen Mann schließlich eingenommen wurde. Dies erklärt auch, warum die als militärisches Rückgrat in die Schiffsmannschaften integrierten Johanniterritter sich relativ schnell an den Kampf zur See gewöhnten. Sie agierten nicht viel anders als zu Lande. Geschützt durch Rüstung und Helm fochten sie mit ihren traditionellen Waffen Schwert, Streitaxt und Dolch, ganz wie sie es vom Landkampf her gewohnt waren. Eine „See-Schlacht“ war nichts anderes als eine „Schlacht zur See“, wenn auch auf schwankendem Untergrund. Abgesehen von der allgemeinen waffentechnischen Entwicklung vom 13. bis zum 18. Jahrhundert blieben strategische Führung der Galeere und damit auch der Zweck der persönlichen Bewaffnung relativ gleich und unterschieden sich kaum vom Landkampf. Noch im 18. Jahrhundert sah man die Ordensbrüder mit Brustpanzer und Schwert in der Hand auf ihren Schiffen stehen in Erwartung des Kampfes Mann gegen Mann.
Die Galeere fand viele Abwandlungen. Es gab kleinere und größere Exemplare, Modelle mit mehr Lastkapazitäten oder Mischformen mit Segelschiffen. So war die Galeote ein etwas kleinerer Typus, der vorwiegend für Handelsfahrten eingesetzt wurde, wegen seiner Wendigkeit aber auch als Piraten- und Korsarenschiff gute Dienste leistete. Die mit einer kompakteren Bauart aufwartende Taride eignete sich besonders gut zum Transport von Lebensmitteln, Getreide und Pferden, ließ sich aber im Handumdrehen für den Kriegsdienst umrüsten. Zu Aufklärungs- und Erkundungsdiensten griff man gerne auf die Fregata zurück, die nur etwa zehn Meter lang und zwei Meter breit war und zwischen zwölf und 20 Mann Besatzung benötigte. Wegen ihrer geringen Ausmaße nahm man sie auf Segelschiffen gerne als Beiboot mit. Die in den zeitgenössischen Quellen genannten Bezeichnungen für diverse Ruderschiffe lassen sich häufig keinem klar definierten Bautyp zuordnen. Die Schiffsbauer zeigten sich experimentierfreudig und passten ihre Modelle den Bedürfnissen ihrer Auftraggeber an. Was sich unter den Begriffen Vacketta, Barbotte oder Sandanus verbarg, bleibt daher ihr Geheimnis.
Als die wahren Herren der Meere erwiesen sich in Zukunft jedoch die Segelschiffe, die im 13. und 14. Jahrhundert zunächst vor allem wegen ihrer hohen Lastkapazitäten geschätzt waren. Die schwer und hochbordig gebauten Schiffe mit ihren gerundeten Hecks, die ihnen den allgemeinen Namen „Rundschiffe“ gaben, boten in ihrem Inneren viel Raum für Waren, Pferde und Personen. Auf ihren größten Exemplaren fanden bis zu 1000 Menschen Platz, die über Wochen versorgt werden konnten. Ihr Längen-Breiten-Verhältnis von 2:1 machte die Vertreter der Gattung „Rundschiffe“ eigentlich zu plumpen „Pötten“ (zum Vergleich: Das Längen-Breiten-Verhältnis einer Galeere betrug fast 8:1), die nur mithilfe von Segeln vorwärtszubewegen waren. Doch trotz dieses Nachteils eigneten sie sich auch für den Seekampf. Denn an Bug und Heck ließen sich geschützte Kampfplattformen aufbauen, die wegen ihrer zinnenartigen Brustwehren aussahen wie kleine Kastelle und daher Vorder- und Achterkastelle genannt wurden. Die erhöhte Position gab der Besatzung einen taktischen Vorteil im Kampf gegenüber weiter unten stehenden Gegnern, genauso wie es auch bei Burgen und Wehrtürmen der Fall war. Von den hochgelegenen Mastkörben herab verschoss die Mannschaft zudem Pfeile, Armbrustbolzen und Steine. Da die schwer zu manövrierenden Rundschiffe kaum taktische Finessen zuließen, ähnelten die Gefechte auch hier vorwiegend dem Landkampf. Die Ritter kämpften mit ihren gewohnten Waffen Mann gegen Mann und versuchten, die Kontrolle über das gegnerische Schiff zu gewinnen.
In dem Maße, in dem ab dem 14. Jahrhundert die ersten Handfeuerwaffen und Kanonen in Seegefechten eingesetzt wurden, befanden sich die Segelschiffe im Vorteil gegenüber den Galeeren. Denn auf ihren verschiedenen Decks, den Vorder- und Achterkastellen und selbst auf den Mastkörben ließen sich viele verschiedene Geschütze installieren. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gingen die Schiffsbauer dazu über, Schießluken an den Bordwänden der Längsseiten herauszuschneiden, was die Anzahl der Kanonen wesentlich erhöhte. Durch die Tieferlegung des Gewichtsschwerpunktes war es nun auch möglich, schwerere Kaliber einzusetzen.
Wenn eine solch waffenstarrende Festung zur See eine volle Breitseite auf eine nahende Galeere abfeuerte, war es um diese schlecht bestellt. Die Galeere konnte wegen des begrenzten Raumangebotes nur wenige Geschütze, die sich zudem am Bug konzentrierten, mitführen und nur aus einer nahe der Wasserlinie liegenden Position schießen. Auch die leichtere Bauart der Galeere, ihr geringer Tiefgang und ihr leicht zu beschädigender Ruderapparat machten sie verwundbar. Meist genügten schon wenige Treffer, um sie außer Gefecht zu setzen. Daher zielten ihre Kapitäne darauf ab, eine offene Konfrontation mit den großen Seglern bei günstigen Wind- und Wetterbedingungen möglichst zu vermeiden. Die Überlegenheit der Galeere erwies sich in ihrem schnellen Rückzug, im Abwarten von Windstillen und im Überraschungsangriff.
Allzu lange konnte die Galeere ohnehin nicht auf offener See bleiben. Die körperlich anstrengende Tätigkeit des Ruderns, zu der neben frei angeworbenen Seeleuten auch Kriegsgefangene und später Sträflinge herangezogen wurden, ließ die Mannschaften rasch ermüden und trieb den Wasserverbrauch insbesondere an warmen Tagen in die Höhe. Ein Ruderer verbrauchte pro Arbeitsstunde ungefähr einen Liter Wasser. Für eine volle Galeerenbesatzung waren mindestens 500 Wasserfässer mit insgesamt 25.000 Liter Wasser zu laden, die selbst bei sparsamstem Verbrauch nur wenige Tage reichten. Da der im Schiffsrumpf gelagerte Wasservorrat meist knapp berechnet war, musste immer wieder die nächste Küste angesteuert werden.
Zum ganzen Stolz der Johanniter-Flotte zählten daher die immer größer werdenden Segelschiffe. Die im 15./16. Jahrhundert als Weiterentwicklung der Rundschiffe gebauten Karacken gehörten zu den eindrucksvollsten „Wellenreitern“ der Frühen Neuzeit. Die Dreimaster von durchschnittlich etwa 35 Metern Länge besaßen extrem hohe und in mehrere Decks gegliederte Bug- und Heckkastelle, die nicht nur als Kampfplattformen dienten, sondern auch als generöse Unterkünfte für die Besatzung. Die große Karacke „Sant’Anna“, die 1523 in Nizza mit einer außergewöhnlichen Länge von 45 Metern für den Orden vom Stapel lief, war – wenn man den Vergleich wagen darf – die frühe Form eines „Luxusliners“. Der schwimmende Riese besaß acht Decks, wovon zwei unter der Wasserlinie lagen, und überragte mit seinem Achterdeck den Großmast einer Galeere noch um zwei Meter. Es gab eine eigene Bäckerei an Bord, die täglich frisches Brot lieferte, sowie eine Schiffsschmiede, in der drei Schmiede arbeiteten. Eine reich geschmückte, der heiligen Anna geweihte Kapelle stand den Ordensrittern ebenso zur Verfügung wie ein Kapitelsaal, ein geräumiger Speisesaal und annehmliche Kammern zum Schlafen. Mit ihrem großen Frachtvolumen war die „Sant’Anna“ in der Lage, sich sechs Monate lang auf See selbst zu versorgen. Für ihren Schutz sorgten 50 schwere Kanonen und eine Vielzahl an leichteren Geschützen. Erst als der Orden in finanzielle Schwierigkeiten geriet und die jährlichen Kosten von 7000 Dukaten nicht mehr aufbringen konnte, wurde das stolze Schiff 1540 abgewrackt.
Der Kostenfaktor war es denn auch, der den Bau von Großschiffen im Format der „Sant’Anna“ eher schleppend vor sich gehen ließ. Der Orden besaß immer nur einige wenige Exemplare von ihnen. Sie waren Kriegsschiffe und Prestigeobjekte gleichzeitig. Wesentlich preiswerter und schneller ließen sich die Galeeren bauen, die daher lange ihren Wert in der Seekriegsführung behielten. Die weitgehend standardisierte Bauweise der Galeeren senkte den Herstellungspreis und garantierte darüber hinaus schnelle Reparaturen.
Von Großschiffen dieser Art konnte Foulques de Villaret vorerst nur träumen. Der aus der Provence stammende Großmeister erkannte aber klar, was dem Orden auf Zypern für jedes weitere erfolgreiche militärische Engagement am meisten fehlte: politische Selbstständigkeit. Der König von Zypern war sorgsam darauf bedacht, die Ritterorden in seinem Herrschaftsgebiet nicht zu mächtig werden zu lassen. Als 1306 ein hässlicher Thronstreit zwischen Heinrich II. von Zypern und seinem Bruder Amalrich ausbrach, der Templer und Johanniter als Verbündete zweier unterschiedlicher Lager in den Machtkampf miteinbezog, zeigte sich einmal mehr, wie schädlich sich politisch unsichere Verhältnisse auf das Schicksal der Ritterorden auswirkten. Während der phasenweisen Regentschaft Amalrichs, der Unterstützung durch die Templer erhielt, verloren die Johanniter ihre wichtige Burg Kolossi an den konkurrierenden Orden. Bis 1310 residierten auf Kolossi, zu dessen Komturei etwa 60 Dörfer gehörten, Tempelritter.
Villaret hielt daher Ausschau nach einem eigenen kleinen Reich für seinen Orden, in dem er nach Belieben schalten und walten und Entscheidungen ganz nach militärischen Notwendigkeiten treffen konnte. Der Großmeister suchte und fand für sein Vorhaben einen Verbündeten in Papst Clemens V., der zwar auf Druck des französischen Königs bereit war, den Templerorden aufzulösen, aber gleichzeitig versuchte, dem machthungrigen Monarchen Grenzen zu setzen und ein Gegengewicht zu ihm aufzubauen. Es war ihm daher ein Anliegen, den Johanniterorden zu schützen. Wohin aber sollte sich der Orden wenden, wenn er Zypern nicht als seine dauerhafte Heimat betrachtete? Wenn Villaret sein Auge über die Weiten der Ägäis schweifen ließ, geriet ein kleines, aber besonders günstig gelegenes Eiland sofort in seinen Blickwinkel: Rhodos.
Die Insel, die Pilgern und Kaufleuten aus dem lateinischen Westen schon seit Langem als Zwischenstation auf ihrem Weg nach Jerusalem diente, bestach vor allem durch ihre verkehrsgünstige Lage. Nur etwa 16 Kilometer von der kleinasiatischen Küste entfernt und Zentrum einer ganzen Inselgruppe, des Dodekanes, kontrollierte Rhodos die Handels- und Seewege zwischen Schwarzem Meer und Ägypten sowie die Passage zum Festland. Darüber hinaus besaßen die Inseln des Dodekanes eine Reihe von Rohstoffen wie Marmor, Schwefel, Wein, Oliven, diverse Getreidesorten und Früchte, mit denen sich Handel treiben ließ – von der Stellung der Hauptinsel als Zwischenhandelsplatz ganz abgesehen. Ein angenehmes Klima mit leichten Westwinden trug zu einem zufriedenen Aufenthalt bei. Außerdem war die Bevölkerung seit der Antike in der Seefahrt erfahren und zimmerte aus dem im Landesinneren vorhandenen Pinienholz vorzügliche Schiffe. Die Stadt Rhodos besaß seit der Antike zwei künstliche Häfen, die in byzantinischer Zeit ausgebaut wurden, dazu Werften, Arsenale sowie eine starke Festung. „Die Stadt der Rhodier liegt auf der Ostspitze der Insel. Mit ihren Häfen, Straßen, Umwallungen und anderen Gebäuden übertrifft sie jede andere Stadt bei Weitem. Ich kenne keine, die ihr gleich, geschweige denn überlegen ist“, schwärmte schon der griechische Geograf Strabon im 1. Jahrhundert v. Chr.6
Mit diesen Pfunden ließ sich wuchern. Es gab nur eine winzige störende Nebensächlichkeit, die man zur Kenntnis nehmen musste: Rhodos war nicht „herrenlos“, die Insel gehörte in den Machtbereich des byzantinischen Kaisers. Doch Foulques de Villaret war entschlossen, auch dieser Herausforderung zu begegnen. Mit militärischem Geschick, Diplomatie und ein wenig Glück entriss er innerhalb weniger Jahre Rhodos der Herrschaft der Byzantiner und begründete auf der Insel seinen eigenen Ordensstaat. Die „Ritter im Exil“ hatten damit für die nächsten 213 Jahre eine neue Bleibe gefunden.