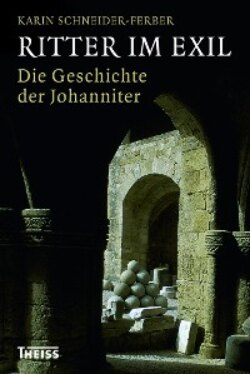Читать книгу Ritter im Exil - Karin Schneider-Ferber - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwischenstation Zypern
Оглавление„Mit diesen Eroberungen waren alle Plätze an der Küste wieder in den Besitz des Islam zurückgekehrt“, freute sich der muslimische Chronist Abu’l-Fida nach dem Fall Akkons, „ein Ergebnis, das niemand auch nur zu hoffen und zu wünschen gewagt hatte: ganz Syrien und die Küstengebiete waren gereinigt von den Franken, nachdem sie beinahe schon Ägypten erobert und sich Damaskus und anderer Städte in Syrien bemächtigt hatten. Lob sei Gott!“11 Doch wohin sollten sich die Vertriebenen wenden? Es blieb nur der Weg über das Mittelmeer, um irgendwo in Sicherheit zu kommen. Die nahe gelegene Insel Zypern, deren König Heinrich II. aus dem Hause Lusignan gleichzeitig den Titel eines Königs von Jerusalem führte und in Akkon mitgekämpft hatte, bot sich als Unterschlupf an. Die Johanniter selbst besaßen einigen Grundbesitz um die Burg Kolossi und in den Städten Nicosia und Limassol. So lag es nahe, das Ordenshaus in Limassol zum Hauptquartier zu machen und dort auch ein neues Hospital zu planen, um den karitativen Dienst wieder aufnehmen zu können.
Man mag sich nicht ausmalen, in welchem Zustand die Brüder auf der Insel ankamen. Verletzt und deprimiert kämpften sie ums blanke Überleben, denn die Versorgungslage auf der Insel nahm sich direkt nach der Katastrophe von Akkon prekär aus. Die Einfuhren aus dem Westen reichten kaum aus, um die plötzlich eintreffenden Flüchtlingsscharen zu versorgen. Dazu kam die starke Stellung des zypriotischen Königs, der den beiden Ritterorden selbstverständlich keine privilegierte Machtstellung in seinem Herrschaftsbereich einräumen wollte. Die Johanniter wie auch die Templer mussten sich unter die Politik des Königs beugen, durften nicht uneingeschränkt Land erwerben oder Abgaben erheben. Selbst ihre zahlenmäßige Anwesenheit wurde schon kurz nach ihrer Ankunft reglementiert. Nur 70 Ritterbrüder und zehn gewappnete dienende Ritter durften sich ab 1301 in der Niederlassung der Johanniter auf Zypern aufhalten.
Vor allem war es aber der gewaltige Prestigeverlust im Abendland, der den Ritterorden seit ihrem Rückzug aus dem Heiligen Land zusetzte. Militärisch hatten sie offensichtlich versagt. Die Niederlagen im Kampf gegen die Mamelucken lastete man, da man über die genauen Machtverhältnisse im Vorderen Orient nur wenig wusste, einseitig ihnen an. Dazu kam angesichts des umfangreichen Ordensbesitzes im Westen eine ausgeprägte Neiddebatte. Wenn alle sprudelnden Einnahmequellen bei der Verteidigung des Heiligen Landes nichts genützt hatten – wozu brauchte man dann überhaupt noch einen Ritterorden? Vorwürfe von Habgier, Verschwendungssucht und Veruntreuung wurden laut. Selbst in den höchsten Reihen der Kirche, unter den Päpsten Nikolaus IV. und Clemens V., dachte man ernsthaft über eine Zusammenlegung der Ritterorden nach, um deren Schlagkraft zu erhöhen. Der Templergroßmeister Jacques de Molay und der Johannitergroßmeister Foulques de Villaret (reg. 1305–1317/19) wandten sich 1306 in ihren Stellungnahmen allerdings gegen ein solches Ansinnen.
Leidenschaftlich diskutierte die Öffentlichkeit die Möglichkeit eines weiteren Kreuzzuges zur Rückgewinnung des Heiligen Landes. Der spanische Theologe und Philosoph Ramon Llull, der französische Rechtsgelehrte Pierre Dubois, König Heinrich II. von Zypern, aber auch die Großmeister der Ritterorden und noch viele andere mehr legten dazu ihre Pläne vor, doch blieben sie alle Pergamentträume. Nur eines war den Denkspielen gemeinsam: Ein neuer Kreuzzug konnte nur über eine Seeoperation eingeleitet werden, da alle Landstützpunkte in Palästina inzwischen verloren waren. Nicht umsonst hatte Papst Nikolaus IV. den Johannitern bereits 1292 den Aufbau einer Ordensflotte empfohlen, die man im Kampf gegen muslimische Gegner verwenden konnte. Auch Karl II. von Neapel rechnete in seinem Kreuzzugsplan mit zehn auf Zypern stationierten Johanniterschiffen, die er zu verwenden gedachte. Damit war zumindest eine Entwicklungslinie absehbar: Die Zukunft der Ritterorden lag auf dem Wasser. Nur wenn der Sprung zur Seemacht gelang, bestand die Aussicht, den Kampf gegen die alten Feinde wieder aufzunehmen und die angeschlagene Reputation im Abendland wiederherzustellen.
Das Schicksal traf die Tempelritter am härtesten. Da ihr Orden ganz auf die militärische Komponente ausgerichtet war, litten sie am meisten unter dem Verlust ihrer ursprünglichen Aufgabe. Dazu kamen ungeheuerliche Vorwürfe von Götzendienst, Ablehnung der Sakramente, Verleugnung Christi und Sodomie, die den französischen König Philipp IV., den Schönen, 1307 veranlassten, handstreichartig alle Templer in seinem Machtbereich zu verhaften und den Ordensbesitz zu beschlagnahmen. Den französischen König trieben zu dieser beispiellosen Nacht- und-Nebel-Aktion freilich nicht allein Sorgen um den inneren Zustand des Ritterordens. Als mindestens genauso ausschlaggebend erwiesen sich seine Nöte um die leeren königlichen Kassen und seine Furcht vor Machtstrukturen, die nicht seiner eigenen Verfügungsgewalt unterstanden. Der in Gang gesetzte Häresieprozess, bei dem unter der Folter erzwungene „Geständnisse“ die Vorwürfe zu bestätigen schienen, endete schließlich für die Templer nach jahrelangem Hin und Her in der Katastrophe: Papst Clemens V. hob den Orden 1312, ohne das Urteil eines Konzils abzuwarten, auf dem Verwaltungsweg auf. Die letzten Tempelritter, darunter der Großmeister Jacques de Molay, endeten auf dem Scheiterhaufen.
Zu den Profiteuren der unappetitlichen Affäre zählten ausgerechnet die Johanniter. Denn der Papst übertrug dem Johanniterorden den Templerbesitz, um ihn nicht gänzlich in die Hände der Könige und Fürsten fallen zu lassen. Es war vor allem die karitative Ausrichtung, die dem Orden einen Rest an Reputation bewahrte und ihn vor rigider Verfolgung schützte. Schon in der Diskussion um die Vereinigung der Ritterorden hatte sich abgezeichnet, dass dies nur unter Führung der Johanniter geschehen konnte, die weniger Glaubwürdigkeit eingebüßt hatten als die Templer. Auch wenn sich die Übernahme des über ganz Europa verteilten Templerbesitzes für die Johanniter als mühsames und mit vielen Prozessen beschwertes Geschäft erwies, konnten sie insgesamt doch sehr zufrieden sein. Es gelang ihnen, ihren Besitz zumindest zu verdoppeln, wenn nicht gar zu verdreifachen. Allein in Frankreich übernahmen sie 68 Niederlassungen der Templer. Dieser unvorhergesehene Vermögenszuwachs ermöglichte es dem Orden, sich zu reorganisieren und neu aufzustellen. Ein Hoffnungsschimmer an einem insgesamt recht eingetrübten Horizont.