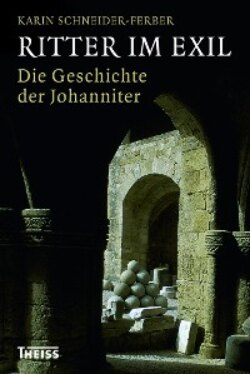Читать книгу Ritter im Exil - Karin Schneider-Ferber - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Volle Segel voraus: Die Bedeutung der Seefahrt zur Zeit der Kreuzzüge
ОглавлениеSchon während des Ersten Kreuzzuges trat offen zutage, wie stark die Kreuzfahrerheere von der Unterstützung zur Seeseite abhängig waren. Die langwierige Belagerung Antiochias 1097 wäre kläglich gescheitert, wenn nicht ein genuesisches Geschwader aus 13 Schiffen Mannschaften und Waffen in den Hafen St. Symeon am Orontes eingeschleust hätte, die den Bau eines Winterlagers für die schwer in Bedrängnis geratenen christlichen Belagerer ermöglichten. Im darauffolgenden Frühjahr brachte eine englische Flotte zusätzliches Material zur Herstellung dringend benötigter Belagerungsmaschinen. Nur der Hilfe von außen war es zu verdanken, dass Antiochia schließlich in die Hände der Kreuzfahrer fiel.
Die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt war aber Voraussetzung für den weiteren Vormarsch auf Jerusalem, das eigentliche Ziel des Kreuzzuges. Obwohl Jerusalem weiter im Landesinneren lag, zeigte sich auch in diesem Fall, dass der Nachschub zur See der entscheidende Faktor bei der Eroberung der Heiligen Stadt (1099) war. Denn auch ihre festen Mauern ließen sich nur mithilfe schwerer Belagerungsgeräte brechen. Zum Glück für die Kreuzfahrer trafen am 17. Juni 1099 vier englische und zwei genuesische Schiffe im Hafen von Jaffa ein, die neben Lebensmitteln auch Holz, Nägel, Seile und Bolzen zum Bau von Belagerungstürmen und Katapulten an Bord hatten. In einem kargen Gebiet, in dem Wasser und Holz Mangelware waren, entschied dieser Transport über den Erfolg der ganzen militärischen Operation. Jerusalem fiel – und die fränkischen Eroberer konnten sich dauerhaft im Heiligen Land festsetzen.
Angesichts dieser Erfahrungen wundert es nicht, dass der englische König Richard I. Löwenherz 1191 mit einer stattlichen Armada von 219 Schiffen zum Dritten Kreuzzug aufbrach. Er hatte 39 Kriegsgaleeren, 24 große Transportschiffe für je 40 Ritter mit ihren Pferden sowie 156 kleinere Schiffe für Proviant und Kriegsmaterial rekrutiert und damit eine der bislang größten Flotten seiner Zeit gesammelt, um Saladins Siegeszug im Heiligen Land zu stoppen. Es war ein grandioses Schauspiel, als die in acht Geschwader aufgeteilte, in Keilformation mit drei Schiffen an der Spitze segelnde Flotte am 10. April 1191 von Messina aus in See stach. König Richard befand sich an Bord der „Esnecche“ in der Nachhut.
Alle zeitgenössischen Chronisten zeigten sich voller Bewunderung über die geballte Flottenmacht, die da im Anmarsch war. „Seine Ankunft machte großen Eindruck“, schrieb zum Beispiel der Saladin-Biograf Baha’ad-Din über den Tag, an dem der König vor Akkon auftauchte. „Er landete mit 25 Galeeren, die mit Mannen, Waffen und Gerät voll beladen waren. Die Franken bekundeten laut ihre Freude und entzündeten in der Nacht große Feuer in ihrem Lager. (…) Seine Ankunft erregte Furcht und Schrecken in den Herzen der Muslime.“1
In der Tat gelang es der eindrucksvollen Schiffsmacht, ein muslimisches Geschwader zu schlagen und den Hafen von Akkon so wirkungsvoll abzuriegeln, dass die bedeutende Handelsstadt schließlich kapitulierte. Unterstützt von seiner Streitmacht zur See eroberte Richard anschließend weite Küstengebiete Palästinas, darunter den Hafen von Jaffa. Einmal mehr zeigte sich, dass die Dominanz auf dem Meer die Voraussetzung für den Erfolg der Landoperationen war.
Doch nicht nur militärische Aktionen waren auf die Unterstützung zur See angewiesen. Auch das wirtschaftliche Überleben der Kreuzfahrerstaaten hing davon ab, in welchem Maße es gelang, die Seewege im östlichen Mittelmeer zu kontrollieren und die wichtigsten Häfen an der Levanteküste zu beherrschen, über die jede Art von Handel mit Nahrungsmitteln, Gebrauchs- und Luxusgütern lief. Neben Akkon zählten Tyrus, Antiochia, Tortosa, Tripolis, Beirut, Sidon, Jaffa, Haifa, Caesarea oder Askalon zu den für den Fern- und Binnenhandel wichtigsten Hafenstädten. Auf der Suche nach Profit und hohen Renditen steuerten Schiffe der italienischen Seestädte Venedig und Genua regelmäßig die levantinischen Küstenstädte an, wobei Kreta, Rhodos und Zypern als Zwischenstationen an Bedeutung gewannen. Während man aus dem Orient wertvolle Gewürze, Rohrzucker, Baumwolle und Seidenwaren bezog, brachten die italienischen Händler in umgekehrter Richtung dringend benötigte Massengüter wie Holz, Eisen, Teer, Felle, Tuche, Getreide und Baumaterial in den Osten.
Die Kreuzfahrerstaaten besaßen aber nicht nur als Absatzmarkt und Umschlagplatz Bedeutung für den Handel, sondern produzierten auch selbst für den Export in entfernte Regionen, zum Beispiel Seifen, Rohseide oder wertvolle Brokatstoffe. Das Handelsaufkommen stieg während der Kreuzzugszeit daher kräftig an. Umso mehr waren die italienischen Seestädte bereit, auch die militärischen Aktionen der Kreuzfahrer zu unterstützen, die darauf abzielten, die Hafenstädte an der levantinischen Küste zu erobern und unter ihre Kontrolle zu bringen. Selbstverständlich gab es auch diese Hilfe vonseiten der Seerepubliken nicht umsonst – sie sicherten sich dafür weitreichende Handelsprivilegien, Zollfreiheit, Steuereinnahmen und Marktrechte in den „Wirtschaftsmetropolen“ des Heiligen Landes. Dabei kam es schon im ausgehenden 11. Jahrhundert zu handfesten Rivalitäten zwischen Venedig, Genua und Pisa.
Legten wieder einmal Gefechte auf hoher See oder Hafensperrungen unter den missgünstigen Konkurrenten die Schifffahrtswege lahm, konnte dies fatale Folgen für das Heilige Land haben. Das Ausbleiben der wichtigen Versorgungsflotten führte zu wirtschaftlichen Engpässen in den Kreuzfahrerstaaten, ganz zu schweigen von der damit verbundenen Schwächung der Verteidigungskraft der christlichen Herrschaften. Mit welch harten Bandagen die aufstrebenden „Wirtschaftsmächte“ um Privilegien und Handelsvorteile kämpften, zeigte sich 1256 in Akkon. Aus einem Besitzstreit um einige Häuser, die dem Kloster St. Sabas gehörten, entwickelte sich ein regelrechter Krieg zwischen den in zwei unterschiedlichen Stadtvierteln lebenden Venezianern und Genuesen, in dessen Verlauf Teile Akkons sowie die Genueser Flotte in Flammen aufgingen.
Die steigende Bedeutung der Seefahrt für das Überleben der Kreuzfahrerstaaten konnte von keinem Herrschaftsträger im Heiligen Land übersehen werden. In dem Maße, in dem die Ritterorden militärische Aufgaben übernahmen und Burgen, Handelswege und das Hinterland schützen mussten, standen auch sie vor der Frage, wie die Verbindung nach Westeuropa zu halten war. Nicht nur die eigenen Ritter pendelten eifrig übers Mittelmeer zwischen alter und neuer Heimat hin und her. Aus ihren über ganz Europa verstreuten Niederlassungen, den Kommenden oder Komtureien, bezogen die Orden zudem wichtige wirtschaftliche und personelle Ressourcen. Jedes Tochterhaus war verpflichtet, einen bestimmten Anteil der erwirtschafteten Güter, die sogenannten Responsionen, ins Heilige Land abzuführen, um den Kampf gegen die Muslime zu unterstützen. Die Abgabe umfasste ein Drittel oder ein Viertel der Überschüsse, in Notzeiten konnte sie sogar bis zur Hälfte der Einnahmen ausmachen. Pferde und Waffen, Gebrauchsgüter und landwirtschaftliche Produkte mussten daher tonnenweise ihren Weg übers Meer finden, was einer logistischen Herausforderung gleichkam. Gecharterte Schiffe waren jedoch teuer, denn die geschäftstüchtigen italienischen Schiffseigner wussten ihren Preis zu nehmen. So lag der Gedanke nahe, eigene Schiffe anzuschaffen.
Seit Mitte des 12. Jahrhunderts mehren sich Hinweise auf ordenseigene Schiffe. 1165 erwähnen päpstliche Dokumente eine Johanniter-Galeere, die Papst Alexander III. von Montpellier nach Messina brachte und dabei auch ein kleines Scharmützel mit Pisaner Galeeren zu bestehen hatte. 1246 nennt der Orden ein Schiff namens „Comtesse“ sein Eigen, das bereits so fortschrittlich gebaut war, dass es König Ludwig IX. von Frankreich als Modell zum Nachbau eigener Schiffe diente, mit denen er sein Kreuzfahrerheer nach Ägypten transportieren wollte. 1278 brachte der Orden auf der „Bonaventura“ eine Enkelin König Johanns von Jerusalem von Brindisi nach Akkon.
Da von größeren Seegefechten zu diesem Zeitpunkt nichts überliefert ist, ist davon auszugehen, dass die damaligen Ordensschiffe überwiegend hochbordige „Rundschiffe“ waren, die man in ihrer speziellen Ausformung auch Navis, Nao oder Nef nannte. Diese stolzen Segelschiffe wiesen mit über 30 Metern Länge und bis zu 14 Metern Breite eine bis zu 76 Tonnen reichende Ladekapazität auf und eigneten sich daher aufs Beste für den Warenund Personentransport. Auf zwei bis drei Decks konnten mehr als 500 Menschen, zuweilen auch über 1000, unterkommen, während Verpflegung und Handelswaren Platz im geräumigen Schiffsbauch fanden.
Um die teuren Überseefahrten von Europa ins Heilige Land zu finanzieren, besannen sich die Johanniter bald auch wieder ihrer „Kernklientel“, der Jerusalempilger, zu deren Schutz sie sich von ihren Ursprüngen her verpflichtet fühlten. Sehr zum Missfallen der italienischen und südfranzösischen Seestädte drangen die Ordensritter bald in das wachsende Marktsegment der Jerusalemfahrten ein. Dies blieb vonseiten der Seestädte, die um ihre eigenen Geschäfte fürchteten, nicht unwidersprochen. Ein Vertrag zwischen der Stadt Marseille und den beiden Ritterorden der Templer und Johanniter aus dem Jahr 1233, abgeschlossen in Akkon, gibt einen deutlichen Hinweis auf die Rivalitäten unter den ungleichen „Transportanbietern“: Immer wieder, so klagten die beiden Ordensmeister, würden sie am freien Auslaufen aus dem Hafen von Marseille gehindert, um „ihr Eigentum, sowie Pilger und Kaufleute unter Erhebung eines Passagepreises“ ins Heilige Land zu befördern, so wie es ihnen laut alter Privilegien zustehe. „Es behaupten auch die Meister der beiden Orden, dass die Marseiller den Inhalt der genannten Privilegien nicht beachten wollten, ja häufig gegen Recht und Gerechtigkeit ihnen Geld abgepresst und unendliche Kränkungen und enormen Schaden zugefügt, welchen letzteren allein sie auf 2000 Mark Silber anschlügen“, heißt es in dem Dokument, das im Ordensarchiv in Valletta erhalten blieb, weiter.2
Die Ordensmeister drängten darauf, zur Entschädigung Marseiller Waren in Akkon zu beschlagnahmen. Nach langem Hin und Her einigten sich die streitenden Parteien schließlich auf folgenden Kompromiss: Zweimal im Jahr durften die beiden Orden je ein Schiff im Hafen von Marseille halten und beladen,
„nämlich zwei Schiffe im Passagium des August und zwar eins von dem Templerorden, das andere von dem Hospitalorden, und im März-Passagium ebenfalls zwei Schiffe, eins vom Tempel und eins vom Hospital, zur Beförderung der Angehörigen und des Eigentums der beiden Orden. Und in jedem Schiffe sollen sie aufnehmen können bis höchstens 1500 Pilger, Kaufleute aber so viele sie wollen. (…) Sollten aber die genannten Orden mehrere Schiffe zum Transport ihres Eigentums benötigen, so sollen sie dies haben dürfen, doch sollen sie in ihnen keine Pilger und keine Kaufleute befördern.“3
Die Ordensmeister stimmten dem Kompromiss, der den Pilgertransport für sie auf 1500 Personen pro Schiff beschränkte, ausdrücklich zu und erklärten ihre Ansprüche für befriedigt. Der Rat von Marseille bestätigte das Vertragswerk kurz darauf.
Ähnliche Vereinbarungen wurden auch mit italienischen und spanischen Hafenstädten abgeschlossen. Anlässlich des Vertrags von 1233 ist auch erstmalig der Name eines Johanniter-Kapitäns überliefert, Guillaume de Valence, der als „Commendator navium“ die Sorge für die Überfahrt trug. Aus einem Generalkapitelbeschluss von 1268 in Akkon geht hervor, dass neben dem „Commendator“ als Gesamtverantwortlichem zusätzlich ein für die Verpflegung zuständiger „Frater navium“ und ein Kaplan auf den Ordensschiffen mitfuhren, um die Passagiere zu betreuen. Schon bald zahlte sich der steigende Service im Personentransport aus, denn für die Schiffspassagen, die von Venedig nach Palästina je nach Wetterlage etwa vier bis acht Wochen dauerten, bezahlten die Pilger gutes Geld. Zunehmend regelten genaue Verträge dabei die Modalitäten der Überfahrt, zum Beispiel die Anzahl der mitzunehmenden Gepäckstücke, die Verpflegung und den Platz, den man an Bord in Anspruch nehmen durfte. Während sich jeweils zwei „Billigreisende“ eine schmale Ecke von etwa zwei Metern Länge und einem halben Meter Breite in den untersten Decks teilen mussten, mieteten sich reichere Zeitgenossen geräumige Kabinen im sogenannten Halbdeck, das an das luftige Oberdeck anschloss. Im Idealfall gehörten sogar eine eigene kleine Küche und Speisekammern dazu.
Obwohl sich die Johanniter dem Schutz der Pilger verschrieben hatten und bewaffnete Ritter auf den Transportschiffen mitfuhren, gab es zu diesem Zeitpunkt immer noch keine Veranlassung, von einer Seeherrschaft des Ordens zu träumen. Die Herren Ritter hatten gerade erst den Sprung aufs Wasser gewagt. Im Hafen von Akkon ankerten immerhin aber schon so viele Ordensschiffe, dass nach dem Fall der Stadt 1291 die letzten Überlebenden auf ihnen nach Zypern entkommen konnten. Darunter war nach spanischen Angaben auch ein besonders „großes Schiff“, vermutlich eines der großen „Rundschiffe“.