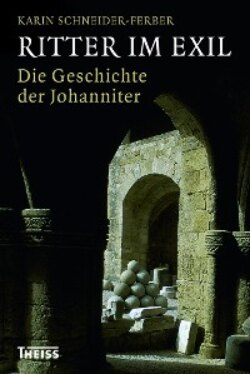Читать книгу Ritter im Exil - Karin Schneider-Ferber - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sehnsuchtsziel Jerusalem
ОглавлениеDie Entstehung der drei Ritterorden wäre ohne die zentrale Rolle, die Jerusalem im Denken der mittelalterlichen Gläubigen einnahm, nicht vorstellbar gewesen. Jerusalem galt wegen seiner religiösen Bedeutung als „Nabel der Welt“, als Ort der unmittelbaren Verbindung mit Gott. Die mittelalterliche Kartografie trug Jerusalem daher gerne als (symbolischen) Mittelpunkt der Erde ein. Der Wunsch, die Stätten des Lebens und Sterbens Jesu Christi einmal mit eigenen Augen zu sehen, zog schon in der Spätantike wachsende Pilgerscharen an. Der farbige Bericht der vermutlich aus Spanien stammenden Pilgerin Egeria aus dem 4. Jahrhundert, der die christlichen Festgebräuche in Jerusalem detailliert beschrieb, legt davon Zeugnis ab. In Jerusalem, dem Schauplatz des Heilsgeschehens, verschmolz die reale, irdische Stadt mit der Vorstellung vom „himmlischen Jerusalem“ mit seiner Verheißung auf Erlösung von Sünde und Tod. Der Besuch der heiligen Stätten versprach den Pilgern den höchsten Sündenablass und nicht zuletzt angesichts einer Vielzahl von Reliquien auch Heilung ihrer seelischen und physischen Leiden. Ob Jordanwasser, Kreuzes- oder Nagelsplitter – an Möglichkeiten, mit dem Heiligen in Berührung zu kommen, mangelte es nicht. Nirgendwo wähnte man sich dem Heil so nahe wie in Jerusalem. Vor allem die Grabeskirche und die von Kaiserin Helena im 4. Jahrhundert aufgefundene Kreuzreliquie zogen die Besucher magnetisch an. In Jerusalem selbst entstanden bereits im 7. Jahrhundert erste Pilgerunterkünfte, auch Kaiser Karl der Große stiftete im 9. Jahrhundert eine eigene Einrichtung.
Eine Reise nach Jerusalem bedeutete jedoch für Pilger aus Westeuropa ein langes, gefahrvolles Unterfangen mit vielen Risiken. Unterwegs konnte man erkranken, überfallen und ausgeraubt werden, vielleicht gar dem Tod entgegensehen. Den fremden muslimischen Machthabern fühlte man sich hilflos ausgesetzt. Die Nachrichten vom großen Pilgerzug, den Bischof Gunther von Bamberg 1064 mit zahlreichen anderen hochrangigen Mitgliedern des Reiches auf dem Landweg nach Jerusalem unternahm, sind voller Klagen über Wegelagerer, Räuber und Betrüger. Viele Konflikte mit Einheimischen entstanden, weil man sich weder sprachlich noch kulturell verstand. Die politische Lage im Vorderen Orient wurde durch das Vorrücken der türkischen Seldschuken und die Niederlage der christlich-orthodoxen Vormacht Byzanz’ in der Schlacht von Manzikert in Ostanatolien (1071) weiter destabilisiert. Die zuvor von Byzanz kontrollierten Landwege durch Syrien wurden wieder unsicherer und das Bedürfnis der Pilger nach Schutz und Versorgung wuchs. Viele kamen nur mit letzter Kraft am Ziel ihrer Wünsche an.
Noch vor dem Ersten Kreuzzug, zu dem Papst Urban II. in einer flammenden Rede auf dem Konzil von Clermont 1095 aufrief, gründeten daher Kaufleute aus der süditalienischen Stadt Amalfi wohl zwischen 1070 und 1080, vielleicht sogar schon um die Mitte des 11. Jahrhunderts, in der Nähe der Grabeskirche zur Versorgung kranker und hilfsbedürftiger Pilger zwei nach Männern und Frauen getrennte Benediktinerklöster, St. Maria Latina und St. Maria Magdalena, und zusätzlich, als sich deren Kapazitäten als nicht ausreichend erwiesen, noch ein eigenes Hospital mit einer dem heiligen Johannes dem Täufer geweihten Kirche. Zunächst standen die Mitarbeiter dieses Hospitals unter der Aufsicht der Mönche und wurden von diesen und den Amalfitanern finanziert. Es handelte sich um Laien, die vermutlich nur einen einfachen Gehorsamseid gegenüber den Benediktinermönchen geleistet hatten, wie es sich für Laienbrüder oder Konversen geziemte. Die Existenz eines Hospitals bestätigen mehrere schriftliche Quellen, aber auch archäologische Ausgrabungen, die Reste eines mehrfach zerstörten Hospitalgebäudes und der St.-Johannes-Kirche als „Keimzellen“ des Johanniterordens zutage beförderten. Um 1080 konnte Erzbischof Johannes von Amalfi bereits das bestehende Hospital auf seiner eigenen Jerusalemreise in Augenschein nehmen.
Nach der blutigen Eroberung Jerusalems 1099 durch die Kreuzfahrer des Ersten Kreuzzuges und der Gründung des Königreiches Jerusalem wuchs der Einrichtung neue Bedeutung zu. Unter dem Leiter Gerhard (gest. 1119/29) löste es sich aus seiner engen Bindung an die Benediktinermönche und stand fortan in Beziehung zu dem lateinischen Patriarchen von Jerusalem und den am Heiligen Grab wirkenden Augustinerchorherren. Die hohe Aufmerksamkeit, die der Besitz des Heiligen Grabes im lateinischen Westen erregte, sicherte auch dem Johanneshospital erhöhte Beachtung. Reiche Spenden und Landzuweisungen in Europa und dem Heiligen Land begünstigten die Hospitalgemeinschaft, wobei man zwischen Gaben für das Heilige Grab und das Hospital gar nicht genau unterschied. Der erste König von Jerusalem, Balduin I., übertrug jedenfalls der karitativen Einrichtung Besitzungen in Jerusalem, Nablus, Jaffa und Akkon.
Als besonders förderlich für die Zukunft erwies sich die rechtliche Anerkennung der jungen Gemeinschaft als eigener Orden durch Papst Paschalis II. 1113. Der Papst bestätigte in seiner Bulle „Pie postulatio voluntatis“ dem neuen Orden vom „Hospital des heiligen Johannes zu Jerusalem“ alle Besitzungen in Syrien und dem Westen, gewährte die freie Wahl eines Ordensmeisters, löste die Bindung zum Heiligen Grab und stellte ihn unter seine eigene Aufsicht. Der karitative Schwerpunkt der Johanniter trat in der Bulle deutlich hervor, denn der Leiter Gerhard zeichnete nicht nur für das Jerusalemer Hospital verantwortlich, sondern auch für die Einrichtungen in St-Gilles, Asti, Pisa, Bari, Otranto, Tarent und Messina, die nicht umsonst in ihrer Mehrzahl zu den bedeutendsten Ausschiffungshäfen für Jerusalempilger zählten. So gab es ein „Versorgungssystem“ für in Not geratene Pilger von den Hafenstädten der alten Heimat bis zum Zielort Jerusalem.
In der Kranken- und Armenfürsorge leistete der Orden denn auch Großes. Das Hospital in Jerusalem wurde Mitte des 12. Jahrhunderts großzügig ausgebaut und genoss aufgrund seines geschulten Personals einen hervorragenden Ruf. In dem riesigen Krankensaal, der von 124 Marmorsäulen untergliedert wurde, fanden bis zu 2000 Personen, Männer wie Frauen, Platz, die von 140 Pflegern und Ärzten rund um die Uhr in elf Schichten versorgt wurden. Die Hospitalordnung von 1182 legte fest, dass „für jeden Flur und Raum im Hospital, wo Kranke liegen, neun Helfer für ihren Dienst bereitstehen sollen, die ihre Füße schön waschen, ihre Tücher reinigen, ihre Betten richten, den Schwachen die nötigen und bekömmlichen Speisen reichen, ihnen liebevoll zu trinken geben und in allen Dingen dem Wohl der Kranken gehorchen“.6 So mancher Reisende kam aus dem Staunen gar nicht heraus angesichts des ungewöhnlich umfangreichen Hospitalbetriebs, den der Kleriker Johannes von Würzburg in seinem Reisebericht aus den Jahren 1160 bis 1170 beschrieb:
„An der entgegengesetzten Seite des Weges, gegenüber der Kirche des Heiligen Grabes gegen Süden, steht eine schöne Kirche, die zu Ehren Johannes des Täufers gebaut ist. An sie schließt sich ein Krankenhaus [an], in dessen verschiedenen Räumen eine ungeheure Zahl Kranker sich sammelt, Männer und Frauen, die mit sehr großen Kosten gewartet und geheilt werden. Als ich dort war, vernahm ich, dass die ganze Zahl der Kranken sich auf 2000 belief, von denen manchmal im Laufe eines Tages und einer Nacht mehr als 50 tot hinausgetragen wurden, während neue ununterbrochen ankamen. Was könnte ich sagen? Dies Haus versorgt ebenso viele Leute außerhalb wie innerhalb, wozu noch die großartige Barmherzigkeit kommt, die täglich armen Leuten erwiesen wird, welche ihr Brot von Türe zu Türe erbetteln und nicht im Hause wohnen, sodass die gesamte Summe der Ausgaben mit Sicherheit auch von den Vorständen und Leitern gar nicht angegeben werden kann.“7
Zusätzlich zum umfangreichen Engagement im Jerusalemer Spital betrieb der Orden bis zum Ende der Kreuzfahrerzeit weitere sieben Hospitäler im Heiligen Land.
Das dadurch gestiegene Ansehen schlug sich in einer neuerlichen Privilegierung nieder. 1135 enthob Papst Innozenz II. den Orden der bischöflichen Jurisdiktionsgewalt, zwei Jahre später gestattete er ihm die Gründung von Dörfern, Kirchen und Friedhöfen auf den ihm übertragenen Ländereien. 1154 kam die Entwicklung unter Papst Anastasius IV. zu einem gewissen Abschluss, der alle vorherigen Privilegien bestätigte und die Indienstnahme ordenseigener Kleriker gestattete. Die überwiegende Anzahl der Ordensmitglieder waren jedoch Laien, die die klösterlichen Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegten und gemeinsame Gebetszeiten beachteten. Unter dem zweiten Ordensmeister Raymond du Puy (reg. 1120–1158/60) kam es zwischen 1120/24 und 1153 zur schriftlichen Fixierung einer Ordensregel, die sich stark am benediktinischen Ideal sowie an der Augustinerchorherrenregel orientierte. In 19 Artikeln wurden die Normen des Zusammenlebens wie das Ablegen der Gelübde, das Verhalten im Gottesdienst, das Sammeln und Verwenden von Almosen, das Tragen der schwarzen Ordenskleidung mit dem Kreuz, das erst etwas später seine charakteristische achtspitzige Form annahm, oder die Abwesenheit vom Konvent zusammengefasst. Strafen für Übertretungen dieser Regel wurden ebenso festgelegt wie die Kriterien zur Aufnahme und Pflege der Kranken. Für die Kranken war dabei nicht nur die leibliche, sondern auch die geistliche Betreuung durch die Brüder vorgesehen.
Rüstung, Schild und Schwert suchte man bei dem Spitalorden zunächst vergeblich. Erst langsam wuchs er in eine militärische Rolle hinein, da der Schutz der Pilger auf den unsicheren Landwegen immer wichtiger wurde. Der Templerorden hatte es vorgemacht. Um 1120 hatten sich unter Führung des aus der Champagne stammenden Ritters Hugo von Payens in Jerusalem einige Ritter zu einer Bruderschaft zusammengetan, um den bewaffneten Schutz der Pilger von den Küstenstädten nach Jerusalem zu gewährleisten. König Balduin II. überließ ihnen Teile seines Königspalastes in der al-Aqsa-Moschee, der auf den Grundmauern des Tempels Salomons stand. Daher nannte sich die Gemeinschaft „Arme Ritter Christi und des Tempels von Salomon zu Jerusalem“ oder einfach Templerorden. Anders als bei den Johannitern ging es den Gefährten um Hugo von Payens von Anfang an ausdrücklich um eine militärische Aufgabe, nämlich die Verteidigung der Pilgerscharen und der gerade entstehenden Kreuzfahrerstaaten gegen Angreifer von außen.
Das höchstproblematische Verhältnis zwischen christlichem Friedensgebot und militärischem Kampfeinsatz konnte mithilfe des hoch angesehenen Zisterzienserabts Bernhard von Clairvaux gelöst werden, der in seiner „Lobrede auf das neue Rittertum“ den bewaffneten Kampf der Krieger-Mönche gegen Glaubensfeinde in den höchsten Tönen lobte. „In der Tat ist ein Ritter unerschrocken und von allen Seiten geschützt, der wie den Körper mit dem Panzer aus Eisen auch den Geist mit dem Panzer des Glaubens umgibt. Mit beiderlei Waffen vortrefflich geschützt, fürchtet er weder Teufel noch den Menschen“, begrüßte er die neue Entwicklung.8 „Wenn (der Tempelritter) einen Übeltäter tötet, ist er kein Mörder, sondern, wie ich es nennen möchte, sozusagen ein Übeltöter“, wischte er alle Gewissenszweifel vom Tisch. 1129 erhielt der neue Orden auf dem Konzil von Troyes seine kirchenrechtliche Anerkennung unter einer eigenen Ordensregel.
Unter dem Zwang der Notwendigkeiten, die eigenen Herrschaftsgebiete in einem überwiegend feindseligen Umfeld zu sichern, begannen sich auch die auf den Spitaldienst spezialisierten Orden zu militarisieren. Zu diesen zählte neben den Johannitern auch der Deutsche Orden, der aus einer 1189/90 von niederdeutschen Kreuzfahrern während der Belagerung Akkons gegründeten Spitalbruderschaft hervorgegangen war. Auch diese zunächst rein karitative Gemeinschaft nahm angesichts der unsicheren Verhältnisse im Heiligen Land das Schwert zur Hand. 1198 übernahm der Orden eine gemischte Regel – für den militärischen Dienst die der Templer, für die karitativen Aufgaben die der Johanniter. 1199 bestätigte Papst Innozenz III. den Deutschen Orden konsequenterweise als neuen Ritterorden.
Wie der Prozess der Militarisierung bei den Johannitern genau ablief, ist unsicher. Zunächst dürften sie nur in ihrer Eigenschaft als Grundherren Truppen aus den ihnen übertragenen Ländereien rekrutiert sowie zusätzlich Söldnerkontingente angeworben haben. Raymond du Puy gehörte aber jedenfalls schon zum engeren Beraterkreis der Kreuzfahrerheere, wenn es darum ging, militärische Aktionen abzusprechen. Bis zur Aufnahme von eigenen Ordensrittern, die sich ausschließlich dem Kampf widmeten, dauerte es jedoch noch eine ganze Weile. Quellenmäßig lassen sich in den Ordensstatuten erst um die Wende zum 13. Jahrhundert bewaffnete Brüder nachweisen.