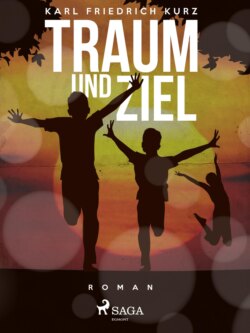Читать книгу Traum und Ziel - Karl Friedrich Kurz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Geheimnis
ОглавлениеIm Frühling wurde Konrad eingesegnet und aus der Schule entlassen. Schon des anderen Tages trat er in die Lehre bei einem Drogisten. Als er am Abend nach Hause kam, roch er vielversprechend nach Zimt und Teer und allerlei. Und am Ende der Woche brachte er seinen ersten kleinen Lohn. Vor Konrad versank das Märchenland. Im Grunde hatte er nicht besondere Lust zum Drogisten; er wäre lieber Architekt geworden, hätte Häuser und Kirchen bauen wollen. Doch weil ihm dieser Wunsch nicht erfüllt werden konnte und er auf einen anderen Weg gesetzt wurde, ging er ihn in gelassener Selbstverständlichkeit. Die anderen Knaben vermissten ihn kaum, denn er war nie ein richtiger Junge.
Übrigens waren ja nun die kleinen Italiener da. Zwar Franceska und Isotta zählten nicht mit, da sie nur Mädchen waren und heulten, wenn man sie anstiess und sie hinfielen. Emil sagte: „Das sind eigentlich noch keine rechten Menschen; es sind höchstens missglückte Versuche.“
Um so besser eigneten sich die drei Knaben zu seinen Unternehmungen. Die wurden von ihm nach Herzenslust herumgetummelt, stets waren sie voller Beulen und Schrammen. Unübertreffliche Soldaten, die blind gehorchten, die für ihren General bis ans Ende der Welt marschierten, für ihn bluteten, siegten und fielen.
Emil konnte sie durch das Akaziengestrüpp an den Strand hinabführen, wo eben ein paar mächtige Baumstämme angebunden lagen. Emil konnte ihnen befehlen: „Erobert diese feindlichen Schiffe!“
Die kleinen Italiener brüllten Hurra und eroberten die Schiffe mit Glanz.
Emil sagte: „Und nun aufgepasst — ich knüpfe das Seil los, dann könnt ihr ein Stückweit den Rhein hinunterfahren.“
Die Soldaten gehorchten, Dominico, Ernesto, Nicolo, alles mutige Krieger. Sie kletterten auf die Stämme hinaus.
„Weiter unten binde ich die Schiffe wieder an“, sagte der General, „dann könnt ihr aussteigen.“
Aber auch dieses Unternehmen verlief nicht ganz nach Emils Berechnung. Hier trug zur Abwechslung die starke Strömung die Schuld daran. Die Strömung ergriff die Baumstämme und riss sie vom Ufer fort. Und als Emil das Seil nicht mehr zu halten vermochte, liess er es fahren. Aber er lief wenigstens dem Ufer entlang und unterstützte seine Krieger durch tapferen Zuspruch: „Haltet euch nur fest! Ihr könnt Gift darauf nehmen, dass man euch weiter unten auffischt; es geschieht euch gar nichts. Und falls man euch nicht auffischen sollte, bleibt ihr einfach an einem Brückenpfeiler hängen.“
Eine Mauer verlegte dem General den Weg. Er rief der abziehenden Armee doch noch nach: „Und wenn sie euch trotzdem nicht auffischen sollten und ihr auch nicht an einem Brückenpfeiler hängenbleibt, dann fahrt ihr in Gottes Namen ins Meer hinaus. Lebt wohl ...“
Hurra.
Barrenti, der Machthaber im Gärtnerhaus, verdrosch seine Buben, als sie nass nach Hause kamen. Schuldig oder unschuldig, darauf kam es ihm ebensowenig an wie einem Hannes Frank. Vater war er, und Strafe muss sein. In dieser Gegend war das goldene Zeitalter der Jugend noch nicht angebrochen, man verehrte noch nicht die Majestät des Kindes.
Im übrigen hielt der Italiener gute Nachbarschaft. Sein Singen und Pfeifen erklang schon in frühester Morgenstunde. Begegnete man ihm auf dem Wege, dann rief er ein lustiges Wort und lachte dazu. Er ging umher mit seinen prachtvollen weissen Zähnen und seinem Perlenhumor, Gott und allen Menschen wohlgefällig, als ein unverwüstlicher Sänger und Spassmacher — die ganze Woche lang. Doch am Sonnabend betrank er sich, und dann drangen andere Töne aus dem Gärtnerhaus. Dann schrie die blasse kleine Frau, und es schrien die Kinder. Dann wurde Giochino Barrenti zum gefährlichen Tier.
Man gewöhnte sich bald an beides, sowohl an die friedliche Gemütlichkeit der Woche als an den Sturm des Samstags. Es ist ein Segen und ein Fluch, dass die Menschen sich so schnell an alles gewöhnen.
Man bedauerte die arme Frau und die armen Kinder. Wer sollte ihnen helfen? Wer soll all den vielen helfen, die leiden müssen? Einst zog ein tapferer Ritter aus, mit der Stärke seines Armes allen Verfolgten zu helfen und Krummes geradezubiegen. Dafür wurde er selber geprügelt und ausgelacht. Es bleibt das Weltgetriebe stets dasselbe. Den einen trifft es so, den anderen anders ...
Die Italiener lebten weiter.
Aber gegen den Frühling hin ereignete sich etwas Schlimmes, ein Unglück. Das traf Konrad. Das Schicksal hatte ihn ausersehen, da mussten ihm beide Arme verbrannt werden. Und auch das ging so einfach und alltäglich zu, als fiele nur ein reifer Apfel vom Ast. Ein Teil Unachtsamkeit, ein Teil Heldentum, daraus entstand Konrads Unglück.
Zweifellos war das der erste Fehler, dass der Drogist in seiner Werkstatt einen offenen Petrolkocher verwendete. Dann war der zweite Fehler, dass der Geselle darauf Wachs schmolz. Das Weitere ergab sich von selber: überkochendes Wachs, Geschrei, ein fliehender Geselle. Vielleicht wäre ein Haus eingeäschert worden. Aber nun stand eben ein Junge, wie dieser Konrad, dabei, und der hatte, wie jener irrende Ritter, in seinem Herzen den Drang, zu helfen, ohne lange Überlegung. Darum griff er zu mit seinen beiden Händen. Und da es nun so geschehen sollte, trug Konrad an diesem Tage einen neuen Leinenkittel, der sogleich in heller Lohe stand. Der ganze Konrad wurde zur brennenden Fackel.
Sie zogen ihm den Kittel über den Kopf; aber die Knöpfe an den Ärmeln hielten fest. Sie wickelten ihn in nasse Tücher und erstickten das teuflische Feuer. Zu spät. Das Feuer hatte Konrads Arme vernichtet; Konrads beide Arme, mit denen er arbeiten wollte ein ganzes Leben lang.
Sie brachten ihn ins Krankenhaus. Da lag er nun — ein gefällter junger Baum, der nie blühen und keine Früchte tragen durfte. Es ward Konrads Lebensweg abgebrochen. So unbegreiflich laufen die Wege der Menschen, bald grauenhaft, bald lächerlich. Die Menschen können es nicht ändern.
Der reiche Weinhändler Bondorf verschwendete sein Geld und verlor deshalb sein Leben und das Leben seiner Frau; aber Konrad verlor alles durch eine gute Tat, sein Herz war frei von Gier und Sünde. Ach, ihr Freunde, wer vermag je das Geschick der armen Menschen zu deuten?
Die Lohmannschen Frauen heulten jammervoll; selbst Hannes Frank, der sonst in jeder Not einen Rat wusste, verstummte. Noch hofften sie, dass nicht alles verloren sei. Doch mit Konrad stand es schlimmer als schlimm. Es sei hoffnungslos, erklärte der Arzt. „Die Arme sind verloren.“
„Allmächtiger — beide Arme?“
„Beide Arme.“
Ach, wie sie klagten und heisse Tränen vergossen, die Frauen. „Nur zu Leid und Schmerz wurde er geboren“, klagten sie. Sie wandten sich an die höheren Mächte und fragten: „Was hat er denn verbrochen, der arme Bub, dass er derart gezüchtigt wird?“ Sie erhielten keine Antwort auf diese Frage.
Endlich fand Hannes Frank seine starke Sprache wieder; endlich erinnerte er sich an sein Zauber- und Wunderbuch, an den Helfer aus allen Nöten. Er legte den Kopf zurück und verkündete: „Beide Arme! Ob es ein zehnfacher Professor ist, der solches behauptet — ich meinerseits glaube nicht daran. Ich sage: Wo noch Leben ist, ist Hoffnung. Und die studierten Herren machen auch ihre Dummheiten.“
Gut gesagt; eine frische Sprache und ein linder Trost für die Frauen. In den nächsten Tagen wurde nicht gekämpft im Ritterhof; alle schlichen traurig und bedrückt umher wie gezüchtigte Kinder.
Die Wunden in Konrads Gesicht heilten überraschend schnell. Nach ein paar Wochen wurden ihm die Binden abgenommen, und er lächelte Werner entgegen — blass wie immer, geduldig wie immer. Konrad trug sein Leid mit der wunderbaren Ergebung der Tiere, die nicht jammern, die sich nur irgendwo verkriechen, um stumm zu sterben.
„Ja, ja — das ist eine sorgenvolle Geschichte“, sagt Konrad. Es klingt beinahe wie eine Entschuldigung. „Nimm den Stuhl dort. Rück näher — so — setz dich doch!“ Alles scheint ihm selbstverständlich. „Und jetzt liege ich also hier“, sagt Konrad.
Und es ist wohl nicht mehr darüber zu sagen. Da liegt er.
Aber für Werner ist das nicht so klar und begreiflich. Werner öffnet mühsam den Mund — kein Laut. Mit zuckenden Fingern fährt er über den Rand des steifen Hemdkragens, der auf einmal so eng wird und furchtbar würgt. Eine Bleikugel steckt in seinem Hals, er schluckt und schluckt und kann sie nicht verschlucken.
„Dort — jenes Stück Schokolade“, sagt Konrad, mit den Augen auf den kleinen Tisch zu Häupten des Bettes weisend. „Die Schwester gab es mir. Nimm es. Ich mag Süssigkeiten nicht, wie du weisst. Und hier bekomme ich viel zuviel davon. Sie schenken mir alles mögliche. Alle sind gut gegen mich.“
Ob Konrad Süssigkeiten nicht leiden mochte, wie hätte Werner das wissen können? Hingegen weiss er, dass Konrad das Stücklein Schokolade für ihn aufgespart hat. Da ihm jedoch eine Kugel im Halse steckte, vermag er nichts zu essen. „Hattest du grosse Schmerzen?“ fragt er.
„Nein. Zuerst war es der Schreck; ich war ja ganz betäubt. Wenn die Schmerzen zu gross werden, empfindet man sie nicht mehr. Und heute spür’ ich auch nicht viel davon — nur wenn sie den Verband wechseln ...“
Sie plaudern ein wenig miteinander, und Konrad erkundigt sich nach seinen Kaninchen. „Du hast sie doch nicht vergessen?“
„Ich füttere sie jeden Morgen und jeden Abend.“
„Ja, das hab’ ich mir schon gedacht.“
Lange Pause.
„Bald wirst du wieder aufstehen und sie selber füttern.“ Werner sagt das und glaubt daran in seinem Knabenherzen, weil er es so sehr wünscht.
Aber Konrad schüttelt den Kopf. „Nein, nein, du — mit mir ist es aus. Sie drehen mir jedesmal den Kopf zur Seite, wenn sie mich verbinden. Aber ich habe meine Arme gesehen — an der linken Hand sind nur noch zwei Finger ...“
Werners Lippen beben, sein Kinn bebt, und ohne dass er selber es merkt, laufen ihm die Augen über. Er starrt entsetzt auf die beiden weissen Hügel, zwischen denen Konrad liegt; Eiswasser rieselt ihm den Rücken hinab. Er schlottert vor Kälte. Verwirrt und verzweifelt murmelt er: „Das — nein — vielleicht täuschest du dich...”
„Ich täusche mich nicht. Die Schwester sagte heute, man könne gut leben und glücklich sein ohne Arme.“
„Sagte sie das? Was meinte sie damit?“
„Ich denke, sie wollen mir die Arme abnehmen. Aber das dürfen sie nicht. Ich hab’ es der Schwester gesagt.“
„Nein, das dürfen sie nicht.“
„Aber sie können mich jederzeit operieren. Wie sollte ich mich dagegen wehren?“
„Sie dürfen es niemals tun“, sagt Werner noch einmal mit brüchiger Stimme. „Ich will mit der Schwester reden.“
„Ja, rede mit ihr.“
Dann unterhalten sie sich wieder und kommen auf andere Dinge. Werner sagt: „Die Märzenglöcklein, die du im Herbst gepflanzt hast, blühen schon. Ich wollte dir ein paar mitbringen, aber ich vergass es.“
Konrad schliesst die Augen. Die schmale Öffnung zwischen den Lidern füllt sich mit Tränen. Er flüstert verschämt: „Unter meinem Kissen liegt ein Taschentuch.“
Während Werner Konrads Tränen trocknet, wundert er sich, wie es möglich sein kann, dass zu dieser Stunde an der hinteren Mauer des Gartens Märzenglöcklein blühen dürfen. Und er wundert sich, ob überhaupt jemals wieder Blumen blühen dürfen in einer Welt, in der so Furchtbares geschehen kann. Ein ähnliches Gefühl von Verzweiflung und Verlassenheit überfällt ihn wie an jenem Samstag, als sein Vater das Versprechen brach und alle seine Himmel einstürzten.
Befremdlich klingt Konrads Stimme: „Ich möchte gern zu euch zurück — glaubst du, dass das möglich ist?“
Am ganzen Leibe zitternd, schiebt Werner das Taschentuch wieder unters Kissen. „Warum sollte das denn nicht möglich sein?“ fragt er erstaunt.
„Weil es zuviel kosten würde. Ich kann ja nun nichts mehr verdienen. Und der Arzt, und das viele, viele Verbandzeug. Nein, du — es geht doch nicht.“
Sicherlich dachte Konrad über diese Frage gründlich nach und erkannte die Schwierigkeiten. Aber er kann es nicht verhindern, dass das Heimweh ihn plagt, dass er sich zurücksehnt nach den Menschen, die ihm zwar niemals unnötige Liebe erwiesen, aber deren Gesichter und deren Stimmen er kennt. „Bei euch zu Hause möchte ich sterben“, sagt er leise, den Blick aufs Fenster gerichtet, in dem die kahle Krone eines Baumes vor einem emailleblauen Himmel kaum merklich hin und her schwankt. Sein Blick ist seltsam ruhig, seine Stimme beherrscht. Ja, gewiss hat er über vieles nachgedacht in diesen schweren Tagen. Er sieht vor sich das kleine Stück Weg, auf dem ihm der Tod entgegentritt. Er fragt nicht, er jammert nicht.
„Ich werde alles für dich tun“, sagt Werner leise. „Wenn es sein muss, werde ich zu den reichen Leuten für dich betteln gehen.“ In Werners Stimme ist ein stahlhelles Klingen, das Konrad aufhorchen lässt. „Du musst zu uns zurück. Sei sicher. Vertraue mir.“
Ein Schimmer von Freude gleitet über Konrads schmale Wangen. „Ja, ja“, nickt er.
Und so reden sie miteinander und sind unwissende Kinder und leidgeprüfte Greise zu gleicher Zeit.
„Des Abends, sowie ich aus der Schule komme, will ich an deinem Bett sitzen und dir vorlesen, bis du wieder gesund bist ...“
„Ja, ja.“
„Und ich werde dir den Kaninchenstall ans Bett stellen ...“
„Alles glaub’ ich dir. Aber sieh, dort winkt die Schwester. Die Besuchsstunde ist zu Ende. Komm bald wieder zu mir!“
Im langen Gang, in den unzählige Türen münden, der nach Karbol und Jodoform und Schmerzen und Menschennot riecht, steht Werner. Ein paar Schwestern gleiten lautlos und eilig an ihm vorbei und blicken ihn fragend an. Ein Herr in weissem Mantel taucht aus einer Tür auf; hinter scharf funkelnden Brillengläsern hervor mustert er den dürftig gekleideten Jungen und fragt: „Was suchst du hier?“
„Ich warte auf die Schwester.“
„Auf welche Schwester?“
„Die Konrad pflegt.“
Der Herr beugt seinen schmalen Kopf. „Meinst du den Konrad mit den verbrannten Armen?“
„Ja.“
„Was willst du von ihr?“
„Ich mochte sie bitten, dass sie mich zum Arzt führt.“
„Da bist du ja schon. Was wünschest du von mir?“
Eine erstickende Angst befällt Werner, er schluckt und beginnt zu schnaufen.
„Nun, nun?“ fragt milde der Arzt. „Was fehlt dir denn, Junge?“
„Er fürchtet sich, dass Sie ihm die Arme abnehmen“, stammelt Werner. „Aber er will es nicht.“
Der Arzt betrachtet den verzweifelten Werner und besinnt sich. „Du bist wohl sein Bruder und scheinst ja ein gescheiter Junge. Höre also: Konrads Brandwunden sind zu gross und zu tief, sie können niemals heilen. Er muss daran sterben. Nur die baldige Operation kann ihn retten.“
„Aber er will dennoch nicht.“
Der Arzt blickt auf Werner nieder; er hat begriffen. „Konrad wird nicht operiert, wenn er es nicht selber verlangt.“
„Wollen Sie ihm das sagen?“ bittet Werner. „Es würde ihn beruhigen.“
„Gleich geh’ ich zu ihm. Sei unbesorgt.“
Und nun ist Werner wieder auf der Strasse, in der sich die Menschen drängen und vorwärts hasten. Ein paar Frauen gehen vor ihm her, erzählen lustige Dinge und kichern. Kinder spielen. Klar scheint die Frühlingssonne. In den Bäumen zwitschern die kleinen Vögel. Wahrlich, die ersten Stare sind schon vom Süden heraufgeflogen.
In dumpfer Traumangst schreitet Werner dahin. Alles wird ihm unfassbar. Die Menschen gehen spazieren und lachen, denkt er. Sehen sie denn nicht die finsteren Mächte, die über ihnen schweben? Wissen sie denn nicht, dass es keine Gnade gibt, weder im Himmel noch auf Erden?
Er achtet nicht auf den Weg. Er irrt durch diese Welt des Grauens als eine stumme, qualvolle Frage.
Die ersten Lichter flammen auf. Werner blickt verwundert nach allen Seiten und findet sich in einer unbekannten Gegend. Es wird späte Nacht, bis er nach Hause kommt.
Im Ritterhof schläft alles. Das grosse Haus ragt schwarz in einen schweren Frühlingshimmel, düster, geheimnisvoll wie eine alte Burg. Aber aus einem Fenster der Gärtnerwohnung quillt ein roter Lichtstrom. Dort geschieht etwas Furchtbares.
Zwei Gestalten bewegen sich seltsam vor der hellen Öffnung. Der Italiener Barrenti will seine Frau aufs Pflaster hinabwerfen. Es ist Samstagabend, und er hat sich wieder sinnlos betrunken. Ein schattenhaftes, ein völlig stummes Ringen. Die kleine Frau umklammert mit ihren Armen das Fensterkreuz, ihr Oberkörper hängt schon über dem Gesims in der freien Luft.
Werner weiss nicht, was er jetzt tut. Aber er rennt über den Hof. Die Haustür steht offen, die Stubentür steht offen. Im Luftzug blafft die Lampe. Vor dem Tisch liegen Barrentis schwere Stiefel.
Nein, Werner weiss durchaus nicht, wie das kommt. Ein Stiefelabsatz fährt auf Barrentis Kopf. Barrenti sinkt lautlos nieder. Neben ihm steht die kleine Frau im blossen Hemd mit weissem, starrem Gesicht. Sie streicht sich eine Haarsträhne aus der Stirn.
„Ist er tot?“ murmelt Werner.
Die kleine Frau schüttelt den Kopf, hebt langsam die Hand und weist zur Tür. Ihr Arm ist gelb und entsetzlich mager. Sie sagt kein Wort.
Dem folgte eine lange Nacht mit tausend Foltern.
Der Italiener wurde in dieser Nacht nicht erschlagen. Doch er sang nicht am Sonntagmorgen. Werner sah ihn vom Fenster auf über den Hof schreiten, ein Tuch um den Kopf gewickelt. Er ging zum laufenden Brunnen und wusch sein Gesicht, und er glich einem Türken.
Über diesen Vorfall wurde nie ein Wort laut. —
Seit dem Tage, da der alte Klaus den verborgenen Schatz gefunden, trat er unter den Lohmanns als guter Geist auf. Die vielen erstaunten Fragen beantwortete er mit stummem Kopfschütteln. Er hütete sein Geheimnis.
„Konrad hat Heimweh“, sagte Werner, indem er scheu zu seinem Vater emporschaute. „Er möchte nach Hause.“
„Daran ist nicht zu denken“, entgegnete Hannes Frank bestimmt. „Wir haben nicht genug für uns selber. Ist er nicht am besten aufgehoben, wo er jetzt liegt?“
Die Frauen starrten vor sich nieder, seufzten und nickten stumm.
Aber nach dem Essen zupfte der Grossvater Werner am Rockärmel, machte ihm ein geheimes Zeichen und verliess die Küche. Der Grossvater wackelte gewaltig mit dem Kopf und fragte: „Kostet es viel Geld?“
„Ja, das tut es wohl.“
„Etwas könnte ich dir schon geben, wenigstens für den Anfang. Doch du darfst nie verraten, woher das Geld kommt.“
Dieserart wurde also wieder eine Unmöglichkeit möglich, und sie holten Konrad aus dem Spital. Nun lag er in einem grossen, hellen Zimmer zur ebenen Erde, im früheren Kontor des Weinhändlers Bondorf. Elisa übernahm seine Pflege. Der Drogist zahlte jede Woche einen kleinen Betrag. Somit schien alles bestens geordnet.
Des Abends sass Werner an Konrads Bett, und sie sprachen über viele Dinge. Dass Konrad bald sterben musste, das stand fest. Jedermann wusste es. Am besten wusste Konrad es selber. Er sprach über sein Ende als der unabwendbaren Tatsache, wie sie vor jedem lag. Zwar nahm er noch regen Anteil am Geschehen ringsum. „Hol mir ein Kaninchen“, bat er.
Werner trug das Kaninchen ans Bett und streichelte es für Konrad. Selbst an den schrecklichsten Lauf der Dinge können die Menschen sich gewöhnen. Mag es noch so elend sein, bleibt das Leben doch immer etwas Grosses.
„Ich möchte dich um etwas bitten“, sagt Konrad. „Aber das ist eine Sache, von der kein Mensch je etwas erfahren darf.“ Darauf besinnt er sich und fragt: „Sag mir, Werner — kannst du schweigen?“
„Ob ich schweigen kann? Das weisst du wohl selber.“
„Ja, ich weiss das“, nickt Konrad. Aber darauf liegt er doch noch lange mit geschlossenen Augen und kämpft sichtlich mit einem schweren Entschluss. Er wird seltsam feierlich. „Komm ganz nahe zu mir heran. Ich muss es dir ins Ohr sagen. Du bist doch schon zuoberst auf dem Dachboden gewesen?“
„Ja.“
„Ja, dort ist ein rundes Fenster gegen den Rhein hin — nicht?“
„Ich kenn’ das Fenster.“
„Vor diesem Fenster — das zweite Brett im Fussboden ist nicht festgenagelt; es lässt sich heben. Darunter liegt etwas ...“
Werner sagt schnell: „Das, was du am ersten Morgen hier fandest.“
„Ich fand es im kleinen Zimmer neben dem Saal, in dem die Bondorfs schliefen.“ Und nun dreht Konrad den Kopf zur Seite und müht sich, sein Gesicht im Kissen zu verbergen. „Es wäre schön, wenn ich das in meiner Nähe hätte. Aber es ist schon dunkel, und du darfst kein Licht machen. Denn kein Mensch darf dich sehen.“
„Soll ich es dir holen?“
„Fürchtest du dich nicht?“
„Nein — wovor?“
„Warte ein wenig. Wo können wir es hier im Zimmer verstecken?“
„Ich weiss einen feinen Ort — hinter dem Paneel am Fenster.“
„Gut. Hol es! Aber sei vorsichtig, die Treppe ist lang und finster.“
Geschmeidig schleicht Werner durchs Haus, das Geheimnisvolle zu holen, das, wofür Konrad sich schlagen liess, wofür er bereit war, zu sterben. Die Treppe ist lang und finster, und Werner fürchtet sich. Aber er kommt auf den Estrich und hebt beim Schein eines Streichholzes das Bodenbrett. Darunter liegt eine Puppe.
Die Puppe liegt auf dem Rücken in bunten Seidenkleidern und hat lange, braune Locken. Sehr behutsam nimmt Werner sie aus ihrem Versteck, wischt ihr den Staub von Gesicht und Kleidern und gelangt ungesehen wieder in Konrads Zimmer. „Hast du sie?“ fragt Konrad, eine dunkle Röte im Gesicht.
Ähnlich wie zuvor das Kaninchen, hält Werner jetzt die Puppe über Konrads Bett und streichelt mit behutsamen Fingern das braune Lockenhaar.
Sie hat einen himbeerroten Mund; zwischen den Lippen steht die kirschrote Zungenspitze. Ein Auge ist geschlossen, das andere steht offen. Die Puppe schaut in Werners verdutztes Gesicht, als lächle sie pfiffig und wissend. Und da Werners Hände ein wenig zittern, öffnet sie auch das andere Auge, und die Zunge bewegt sich hinter den perlenweissen Zähnen, die Lider mit den langen Wimpern bewegen sich, ja selbst die Augen gleiten sachte auf und nieder.
„Nun sollst du nicht glauben, dass ich früher mit ihr spielte. Aber, verstehst du — es war doch ihre Puppe.“
Ohne weiteres errät Werner den Zusammenhang und alles. „Ja, sicher war es ihre Puppe“, flüstert er, indes er das Lockenhaar streichelt und zum Fenster hinausblickt.
„Auf ihren Armen trug sie sie herum und sang dazu ihre Kinderlieder, ihre Wiegenlieder. Du weisst ja schon, wie die Mädchen mit ihren Puppen spielen. Die Mädchen reden mit ihnen, umarmen sie, küssen sie — alles genau so, als seien es ihre leiblichen Kinder. Sie weinen und lachen mit ihnen.“
Bald verliert Konrad seine Scheu, wird eifrig und gibt sich seinen Gedanken frei hin. Es wird ihm nicht bewusst, dass er da das erste, schüchterne Beben seines Herzens verrät. Er redet ja nur mit sich selber. Und es sind sehr schüchterne, unvollständige Sätze, leise gestammelte Worte, die ein einziges Mal ausgesprochen werden müssen, um von einem Menschen gehört zu werden.
Fast hätte man an ein Wunder glauben können; es schien, als wolle Konrad, aller Wissenschaft zum Trotz, gesunden, so blühten seine Wangen, so klar leuchteten seine Augen. „Diese Puppe ist doch gleichsam ein Stück von ihr selber, musst du wissen. Und gewiss hat Alma ihr eigenes Haar für sie hergegeben.“
Ach, Werner versteht ja das alles; dennoch wird es so sonderbar. „Sollte es wirklich ihr eigenes Haar sein?“ staunt er.
„Zweifle nicht! Du darfst nicht vergessen, dass sie keine Schwester hatte, niemand, mit dem sie spielen konnte. Deshalb musste sie alle ihre Liebe und Zärtlichkeit ihrer Puppe schenken. So sind sie nun einmal, die Mädchen“, schliesst Konrad wissend, mit einem wundersam schüchternen Lächeln.
„Ja, das mag schon sein. Die Mädchen haben merkwürdige Einfälle, ich kenne sie so wenig“, gesteht Werner.
Auf diesen Einwand achtet Konrad gar nicht, sondern redet weiter. Unhemmbar strömt das Geständnis über seine Lippen. Die grosse Einsamkeit seines Lebens, das Unglück, der nahe Tod, das alles veränderte ihn in eigentümlicher Weise. Es ist etwas Gewaltsames in seinem Bekenntnis. Eine junge Seele schreit auf, Konrads Knabenseele, die heilblieb, die keine Flamme zerstörte. Traumseligkeit umflort seinen Blick.
Wahrscheinlich verhält es sich ähnlich bei den Erwachsenen — und dann nennt man es Liebe, denkt Werner.
Konrad sagt: „Ich begegnete ihr einmal auf der Strasse. Ihre Mutter war dabei — es ist schon lange her. Sie trug damals noch ein kurzes Kleid und einen hellen Hut mit gelben Rosen darauf. Der Wind riss ihr den feinen Hut vom Kopfe, und ich lief ihm nach. Dabei wäre ich beinahe unter die Räder eines Wagens gekommen. Ich fiel hin, und mein Gesicht lag in ihrem Hut, der ganz voll war vom Duft ihres Haares. Aber ich zerdrückte ihn nicht, den Hut; ich brachte ihn ihr. Ihre beiden Hände streckte sie danach aus. Da verstand ich, dass sie ihn gern hatte.
‚Danke‘, sagte sie und schaute mich an mit ihren dunklen Augen. ‚Nun hast du dir das Kleid zerrissen und beschmutzt‘, sagte sie. ‚Sieh nur deine Ärmel — du blutest.‘
Das war der herrlichste Augenblick in meinem Leben. Sie trug weisse Handschuhe.
‚Tut es weh?‘ fragte sie.
‚Nein, gar nicht‘, sagte ich.
Dennoch berührte sie meinen Arm, fuhr mit ihren Fingern darüberhin und sagte: ‚Du hättest es nicht tun sollen. Fast wärst du dabei überfahren worden — nur wegen meinem Hut’, sagte sie.
‚Ja, wirklich‘, rief ihre Mutter, ‚du bist ein tapferer Junge. Wie heisst du? Konrad? Das ist ein hübscher Name‘. Ja, das sagte ihre Mutter und nickte mir zu.
Darauf sagte sie zu ihrer Tochter: ‚Nein, aber Alma, du hast dir deine Weissen Handschuhe blutig gemacht.‘
Alma lachte nur: ‚Ach, die Handschuhe — was hat das zu bedeuten?‘ Und immerfort schaute sie mich an.
Ihre Mutter öffnete ein silbernes Täschchen. Sie wollte mir Geld geben. Aber ich steckte meine Hände in die Hosentaschen. ‚Nimm es doch‘, sagte sie. ‚Was bist du denn für ein spassiger Kerl! Du hast ja mehr verdient, viel mehr.‘
Aber ich nahm das Geld trotzdem nicht. Darauf streckte mir Alma ihre Hand hin und bedankte sich noch einmal.“
Nun schweigt Konrad, den Blick auf die Puppe gerichtet, die in Werners bebenden Händen schaukelt und mit den Augen zwinkert. „Von dem allem hast du mir nie etwas erzählt“, sagt Werner.
„Nein, du — solches darf man überhaupt nicht erzählen, denn das ist ein Geheimnis“, meint Konrad. „Es ist das Allerschönste, das man erleben kann. Ich hätte es dir auch heute nicht erzählen dürfen, wenn ich nicht bald sterben müsste und wenn ich nicht sicher wäre, dass du es niemals verraten wirst. Aber, siehst du, seit jener Begegnung auf der Strasse lag es in meiner Brust wie ein heisser Stein. Ich musste immerfort an sie denken. Ich dachte an sie, wenn ich einschlief. Ein paarmal träumte ich von ihr. Ich ging an ihrer Seite durch einen schönen Garten. Sie stand neben mir vor einem Weiher. Im Weiher schwammen Goldfische. Sie trug wieder ihre weissen Handschuhe. Ein dunkler Fleck war darauf. ‚Das ist dein Blut‘, sagte sie und lächelte mir zu. Und dann war es so, als wolle sie mich etwas fragen. Aber ich erwachte.“
Ja, das muss die Liebe sein, denkt Werner ergriffen.
„Seither lebte ich nur in ihr. Ich schaute zu den Wolken auf, und in mir flüsterte eine Stimme ihren Namen. Überall hörte ich die Stimme flüstern, überall hörte ich ihren Namen — in den Wellen des Rheins, im Laub der Bäume. Ich habe ein paar Gedichte geschrieben.“
In ungläubigem Wundern horcht Werner auf, staunt mit offenem Munde.
Aber Konrad lächelt da wieder sein frühreifes, kluges Knabenlächeln. „Natürlich habe ich sie alle gleich wieder zerrissen und in den Wind gestreut. Lösch jetzt das Licht aus!“
Dunkelheit in der Stube. Aber von Konrads Gesicht geht ein wundersames Leuchten aus. Er schweigt. Und aus dem Schweigen wird eine weihevolle Stille. Eine hallende Stille wie in einer Kirche, wenn die Orgel verstummt. Vielleicht weht jetzt der Atem Gottes durch dieses Zimmer, in dem zwei Knaben ein seltsames Gespräch führten und in heller Kindergläubigkeit an die unlösbaren Rätsel des Lebens rührten.
Jung und uralt ist das alles; vom Tod gezeichnet und unsterblich. Konrad, dieser gefällte Baum, er liegt am Boden, und keine Gottesgnade kann ihn retten. Doch in seinem Blute kreist noch der ewige Saftstrom, der selbst den abgebrochenen Ast ein letztes Mal erblühen lässt.
„Ich bilde mir da gewiss nichts ein. Das darfst du mir ruhig glauben. Nein, nein, ich vergass keinen Augenblick, dass sie himmelhoch über mir steht und dass ich sie mit meinen Worten niemals erreichen konnte. Doch mit meinen Blicken und mit meinen Gedanken konnte ich sie erreichen. Das war mein Glück. Ich verlangte ja nicht mehr. Später ging sie noch einige Male an mir vorbei, und sie schaute mich an. Aber ich wagte nicht, sie zu grüssen. Dann blickte sie mich nicht mehr an. Sicherlich hat sie die Sache mit dem Hut längst vergessen. Sie würde mich wohl gar nicht mehr erkennen. Aber wenn ich ihr begegnete, war es doch stets ein grosses Erlebnis. Wir atmeten in derselben Luft. Und es durfte sogar vorkommen, dass ein feiner Wohlgeruch von ihr her bis zu mir drang.“
Auf einem Stuhl kauert Werner, die Puppe auf den Knien. Was sind das für merkwürdige Dinge, denkt er. Ist das dort wirklich noch immer Konrad, der mir all das erzählt?
„Ach, du, Werner, wie sind die Menschen doch verschieden untereinander! Gar viele Arten von Menschen gibt es — die meisten sind schmutzig und gemein; aber einige sind so rein und edel wie die Engel im Himmel.“
Hier bricht Konrad jäh ab, streckt sich auf seinem Lager. Die Eisenspiralen in der Matratze knarren hässlich. „Leg sie jetzt weg. Verbirg sie gut. Ich muss noch an so vieles denken.“
„Soll ich wieder Licht machen?“
„Nein, lass nur. Ich seh’ so gern die Nacht herankommen. Schieb die Gardinen zurück. Ich möchte die Bäume sehen. Vielleicht steht schon der grosse, helle Stern zwischen den Tannenwipfeln. Geh jetzt!“
Werner geht in den dunklen Garten; er geht in den hintersten Winkel zur Bank an der Mauer. Sein Herz ist gross und schwer von unerhörter Trauer und von unerhörtem Wundern. Er ist wohl noch zu jung, um Konrads Erzählung ganz zu erfassen, dieses hilflose Gestammel einer unerfüllbaren Sehnsucht am Rande des Grabes. Er ahnt höchstens die dunklen Mächte, die das Menschenherz bewegen im Verlangen und im Verzicht. Nur das eine ist ihm verständlich: Dort hinten im Hause liegt Konrad. Er wird nie mehr aufstehen. Er wartet auf den Tod; Konrad — jetzt redet er so verwunderlich vom Leben, von der Liebe, von einem Mädchen und einer Puppe ...
Werner denkt: Ich habe ihn von jeher verstanden und gern gehabt. Ihn hatte ich am liebsten von allen. Er ist gut und unendlich treu — aber heute erschien er mir fremd und unbegreiflich. —
Vorhin am Krankenlager, als Konrad seine Geschichte erzählte, als er in unwiderstehlichem Drang den Inhalt seines Lebens ausgoss, durchrieselte ein Schauer Werners Körper vom Scheitel bis zur Sohle. Deshalb bebte die Puppe in seinen Händen und blinzelte. Seine Hände glichen den Halmen am Stromufer, wenn der Märzwind darüber hinfährt. Irgendwie erriet er die tiefe Wahrheit hinter Konrads Worten, die Wahrheit von der Liebe der Menschen ...
In Werners Seele kommt ein helles, fernes Klingen ... Weit dort hinter der Mauer, weit hinter allen braunen Nachtwolken zieht ein strahlender Feenwagen vorüber. —
Rings um alle Bäume und Büsche wachsen die Schatten. Die Nacht breitet ihren dunklen Mantel über der Erde aus. Durch den Garten dringt eine weiche Melodie — A — aa — oh ... Das ist des Italieners Barrenti Gesang. Eine volle, schöne Stimme — ein Bauernlied, ein Liebeslied aus der Heimat jenseits der Alpen vom azurblauen Lago di Como. Das Ende der Strophen hält er stets lange aus — aaa — oh ... Es schwebt durch die Dunkelheit wie der Lockruf eines Fabelwesens, das verborgen in schwarzen Bäumen sitzt.
Aber vor Werners Auge tritt aus den Schleiern des nächtlichen Gartens, aus dem schweren Wolkenhimmel, blitzhell ein Fenster, an dem zwei Menschen stumm, in wahnsinnigem Vernichtungswillen miteinander ringen — ein Mann und ein Weib ...
Wie unter der Wucht eines gewaltigen Faustschlags sinkt Werner vornüber. Er vergräbt das Gesicht in den Händen und schluchzt.