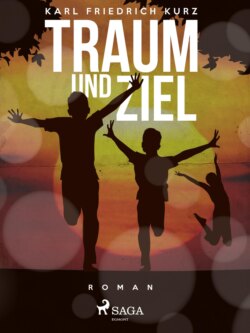Читать книгу Traum und Ziel - Karl Friedrich Kurz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Glück
ОглавлениеDie Brüder fanden Werner am Stamm des alten Kastanienbaums, aus dessen dunkler Krone die braunen, blanken Früchte niederfielen, obschon sich kein Windhauch regte. „Was treibst du?“ fragten sie. „Jetzt wollen wir das Haus untersuchen!“ riefen sie und hüpften von einem Bein aufs andere. „Komm ...“
Sie liefen durch alle Räume vom Keller bis zum Estrich, wie Diebe, wie Forscher, wie Eroberer. Wo eine Tür sich fand, wurde sie geöffnet. In jedem Winkel suchten sie das Abenteuer und fanden es. Manches, was den forschenden Blicken der Obrigkeit verborgen blieb, das stöberten acht scharfe Knabenaugen auf. Beutegierig fielen sie überall ein, Sieger in Feindesland. Sie trommelten mit ihren Fäusten gegen die Wände und entdeckten geheime Schränke hinter den Tapeten. Es war eine Fahrt in eine neue Welt, ins Märchenland, ins Niemandsland. Eine herrliche Stunde. Wohl ward ihnen nicht beschieden, grosse Reichtümer zu erobern. Aber Emil fand einen Hammer und eine verrostete Säge.
Die unsichtbaren Mächte, die aller Wissenschaft zum Hohn im verborgenen die Welt regieren, führten Werner in des toten Herrn Bondorfs Kontor, zum breiten Fenstergesims, das sich hochheben liess. Da lag eine Menge weisses Papier, grosse und kleine Blätter, und Farbenstifte. Da lagen ein paar merkwürdige Zeichnungen. Verwunderliche Zeichnungen; sie glichen Geldscheinen, riesenhaften Banknoten; bald eine Vorderseite, bald eine Hinterseite.
Was? Sollte der selige Herr Bondorf in den Tagen, als der Weinhandel flau ging, sich mit solchen Spielereien die Zeit vertrieben haben? Nummern, Namen, Unterschriften — Hundert Franken zahlt die Bundesbank dem Überbringer in Gold ...
Werner schob die überlebensgrossen Banknoten in eine Spalte zwischen dem Paneel. Heisse Freude im Herzen, zog er mit Papier und Stiften davon; gerade in dem Augenblick, da Arnold im Nebenzimmer einen schmetternden Jubelschrei ausstiess, denn er hatte zwei Kistchen Zigarren mit Bauchbinden gefunden.
Aber Konrad fand ein Geheimnis, etwas, das er schnell unter seinem Kittel verbarg und damit verschwand.
Es wurde der glücklichste Morgen im Leben der vier Knaben. Und aus dem Morgen wurde ein glücklicher Mittag. Emil fand zu seinem Hammer in einem der oberen Lagerkeller ein leeres Fass, das herrlich nach süssem Wein und verbotenen Genüssen duftete.
Gemeinsam wälzten sie das Fass ans Ufer des Rheins, in ein Akaziengestrüpp, das für gewöhnliche Menschen und jedenfalls für Erwachsene völlig unzugänglich und somit zu geheimem Treiben hervorragend geeignet war. Emil schlug mit seinem Hammer ein paar Reifen los, schlug den Boden ein. Da zeigte es sich, dass das Fass noch nicht völlig leer und unschuldig war. Eine braungoldene Flüssigkeit, herrlich und süss nach Blüten und Sonne duftend, schimmerte auf dem Grunde. Nicht viel, keine Eimer oder Kannen voll; doch immerhin genug, es mit einer leeren Blechbüchse auszuschöpfen.
„Vielleicht ist es Gift“, meinte der besinnliche Werner. „Wirf es weg, Emil!“
„Wegwerfen? Bist du bei klarem Verstande, Mensch?“ widersprach Emil unternehmungslustig. „Ja, das sollte nur fehlen, Mensch. Ich kann dir soviel verraten, dieses ist der herrlichste Wein von der Welt. Königswein.“ Emil spuckte zischend durch die Zähne und behauptete: „Gift, lieber Mensch, riecht meiner Seel nicht so, sondern anders. Versuch du es zuerst, Arnold!“
Der kleine, dicke und rothaarige Arnold glaubte mit seinen acht Jahren nicht an Gift und Tod und die unzähligen Gefahren des Lebens. Oh, im Gegenteil. Ihm bedeutete es eine Auszeichnung, als erster zu trinken.
Werner rief ängstlich: „Trink nicht!“
Bis dahin beteiligte sich Konrad nicht an der Untersuchung des Fasses, sondern lag nur auf dem Rücken und schaute verträumt in den Himmel, der sich zwischen dem Gewirr der Akazienzweige öffnete. Vielleicht erblickte er dort eine Himmelsleiter, und sicherlich war er fern den Begebenheiten dieser Erde. Erst Werners aufgeregtes Rufen zog ihn zurück zu den gewöhnlichen Dingen. „Lass ihn doch“, sagte er gleichmütig, ohne den Kopf zu drehen. „Es ist Malagawein.“
„Wer behauptet das?“ fragte Emil verblüfft.
„Das steht eingebrannt im Fassboden.“
„Hurra — gib die Büchse her!“ schrie Emil und entriss sie Arnolds Händen. „Ja, natürlich ist es Malagawein. Das hab’ ich gleich gewusst.“ Nun trank Emil zuerst und in langen Zügen. Er verdrehte dabei die Augen vor Wonne. „Nein, Mensch — dass es so guten Wein geben darf“, jauchzte er. „Bring jetzt deine Zigarren, Arnold“, befahl er. „Denn jetzt soll hier ein Jubiläum abgehalten werden.“
Sie tranken wie Männer und rauchten wie Männer. Und eine Weile mundete ihnen dieses Treiben ausgezeichnet. Bis Arnold sehr weiss im Gesicht wurde und ins Gras sank. „So — jetzt sterbe ich“, stöhnte er, warf die prächtige Zigarre fort und erbrach sich furchtbar.
Emil beobachtete ihn ängstlich und erklärte: „Ich glaube, auch mir wird übel ... Es war also doch Gift! Wenn wir jetzt sterben müssen, ist es deine Schuld, Konrad.“
Aber Konrad befand sich wieder auf der Himmelsleiter; ausserdem hatte er schon einige Erfahrung gesammelt im Leben. Beschwichtigend erklärte er: „Das kommt vom Rauchen. Bleibt ein Weilchen ruhig liegen, dann wird euch wieder wohler.“
Sie lagen unter den Akazien und stöhnten. Sie bezahlten ihre grosse Freude. Doch sie starben nicht daran.
Gegen den Abend hin kehrten sie ins Haus zurück, auf wackeligen Beinen, mit grünen Gesichtern. „Allmächtiger Himmel — wie seht ihr aus!“ riefen die Frauen.
„Ho — das ist schon gar nichts mehr“, erklärte Emil. „Ihr hättet uns früher sehen sollen! Wir haben nur ein paar unreife Äpfel gegessen.“
Hierauf kehrte Hannes Frank von seinem Dienst zurück und vernahm das von den Äpfeln. Als Mann und Herrscher rief er: „Ich hätte grosse Lust, euch alle vier gründlich zu verhauen, damit in Zukunft die Äpfel an den Bäumen hängen und reifen können. Was seid ihr doch für verfluchte Taugenichtse.“ Nach seiner Gewohnheit ass er schnell, redete sich nebenbei in Wut und geriet in die rechte Stimmung.
Um den Vater von seinem Vorhaben abzulenken, rief Emil: „Wir haben viele gute Sachen gefunden.“
„Was habt ihr gefunden?“
„Werner fand eine Menge Papier und Farbenstifte.“
„Papier!“ sagte Hannes Frank verächtlich. „Wartet nur, ihr Schlingel, bis ich fertig bin ...“
„Und Arnold fand zwei Kisten Zigarren.“
„Hol sie!“
Willig lieferte Arnold seine Zigarren ab. Sein Herz hing nicht länger daran.
„Das sind feine Zigarren“, nickt Hannes Frank versöhnlich. „Aber ich verhau’ euch doch. — Sonst noch etwas?“
„Ein Hammer und eine Säge.“
„Gut. Her damit!“
Der rote Arnold starrte auf des Vaters Teller, der schon fast leer war; verzweifelt rief er mit seiner kleinen Krähstimme: „Konrad hat etwas anderes gefunden.“
Tiefe Stille um den langen Tisch. Alle Augen richteten sich auf Konrad. In kalter Ruhe fragt Hannes Frank: „Was hast du gefunden?“
Da wird Konrads Gesicht dunkel; gleich darauf wird es noch bleicher als gewöhnlich. Arnold senkt den Kopf und schweigt.
„Komm doch einmal zu mir herüber, Bürschlein!“ befiehlt Hannes Frank unheimlich leise.
Sogleich lässt Konrad den Löffel in den Teller fallen und erhebt sich. Mit kurzen, ungelenken Schritten schleicht er der Wand entlang, und es läuft ein heftiges Beben durch seinen mageren Körper.
„Er hat nichts gefunden. Ich habe nichts gesehen“, ruft Werner angstvoll. „Ich war die ganze Zeit bei ihm.“
Zu seinem Unglück sitzt Werner an der Seite des Vaters, darum erhält er den ersten Schlag, so dass vor seinen Augen rote Funken stieben. Werner presst beide Hände vors Gesicht. Aber in seine Ohren dringt die fürchterliche Stimme des Richters: „Wer hat dich gefragt, Strolch?“ Und nun ist Hannes Frank mit dem Essen fertig. Er säubert den Löffel mit der Zunge, schmatzt und richtet den Blick auf Konrad. Fast gemütlich fragt er: „Nun, Jüngling, wie steht es mit deiner Zunge? Ich werde sie dir wohl lösen müssen.“ Dabei löst er selber den Leibriemen. „Also ...“
„Nichts“, flüstert Konrad kaum vernehmlich.
„Seht — hier steht der Lügner!“ Förmlich frohlockend ruft Hannes Frank — und eigentlich gilt das der Schwägerin Elisa für ihre Bemerkung vom Morgen, die noch nicht vergessen ist. Hannes streckt seine Faust nach dem schlotternden Opfer, dreht es um. „Seht euch ihn an! Seht euch ihn genau an, von allen Seiten, ihn, dem wir soviel zu danken haben.“
Neugierig starren alle auf Konrad. Nur Werner presst seine Hände vor die Augen, und die Tränen rinnen ihm zwischen den Fingern hervor, die Arme entlang.
„Ich frag’ dich zum letztenmal: Was hast du verborgen?“
„Nichts.“
Hannes Frank schlägt zu. Der breite, schwarz und glatt gescheuerte Riemen saust zischend durch die Luft und klatscht auf Konrads Rücken, auf seine Hüsten und Beine.
Am anderen Ende des Tisches beginnt Arnold zu heulen, blechern, verzweifelt. „Oh, oh, oh ...“ Arnold windet sich, als träfen ihn die Schläge. Aber Konrad gibt nicht einen Laut von sich, macht keine Bewegung; nicht einmal den misshandelten Rücken zieht er ein. Nur seine blauen Augen hebt er auf zu Hannes Frank, den mehr und mehr der Zorn fortreisst. Konrad blickt seinen Richter seltsam fragend an, furchtlos, mit flimmernden Augen und einem unerklärlichen Ausdruck im totenblassen Gesicht; doch kein Wort und kein Zeichen. Er scheint die wuchtigen Schläge gar nicht zu fühlen. Gott weiss, vielleicht lächelt er irrsinnig.
„Gesteh die Wahrheit!“ brüllt Hannes Frank, hält einen Augenblick inne und gibt dem Sünder noch eine letzte Frist.
Nichts.
Möglicherweise geschah es ohne Absicht, ohne Überlegung; aber der Leibriemen sauste von hoch oben herab, mit der blanken Schnalle voran. Die Eisenschnalle traf Konrad an die Schläfe mit merkwürdig hartem Aufschlag. Rotes Blut floss über die eingesunkene Wange. Auch jetzt noch kein Laut. Das wurde unheimlich; Hannes Frank selber, der einzige und allmächtige Mann in dieser Stube, schien sich zu fürchten vor dem stummen Knaben. Wahrscheinlich brüllte er deshalb so gewaltig. Und es kam ihm wohl nur gelegen, dass die Frauen endlich von allen Seiten herbeisprangen, ihn umringten und seine Arme niederdrückten.
Im allgemeinen Tumult entkamen die Knaben.
Arnold und Emil verkrochen sich in ihren Betten, im grossen, prächtigen Saal, bei den lächelnden Göttinnen. Werner lief zum Haus hinaus.
Der Mond war aufgegangen. Riesengross schwebte er über dem Dächergewirr der Stadt. Werner lief durch den Garten und suchte den Schatten der Bäume. Wo war sie nun, die helle Freude des Morgens? Wo war es, das Glück des Mittags?
Auf der hohen Mauer, die steil zum Wasser niederfiel, sass Konrad und schaute hinaus in die unbegreifliche Welt mit ihren Wundern und Schrecken. Völlig unbeweglich sass er; ein Stein auf den vielen Steinen der alten Mauer. Er drehte nicht einmal den Kopf, als er leise Schritte hinter sich vernahm, als eine bebende, eine zagende Hand sich unter seinen Arm schob. Jetzt waren es zwei Steine, die die vermooste Mauer um ein geringes überragten, zwei kleine, verschüchterte Menschenwesen, unendlich verlassen in der stillen Nacht.
Tief unten plätscherte der Rhein; es gemahnte an weinerliches, schläfriges Kindergemurmel. Als ein paar gezackte Kreidestriche hoben sich die langen Häuserreihen am anderen Ufer aus dem blaudunklen Himmel. Mondlicht flackerte in unruhigen Bändern und Ringen am Fuss der Böschung, legte sich silbern um schwarze Steine. Stille war und tiefer Friede überall.
Eine verhaltene Stimme fragte: „Aber du hast doch etwas weggetragen — nicht?“
„Ja.“
„Was war es denn?“
„Frage nicht. Ich kann es nicht verraten.“
„Nein, nein.“
Schweigen und sanftes Wellengemurmel. Das Mondlicht fällt auf Konrads Gesicht und zeichnet deutlich die dunkle Blutlinie, die von der Schläfe über die Wange hinläuft bis hinunter zum Hals.
„Ich werde Wasser holen und ein Tuch. Ich will es abwaschen.“
„Lass es nur“, sagt Konrad fast feierlich. „Das tut gar nicht weh. Und wenn er mich umgebracht hätte, würde ich nichts verraten haben.“
In stummer Bewunderung schaut Werner auf zu dem Pflegebruder, der ein Geheimnis hat; ein Geheimnis, für das er leiden und sterben will. Das Dasein wird auf einmal gross und voll dunkler Tiefe. „Arnold meinte es nicht böse, verstehst du. Er verplapperte sich nur aus Angst, denn er ist noch so klein und dumm ...“
„Ach Arnold“, seufzt der merkwürdige Konrad und lächelt dabei.
„Warum muss er immer so roh und gemein schlagen? Uns zu schlagen ist keine Heldentat; er weiss ja, dass wir uns nicht wehren können.“
„Dein Vater? Er versteht das wohl nicht besser. Sicher hat er selber als Knabe viel Prügel bekommen. Nun meint er, die Reihe sei an ihm, zu schlagen. Die Grossen schlagen die Kleinen. So muss es stets sein. Was meinst du?“
„Ich weiss nicht ...“
Es reden nun diese beiden verprügelten Knaben und unterhalten sich über die mangelhafte Einrichtung dieser Welt. Altklug sind sie beide, durch Not und Bitternis frühreif geworden. Sie haben einen scharfen Blick für das Wesen der Menschen und der Dinge.
„Und das, was er über die Wandgemälde sagte, ist nichts als Unsinn“, meint Konrad. „Es sind Darstellungen aus der Götterlehre der alten Römer. Eins davon ist bestimmt die Jagd der Diana.“
„Ist das sicher?“
„Ja. Ich habe ein ähnliches Bild im Museum gesehen. Wenn du willst, können wir am nächsten Sonntag hingehen; da ist es für jedermann geöffnet und kostet keinen Eintritt.“
So schnell wird das Übel überwunden und vergessen. Diese zerbrechlichen Menschenfigürchen haben Stahlfedern im Leib. Sie werden zu Boden geworfen und flachgedrückt; aber kaum lässt der Druck nach, fahren sie leicht wieder in die Höhe.
„Im Museum — sind dort richtige Bilder?“
„Ja. Gemälde berühmter Künstler.“
„Von Raffael?“
„Ach, das war ja nur einer von vielen, und er ist längst tot. Natürlich konnte er allein nicht tausend Zimmer ausmalen. Dein Vater weiss wenig; aber er schwatzt viel.“
„Glaubst du, dass ich ein berühmter Maler werden kann?“
„Freilich — warum nicht ...“
„Ich glaube es.“
Aber hierauf sagt Konrad etwas, was ganz und gar nicht zu dieser Sache gehört; er blickt den Mond an und sagt: „Ich wundere mich, in welchem Zimmer sie schlief ...“
„Wer?“
„Die Waise.“
„Sie schlief gewiss bei ihren Eltern.“
„Nein, sie hatte ein Zimmer für sich allein. Sie waren doch sehr vornehme Leute, musst du begreifen ...“
„Warum willst du wissen, wo sie schlief?“
„So ... Sie ist immer allein und still und traurig. Nie kommt sie auf die Strasse hinaus zu uns anderen. Nur hinter dem Eisengitter steht sie. Aber sie lacht und kreischt nicht wie andere Mädchen. Ich habe Purzelbäume vor ihrem Tor geschlagen ...“
„Sie ist ein schönes Mädchen“, meint Werner bedächtig.
„Ich kann dir nur versichern, dass sie das schönste Mädchen der Stadt ist. Ja, vielleicht gibt es nicht ihresgleichen in der ganzen Welt. Sie steht himmelhoch über uns ...“
Damit endete das nächtliche Gespräch auf der hohen Mauer über dem Rhein. Die beiden Knaben sassen noch lange schweigend nebeneinander, jeder mit seinen eigenen Gedanken.
Der Mond streute grüngoldenes Licht auf die Erde. Der mächtige Strom rauschte mit seinen Wellen.