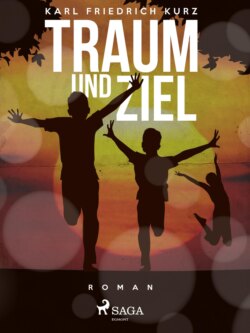Читать книгу Traum und Ziel - Karl Friedrich Kurz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Versprechen
ОглавлениеUnd da war nun dieser grosse, gesegnete Garten. Die Früchte an den Bäumen reiften allmählich und konnten gepflückt werden; ein grosses Ereignis für die Knaben, die solches zum erstenmal erlebten.
Im Garten gab es einen Hügel, der einst dadurch entstanden, dass das viele Erdreich beim Ausgraben der mächtigen Kellereien dort abgelagert worden. Auf dem Hügel wuchsen Tannen, schlanke, hohe Stämme, deren Wipfel im Herbstwind sangen und sachte hin und her schwankten und aus deren dichten Zweigen es dunkel rauschte und lockte.
Der Garten gehörte jetzt den vier Knaben. Er durfte wachsen und alt werden, ehe er ein paar Menschenherzen erfreute. Früher war es ein vornehmer und stiller Garten. Die stolze Frau Bondorf spielte als Kind darin. Sie wurde im Ritterhof geboren und erbte ihn nach ihrem Vater, dem Herrn Kesser, der ein wirklicher Weinhändler gewesen und überhaupt eine glückliche Hand hatte, so dass er Geld auf Geld häufen konnte.
Auch das Töchterchen Alma spielte hier. Auf den Hellen Kieswegen machte es die ersten Schritte seines Lebens, allein, still, fern vom Lärm der Stadt. Im Grunde blieb es doch so unbegreiflich, warum der unglückselige Herr Bondorf das viele, viele Geld nicht behalten durfte; warum er nicht in diesem Garten mit seiner schönen Frau glücklich sein und grau und alt werden durfte. Die Leute behaupten jetzt, dieser Herr sei kein rechter Patrizier gewesen. Er stamme von irgendwo her, von jenseits der Grenze, vielleicht von Spanien oder Peru. Sie nennen ihn nachträglich eine mystische Person. Eine gelbe Haut hatte er; dunkle, feurige Augen hatte er. Diese heissen Augen betörten die reiche Tochter.
Zweifellos leben auch in anderen Städten vornehme Leute. Aber wozu brauchten die Bondorfs vier oder sechs Pferde auf einmal und verschiedene Wagen und zwei Kutscher? Viel Unerklärliches haftete diesen Menschen an.
Jeden Morgen ritten sie miteinander durch die Strassen. Und soweit die gewöhnlichen Leute sich auf Pferde verstehen konnten, ritt Herr Bondorf auf einem echten Araberhengst. Das Töchterlein Alma aber ritt auf einem braunen Pony und war überaus niedlich. Die Knaben standen mit offenen Mündern am Wegrand — genau dieselben Knaben, die jetzt im schönen Garten lärmten.
Die Bondorfs trieben es doch gar zu toll mit Luxus und Verschwendung, mit Gärtnern und Kammerzofen und Gott weiss was. Sie gaben glänzende Feste. Wollten sie vielleicht dadurch aller Welt beweisen, dass der zugereiste Herr Bondorf kein Habenichts, kein Abenteurer oder Zirkusmensch war? Und da endlich alle Welt glaubte, dass Herr Bondorf ein richtiger Hidalgo sei, drehte er selber den Gashahn auf. So ungefähr hing das zusammen; und es war grauenhaft und ein wenig lächerlich. Deshalb überwucherte jetzt Unkraut die hellen Wege. Konrad benahm sich als der Gesittetste, er setzte sich hier und dort auf eine Bank und blickte den Wolken nach, die über die Tannenwipfel zogen. Er allein konnte die Büsche und Bäume beim rechten Namen nennen. Der rote Arnold verstand sich eben erst aufs Obstessen, und Emil, der unruhige Geist, erfand jeden Tag neue Spiele, neue Teufeleien. In dieser Beziehung war er ein Genie und der geborene Anführer.
Aber Werner zeichnete, unbeholfen, doch in tiefer Andacht. Kleine Werke, ein knorriger Baumstamm vielleicht, ein paar Zweige, einen Stein mit dunklem Schatten dahinter. Und zuweilen kletterte er auf eine Tanne.
In diesem Knaben wohnten zwei Seelen, eine verschüchterte Träumerseele, die aus verborgenem Winkel hervor die mannigfaltigen Bilder der Welt erschauernd in sich aufnahm. Doch er liebte in gleicher Weise die Stille und die Gefahr.
Von den höchsten Wipfeln der Tannen tat er einen Blick in die Nachbargärten, auf das Dächergewirr der Stadt und hinaus in die grosse Ebene, an deren äusserstem Rande der mächtige Rhein als flimmernde Linie verschwand. Eine frischere Luft wehte. Die Menschen in den Strassen erschienen klein und in ihrer Gestalt wunderlich verzerrt. Als Kegel schoben sie sich vorwärts, mit hastigen, komischen Bewegungen; ja selbst ihre Stimmen klangen befremdlich. Manchmal schwirrte ein kleiner Vogel nahe vorbei, und der Windzug seines Schwingenschlages streifte Werners Gesicht. Vom Menschenstrom in fernen Gassen stieg dumpfes Brausen über die Dächer. Eisenbahnzüge fuhren in die Ebene hinaus, schrill pfiffen Lokomotiven; der Wind trug ihr Rasseln und Schnauben heran, bald stärker, bald schwächer. Ein endloses Kommen und Gehen, ein ungeheurer Wille zum Leben, und jähe, erschreckte Stille dazwischen. Nichtig schienen die Menschenfiguren in all dem Dröhnen, Kreischen, Klirren und Rasseln, das sie doch selber erzeugten ...
An den obersten Wipfel der höchsten Tanne klammerte sich Werner, überrascht und erschüttert von der Grösse der Welt. Gleich den vorbeihuschenden Vögeln stiess er helle Jubelschreie aus.
Er sollte jäh aus seinem Höhentaumel gerissen werden. Hinter dem dicken Wall der tausend Äste hervor rief eine fürchterliche Stimme: „Was treibst du dort oben, verdammter Schlingel?“
Der Himmel verfinsterte sich, die Ferne verblasste, die tausend Geräusche der Stadt verstummten ...
Dort unten irgendwo, verborgen hinter dem wunderfeinen Gewirr der duftenden Tannennadeln, lauerte schreckhaft wie das Verhängnis der Vater, der Herr über Leben und Tod, der erbarmungslose Richter, dessen Hand stets bereit war, zu strafen. „Komm sogleich herunter!“ wurde befohlen. Eine kalte Welle der Angst strömte Werner entgegen. Ein Schauer lief durch seinen Körper. Hart klopfte ihm das Blut im Halse. „Dir werde ich die Ohren ausputzen ...!“
Vor wenigen Augenblicken noch jubelte Werners Herz, und er war glücklich und frei und unmenschlich reich. Die Stimme des Vaters verwandelte ihn zu einem armseligen Häuflein Furcht. Doch überraschend kam eine unbändige Auflehnung gegen diese rohe Gewalt über ihn, ein wilder, sinnloser Trotz. Sich selber fremd, rief er: „Ich komme nicht. Nein. Und es ist mir gleichgültig, ob ich herunterfalle und sterbe ...“
Worauf eine betäubende Stille eintrat. Der Vater entfernte sich ein Stückweit, um seinen Sohn, der solches wagte, zu betrachten. Am Rande eines Rosenbeetes tauchte er auf, klein und rund, ohne Beine, nur die Füsse standen ihm unter dem Bauch hervor, eine Brust mit einem roten, zornigen Gesicht darüber. Der blanke Schild seiner Mütze funkelte in der Sonne, und die Trillerpfeife hing wie ein Orden an seinem Rock. „Du kommst nicht? Was sagst du?“
„Versprich mir, dass du mich nicht anrührst. Sonst bleibe ich hier oben.“
Dieses war das erstemal, dass Werner es wagte, dem Vater zu widersprechen. Er fühlte sich sicher und überlegen in seiner Höhe. Er schaukelte sich hin und her. Der schlanke Tannenwipfel bog sich unter ihm, es knisterte und raschelte in den Zweigen. Der Tannenwipfel bog sich einem anderen Tannenwipfel entgegen. Werner liess los, sauste mit ausgebreiteten Armen durch die leere Luft, griff zu und wiegte sich wieder. Ein paar Äste krachten; ein paar Schrammen an Gesicht und Händen. Das Spiel war schön. Ein herrliches, ein gefährliches Spiel, noch dadurch erhöht, dass tief unten der gefürchtete Mann stand und in ohnmächtiger Wut seine beiden Fäuste emporstreckte.
Von Wipfel zu Wipfel sprang Werner, leicht und sicher; ihm war, als brauche er nur seine Arme auszubreiten, um wie die Vögel durch die Luft zu schweben, hoch über die Erde und den erzürnten Vater hin, in die blaue Ferne hinaus.
Trotzdem meinte der Vater es gut auf seine Weise; er verstand nur so gar wenig von dem, was in der Seele seines Sohnes lebte. Nach alter Überlieferung meinte er, es genüge, streng zu herrschen und hart zu züchtigen. Er meinte, damit sei schon alles getan. Aber als er seinen Sohn, einem Eichhörnchen gleich, von Baum zu Baum springen sah, wurde ihm ein wenig schwindlig, und er rief mit milderer Stimme: „Lass das jetzt, du! Komm nur herunter. Ich tu dir für diesmal nichts.“
„Versprichst du mir das?“
„Jawohl — hörst du ...“
Ei, das war ein völlig ungewohnter Ton. Es klang ähnlich einer Bitte. Werner traute dieser Milde nicht und blieb zurückhaltend. „Soll das wirklich ein Versprechen sein?“ fragte er.
„Ja, was denn sonst?“
„Ein Versprechen muss man halten ...“
„Schwätz nun nicht länger und komm herunter!“
„Gut. Ich glaube dir.“
Die blanke Schirmmütze und das rote Gesicht verschwanden hinter dem Gewirr der Tannenäste. Werner meinte, der Vater sei ins Haus gegangen und das kleine Abenteuer beendet.
Darin irrte er sich. Der Vater lauerte hinter einem Busch verborgen, und noch ehe der Sohn den Erdboden erreichte, wurde er von kräftiger Faust im Nacken erfasst. Ein Leibriemen schwirrte in der Luft, der kühne Sohn wurde furchtbar verhauen. Über ihm keuchte eine wütende Stimme. „Das ist für deine Kletterei. Und das ist für dein freches Maul. Ich will es dir dick aufstreichen. Daran sollst du dein Leben lang denken ...“
Als der Riemen ihm entglitt, schlug er mit blosser Hand weiter. Und gewiss meinte er es noch immer gut auf seine Weise. Er liess den Sohn zur Erde fallen und erklärte schnaufend: „Wer sein Kind liebt, der züchtiget es.“
Während er den Leibriemen umschnallte, wiederholte er: „Jawohl — der züchtiget es bald.“ Worauf er ein paar Schritte machte. Dann drehte er sich um und sagte: „Und jetzt ins Bett mit dir, du Strolch. Abendbrot gibt es heute nicht. Verstanden?“ Nun erst ging er ins Haus.
Hannes Frank ahnte nicht, was er angerichtet. Er ahnte nicht, dass Werner sein Leben lang diese Stunde nicht mehr vergessen konnte. In Werner war etwas sehr Kostbares zerbrochen.
Eine flammende Empörung beherrschte ihn völlig. Er liess sich schlagen, und kein Laut kam über seine Lippen. Es war genau so, wie Konrad es in einer Mondnacht auf der Strandmauer schilderte: er hörte die Schläge, aber fühlte sie kaum. Was ihm damals unglaubhaft erschien, das hatte er nun selber erlebt.
Im Kreise standen stumm, mit verstörten Gesichtern, die Brüder. „Tut es sehr weh?“ erkundigte sich der rote Arnold, indes er seine eigenen Lenden rieb, und stöhnte: „Oh — oh ...“
Konrad beugte sich über Werner, hob ihm den Kopf, strich ihm das Haar aus dem Gesicht, ohne ein einziges Wort. Für Konrad blieb alles Erleben Schicksal, das er ohne Widerspruch erduldete, als etwas Unentrinnbares.
Schnaufend lief Emil herbei. „Der Tyrann sitzt in der Küche, frisst und flucht. — Werner, verschwinde! Wenn er dich sieht, haut er dich sicher noch einmal, denn er ist noch rasend. Hör nur, wie er brüllt, der Löwe ...“
Sie führten Werner durch den Haupteingang ins Haus. Konrad wusch ihm das Gesicht. Und Werner sagte noch immer kein Wort. Mit geschlossenen Augen lag er, und es war eine grosse Müdigkeit und unendliche Trauer in ihm.
Allmählich begannen die Schläge zu schmerzen. Werner feuchtete mit der Zungenspitze die trockenen Lippen an und merkte, dass sie dick geschwollen waren. Er dachte nur immer das eine: Er hielt sein Versprechen nicht! Und es war in ihm ein Entsetzen sondergleichen.
Sehr behutsam drehte er sich auf die Seite. Sein Rücken brannte wie Feuer. Das ganze Bett strömte unerträgliche Gluthitze aus. Aber Werners Herz zitterte vor Kälte. Und er öffnete die Augen und starrte zur Wand hinüber, zum Märchenwald mit den schönen Göttinnen und den Fabeltieren — in eine Welt, in der es keine Leibriemen und keine Gemeinheit gab.
In dieser Stunde hörte Werner Frank auf, ein Kind zu sein. Kaum dreizehn Jahre zählte er, als ihm sein Kinderglaube genommen wurde. Des Vaters Faust riss ihn aus der linden Sorglosigkeit der Jugend. Des Lebens Wirklichkeit richtete sich finster und drohend vor ihm auf. Das Band, das ihn an die Eltern knüpfte, hatte Hannes Frank durchschnitten. Dieses Band konnte nie wieder geknüpft werden. Voll unausdenkbaren Grauens fragte Werner: „Wer sind sie, diese Menschen? Was wollen sie von mir?“
Er glaubte, sie umständen alle sein Lager und schauten auf ihn nieder, wie er so zerschlagen und zerschmettert lag. Aber sie hatten fremde und lauernde Gesichter. Es war ein unfassbares, blitzhelles Durchdringen der Oberfläche. Alle wurden durchsichtig. Hinter ihren Augen sah Werner schattenhaft ihre geheimen Gedanken vorübergleiten. Ob dieser Erkenntnis gingen die Schmerzen seines wundgeschlagenen Körpers unter im Erschauern seiner Seele.
Oft bestimmen kleine und unbeachtete Begebenheiten den Lebenslauf der Menschen — Werner Franks wurde durch des Vaters Wortbruch aus der Gemeinschaft der Familie gelöst. Hinfort stand er ihrem Treiben fern ...
Schritte auf den Steinfliesen des Hausflurs. Schwere, klatschende Schritte. Werner kannte sie genau. Hart stiess die Ferse auf den Boden, darauf klatschte die Sohle. Es hörte sich an, als schritten zwei nebeneinander her.
„Plattfüsse“, murmelte Werner, zitternd wie im Fieber. Ein völlig neues Gefühl von Abscheu und Hass quoll in ihm auf. Er stellte sich vor, wie der Vater jetzt durch den hallenden Flur schritt, schmatzend nach dem Essen, satt, zufrieden, stumpf. Ein Dunst von Schweiss und Schmieröl umgab ihn, ein Geruch von sonnendurchglühten Eisenbahnwagen und kaltem Tabakrauch. Die Enden des langen Schnurrbarts hingen zu beiden Seiten des Kinns nieder und verbargen den Mund. Nie hat Werner seines Vaters Mund gesehen. Doch nun erkennt er sehr deutlich den Schnitt der Lippen ...
Ein fremder Mann. Ein Eisenbahner, er schreitet gegen die Landstrasse. Er öffnet das eiserne Gartentor. Untersetzt, schwerfällig. Sein Dienst ist, mit den Eisenbahnwagen zu manövrieren. Sie sagen, er sei Obmann einer Rangierabteilung. Er kommandiert über vier oder fünf andere Männer, die Schildmützen tragen und einen ähnlichen Geruch ausströmen. Hannes Frank heisst er, und seine fleischigen Hände baumeln ihm beim Gehen seltsam leblos aus den Ärmeln, gleich zwei gelben Sandsäcken. „Diese Sandsäcke waren es, die mich schlugen“, murmelt Werner. Auf einmal denkt er ohne Groll daran, es ist mehr ein Erinnern von weit her, als sei das einst einem anderen zugestossen. „An seinen schlaffen Händen würde ich ihn erkennen unter vielen Tausenden ...“
In einer Dämmerstunde hielt Werner Frank Abrechnung. An einem Samstagabend.
Am folgenden Morgen ging Werner mit Konrad in die Gemäldesammlung des Museums.
Er hinkte ein paar Tage lang und konnte den Rücken nicht strecken.
„Was fehlt dir?“ fragte der Lehrer.
„Ich kletterte auf einen Baum“, antwortete Werner.
„Haha — da fielst du natürlich herunter.“
Werner senkte den Kopf und schwieg. Eine alltägliche Sache. Durch Schaden wird man klug.
Nach ein paar Tagen spürte Werner Frank keine Schmerzen mehr, weder im Rücken noch in den Beinen. Nur der Riss in seiner Seele blieb. Er fiel aus grosser Höhe auf die harte, harte Erde.