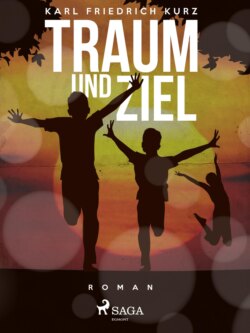Читать книгу Traum und Ziel - Karl Friedrich Kurz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Geist in der Flasche
ОглавлениеDie Geisterbeschwörung hatte einen plötzlichen Erfolg. Eines Nachts verstummte das Klopfen, und es trat Ruhe ein. Die Lohmanns horchten bestürzt. „Endlich haben wir sie erlöst“, sagten die Frauen ergriffen. „Und der Herr erbarme sich ihrer ...“ Sie sahen einander an und weinten vor Freude. „Amen.“
Aber Hannes Frank schnippte mit den Fingern. „Oha — hab’ ich das vielleicht nicht recht gemacht?“ fragte er. „Ging es vielleicht nicht genau nach meiner Berechnung?“
Hinfort steckten die beiden armen Seelen also in einer Flasche unter der gewissen Eiche im Hardwald. „Doch vergesst nicht“, sagte Hannes Frank, der Hexenmeister, „dass sie in jeder Vollmondnacht um einen Hahnenschritt zurückkommen werden. Erreichen sie erst das Haus, dann sei Gott uns allen gnädig.“
„Ach, bis dahin fliesst viel Wasser den Rhein hinunter“, meinten die Frauen unbekümmert. „Wenn wir doch auf unseren Füssen bis zur Eiche fast eine Stunde lang marschieren müssen“, lachten sie. „Übrigens wirst du dann sicherlich ein neues Mittel finden, du, Hannes.“
Kein Zweifel, es war eine grosse Tat. Nun war sie also vollbracht, von Hannes Frank, mit Zauberspruch, Totenschädel und Flasche. Das Gespensterklopfen im Haus hörte vollständig auf. Es verstummte in der Nacht, da der alte Klaus nach langem Suchen etwas fand.
Zäh und zuversichtlich klopfte der alte Klaus, und wo es in der Mauer einen hohlen Klang gab, brach er ein paar Steine aus. Eine schwere und mühsame Arbeit, die keiner dem wackeligen Männchen zugetraut hätte. Im untersten Keller, im hintersten Winkel traf er auf ein paar Steine, die sich fast von selber lösten. Dahinter lag ein kleiner Raum, eine Werkstatt. Die Laterne in des alten Klaus’ Hand schwankte und flackerte. Das war der Schatz.
Auf dem Tisch vor ihm lag Geld, es lag genau so da, als warte es auf ihn. Nicht gemünztes Gold, nein; aber auch kein kleines, gemeines Silbergeld, sondern Banknoten, reine, neue Fünfzigfrankenscheine. War es auch kein Riesenvermögen, das dem alten Klaus in die Hände fiel, so mochten es doch immerhin zwanzig, ja vielleicht auch vierzig Scheine sein. Seine mageren, verkrümmten Finger zitterten.
Sogleich verstand er, dass es sich hier nicht um ehrliches Geld handeln konnte, dass es schlimmes Geld sein musste; er erinnerte sich an das Gerede in der Stadt vom Umlauf falscher Banknoten. Aber Geld sei Geld, meinte der alte Klaus in der Einfalt seines Herzens. Wo in der Welt gibt es ganz gutes, ganz ehrliches Geld? dachte er wohl.
Diese Scheine hat sicherlich der selige Weinhändler Bondorf gemacht; da dieser Herr längst tot und begraben ist, gehören sie niemand. So ungefähr legte der alte Klaus sich diese Sache zurecht und steckte die Banknoten in seine Tasche. Hierauf schob er die Steine wieder an ihren Platz zurück und füllte alle Fugen mit Schutt und Staub aus. Reich und glücklich wie nie in seinem langen, mühsamen Leben legte er sich in sein Bett. Auch der alte Klaus hatte alle Ursache, sich zu freuen und auszuruhen nach einer grossen Arbeit.
Die Frauen aber und mit ihnen Hannes Frank erwarteten nun die Belohnung für das gute Werk. Sie mussten jedoch alsbald eine bittere Enttäuschung erleben. Denn zunächst erschien im Ritterhof Herr Mayer, der Besitzer, forderte die fällige Miete, und da sie nicht vorhanden war, drohte er, die Lohmanns aus ihrem Paradies zu vertreiben. „Spätestens in einer Woche muss das Geld abgeliefert werden“, erklärte er. Das hatten die Lohmanns also für ihre Mühe mit den Geistern.
Weiss Gott, es handelte sich um eine geringe Summe. Aber wo nichts vorhanden ist, ist selbst das Wenige noch zuviel. Die Frauen schauten einander wieder an, seufzten und klagten über die Härte der Menschenherzen.
Der alte Klaus vernahm dieserart die furchtbare Drohung, schwieg dazu und nickte, aber in seine grauen Augen kam ein heller Glanz. Verteufelt schlau stellte er es an. Er zerknitterte und beschmutzte die schönen Scheine und verlieh ihnen ein ehrwürdiges Aussehen. Nur ein paar davon gab er aus, zur Dämmerstunde, in entlegenen Stadtvierteln; er kaufte eine Kleinigkeit und sammelte gewöhnliche Silbermünzen. Nach wenigen Tagen legte er dem herzlosen Herrn Mayer den schuldigen Mietzins blank auf den Tisch und wurde zum Retter in der Not — Klaus, der Verachtete, von dem niemand Hilfe erwartete.
Das Leben ging weiter. Grosses und Kleines geschah. Unter anderem fand der Knabe Emil wieder ein Fass. Diesmal war es ein zuverlässig leeres Fass, das nicht nach Wein oder etwas Süssem roch. Emil rollte das Fass in den Garten, rollte es in geheimer Absicht bis zum Tannenhügel. Er behauptete, mit dem Fass liesse sich etwas unternehmen. Emils Tage waren bis zum Rande gefüllt mit Unternehmungen; wenige Dinge gab es zwischen Himmel und Erde, für die er nicht Verwendung zu finden wusste. Hannes Frank hatte die untersten Äste von den Tannen gesägt und auf einen Haufen geschichtet. Beim Anblick der schlanken Tannenäste verschob Emil sein Fassunternehmen auf spätere Zeiten und gab sich einer neuen Sache hin. „Wir werden ein Haus bauen“, erklärte er. „Es soll ein zweistöckiges Haus werden. Es muss eine Treppe haben.“
Sie befestigten die Äste mit Nägeln und Schnüren an vier Tannenstämmen, die in passender Entfernung voneinander standen. Sie bauten ihr Haus; sie bauten daran eine Woche lang. Und als es fertig war, mit Treppe und Fenster und allem, erklärte Emil, der Erfindungsreiche: „Gut. Jetzt wollen wir es anzünden.“
„Bist du verrückt?“ fragte Werner und widersetzte sich dem Brand.
Nun hatte jedoch Werner sich am Hausbau gar nicht beteiligt, denn Werner fürchtete sich vor dem Ausgang von Emils Unternehmungen. Trotzdem fragte er: „Wozu soll es denn verbrannt werden?“
„Es soll nicht verbrannt werden“, entgegnete Emil. „Wir wollen es nur so ein bisschen anzünden. Sobald es brennt, werden wir das Feuer löschen.“
Somit handelte es sich hier um ein ziemlich verwickeltes Unternehmen, das ausser Emil keiner begriff — jedenfalls begriff es weder Konrad noch Werner.
„Geht heim und legt euch!“ rief Emil. „Ihr taugt doch nicht zu einem anständigen Spiel. Geht nur und werft Ball mit den Mädchen“, höhnte er, indem er zischend durch die Zähne spuckte.
Also zogen Werner und Konrad sich zurück. „Viel Vergnügen und Glück auf den Weg!“ rief Emil ihnen nach. „Es gibt gottlob in dieser Welt noch Knaben genug, Knaben von der richtigen Sorte.“
Ja, gewiss gab es noch Knaben, die sich zu allem möglichen eigneten, zum Beispiel zu Feuerwehrmännern oder wiehernden Pferden. Dieser kleine Teufel von Emil kannte schon frühzeitig die Welt und wusste seine Leute zu finden. Die ganze Nachbarschaft wimmelte von mutiger Jugend. Emil spuckte wieder durch die Zähne. „Nun passt auf! Im ersten Stock sitzt ein Mann. Der Mann liest eine Zeitung und raucht eine Zigarre dazu. Mit der brennenden Zigarre zündet er die Zeitung an. Die Zeitung brennt; der Mann wirft sie fort. Dann brennt das Haus schon von selber. Wir aber kommen und löschen das Feuer, und ich rette den Mann. Zuerst müssen wir das Fass mit Wasser füllen, denn es ist unsere Feuerspritze.“
Fein erfunden. Der Plan gefiel den Knaben. Nur Konrad mischte sich nochmals in die Sache und schlug vor, das Haus ohne Brand zu bewohnen.
„Ja, das würde dir gleichen“, sagte Emil verächtlich. „Du würdest darin sitzen, bis du einen grauen Bart bekämst ... Überhaupt, was stehst du noch da herum? Merkst du denn nicht, dass du uns allen im Wege stehst?“
Hinfort gab es keine Rettung mehr. Das Haus musste brennen. Konrad und Werner gingen ans andere Ende des Gartens. Und Emil war, das versteht sich, der Feuerwehrhauptmann. Es setzte sich ein Mann in den ersten Stock, entfaltete eine Zeitung und zündete eine der prächtigen Bauchbindenzigarren an. Dieser Mann war der rote Arnold, weil kein anderer es sein mochte. Und Arnold machte es, so gut er konnte, hielt die glühende Zigarre gegen die Zeitung; doch es entstand nur ein Loch, ein Wölklein Rauch, aber kein Feuer. Deshalb musste Emil mit einem Streichholz ein wenig nachhelfen. Da gelang es über Erwarten. Die Flammen züngelten empor und prasselten. Eigentlich hätte Arnold jetzt vom Feuerwehrhauptmann gerettet werden sollen.
Emil kommandierte fürchterlich, fluchte und rief die Spritze herbei. Doch der Brand gelang nur allzu gut, schon brannte die Treppe, alle Wände, das Dach. Überall prasselte es, und der rote Arnold schrie so echt und entsetzlich, dass die Feuerwehr Fass und Spritze im Stiche liess und die Flucht ergriff.
Der kleine, dicke, rote Arnold hätte sicherlich den Flammentod erleiden müssen, wenn nicht Konrad und Werner sich doch noch am Spiel beteiligt hätten. Sie zogen Arnold an den Beinen durch den Boden Hinab, klopften ihm die Funken aus Haar und Kleidern und rissen das Haus ein. Aus Emils Knabenspiel wurde schliesslich eine rechtschaffene Männerarbeit. Es gab Wunden an Gesicht und Händen, versengte Haare und braune Löcher in den Kleidern. Und da solches gerichtet und bestraft werden musste, gab es noch Prügel als Zulage. Bei der Züchtigung nahm Hannes Frank aus reiner Gewohnheit die Sünder dem Alter nach und fing mit Konrad an, dann packte er Werner, und dann riss Emil aus und war nicht mehr aufzufinden. Der rote Arnold lag, ohnedies rundum mit Schmalz eingerieben, im Bett.
Wahrscheinlich entsprach Hannes Franks Richtersinn nicht ganz Recht und Sitte. Aber das Leben der Knaben blieb dennoch schön, wenn auch alle ihre Spiele irgendwie mit Schmerzen enden mussten.
Das Leben im Ritterhof wurde noch reicher an Abwechslung, als bald nach dem Hausbrand neue Leute in die Gärtnerwohnung einzogen. An einem Novembermorgen erschienen sie. „Tschau — tschau ...“, mit Gelächter, Spektakel und „Amico“. Und Barrenti hiessen sie. Lebhafte Tessiner, vielleicht richtige Italiener. „Ich, Giochino — ich wohnen jetzt hier. O Madonna, hier ist es schön!“
Auch Giochino war Familienvater; er schob seine irdische Habe auf einem Handkarren vor sich her. Ein Prachtexemplar — schwarzes Lockenhaar, zwei funkelnde Augen, ein roter Mund. Seine kleine, blasse Frau folgte ihm mit einem hochbeladenen Kinderwagen. An ihrer Seite gingen zwei hübsche Mädchen; und das Ganze umkreisten, wie ein Rudel Hunde, drei johlende Knaben.
Dieserart folgten sich ohne Unterlass die Ereignisse im Leben der Grossen sowohl als im Leben der Kleinen. Das Erscheinen der Italiener war eine hübsche Abwechslung. Sie erhöhten den Lärm, sie brachten irgendwie Frohsinn in fremden Lauten, Sonne und Südwind. Die Herbstabende wurden weniger düster.
Natürlich entstand dadurch eine gewisse Unordnung im Ritterhof. Weder Hannes Frank noch die Frauen betrachteten die Ankömmlinge mit freundlichen Augen, denn sie hätten den Garten Eden am liebsten allein besessen und lehnten sich gegen die Veränderung mit vielen bösen Worten auf. Bis Herr Mayer als ordnende Macht erschien, als der höhere Geist über den Nebeln. Er wies den Barrentis ein Stücklein des Gartens an, ein paar Bäume, ein Stücklein Pflanzland. „Gracia“, sagte Giochino.
Die Lohmanns mussten sich, wenn auch widerstrebend, fügen. Den Knaben hingegen gefiel der Zuzug über alle Massen. Aus der reichen Kinderschar bildete Emil unverzüglich eine Armee und ernannte sich selber zum General. Mit seiner Armee führte er heftige Kriege gegen sämtliche Knabenvölker der Nachbarschaft.
Der Winter zog ins Land, der grosse Zauberer und gute Freund aller Jugend. General Emil liess mächtige Schneeburgen bauen. Es wurde ein Kriegszustand sondergleichen; nicht selten beteiligten sich auch die Erwachsenen daran. Es wurde eine lebhafte Zeit, reich gesegnet mit Abenteuern.
Leider ging sie schnell vorüber. Die harte Wirklichkeit des Daseins verdrängte die munteren Spiele.