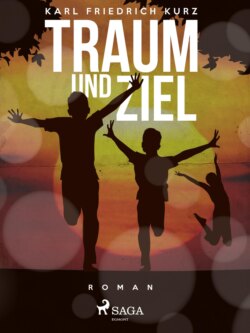Читать книгу Traum und Ziel - Karl Friedrich Kurz - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Briefwechsel
ОглавлениеIn Werners Jugend fiel das Grauen, das hinter allen Dingen steht.
Hingegen Hannes Frank, sein Vater, der lebenstüchtige Mann, zauderte nicht, Konrads Schicksal in seine Hand zu nehmen. Nachdem er in seinem Wunderbuch viel Weisheit gesammelt, bereitete er eine Salbe aus Bienenwachs und Sirup, darein mischte er ein paar geheimnisvolle Tropfen und ein paar Zaubersprüche und strich es überlegen und zuversichtlich auf Konrads fürchterliche Wunden.
Dazu seufzten die Frauen; sie trauten wohl Hannes Franks Künsten nicht recht. Weil jedoch kein Geld für Arzt und Apotheker vorhanden war, wussten sie keinen besseren Rat. Gott müsse nun weiter sorgen, dachten die Frauen bei sich selber und glaubten an die höhere Fügung.
Konrad, das Opfer, zeigte sich zufrieden mit der Behandlung und allem; still blickte er zum Fenster hinaus, träumte den Wolken nach, folgte dem Flug der kleinen Vögel, sah die stolzen Tannenwipfel sich im Winde zierlich zueinander neigen, erwartete des Abends die funkelnden Sterne. Sobald er mit Werner allein war, begann er von dem feinen Mädchen Alma zu sprechen, von kleinen, unschuldigen Begebenheiten. In der langen Ruhe des Krankenlagers stieg in seiner Erinnerung alles Erlebte empor, wuchs und leuchtete und überstrahlte das Leid. Er sprach von seinem Tod mit gleichmütiger Selbstverständlichkeit, als liege das noch in unbestimmter Ferne. In kindlicher und schauerlicher Weise verband er unaufhörlich beides, seine Liebe und sein Sterben.
Ruhig, eintönig flossen die Tage dahin. Der Winter kam. Die Menschen im Ritterhof drängten sich enger zusammen in der warmen Stube. Vor den Fenstern gingen finstere Schatten um. Aber die Menschen fühlten sich geborgen für die Nacht, für den nächsten Tag. Menschen, die in Armut leben, wagen selten, lange vorauszudenken.
Es richtete jedoch das Schicksal, das erbarmungslose, gerade auf diese paar Menschen ein scharfes Auge und wollte ihnen keine Ruhe gönnen. Das Schicksal hakte seinen Finger in die Stelle, die für die Lohmanns seit jeher am schwächsten war. Unerwartet versagte der Drogist dem verunglückten Lehrling die weitere Unterstützung.
Ach, dieser biedere Mann, niemand kann ihn deswegen tadeln, ihn selber zwang die harte Notwendigkeit. Da er keine Güter besass, blieb ihm nichts, womit er Konrad hätte helfen können.
Elisa verstand das nicht, als sie am Ende der Woche das Geld abholen wollte. Nein, sie begriff durchaus nichts, obschon der Drogist es mit klaren Worten sagte. „Mein liebes Fräulein, dieses ist nun leider mein letztes Geld“, sagte er. „Wie gern möchte ich helfen bis zum Ende. Doch euer Konrad scheint ja immer weiter und weiter zu leben. Und dieses kann ich nicht aushalten.“
„Wieso?“ fragte Elisa empört. „Dass Ihnen Ihre Lästerzunge verdorre! Er lebt Ihnen zu lange?“
„Ich verstehe Ihren Zorn und würdige ihn“, entgegnete darauf der Drogist. „Aber Sie müssen auch mich verstehen. Hier gebe ich Ihnen also mein letztes Geld. Ich habe nicht einmal den Lohn für meinen Gehilfen. Ausserdem besitze ich eine Frau und vier Kinder; aber kein anderes Vermögen; das Geschäft hier gehört eigentlich meinen Gläubigern. Seit dem Unfall muss ich noch mehr Schulden machen. Und weil ich ja nur ein kleiner Krämer bin, stehe ich nicht in der Unfallkasse. Niemand hilft mir.“
Ja, so standen hier die Dinge. Elend stand neben Elend. Aber Elisa begriff das immer noch nicht. Sie erklärte: „Wenn wir kein Geld mehr bekommen, müssen wir verhungern.“ Und das war vielleicht keine grosse Übertreibung, sondern nur der gewöhnliche Weltlauf.
Der Drogist erwiderte: „Und wenn ich euch noch mehr gebe, muss ich selber verhungern. Damit wäre euch nicht geholfen — oder?“
„Sie sind der Satan in Person!“ rief Elisa.
„Leider nicht“, widersprach der Drogist. „Sonst hätte ich andere Kräfte, und ich könnte euch und mir selber helfen.“
Sie unterhielten sich noch eingehend über diese verwickelte Angelegenheit. Worte ohne Wert und Sinn, unnütze Kraftvergeudung. Konrads allerletzter Verdienst versiegte.
Zu allem Überfluss ereignete sich im Laufe der folgenden Woche auch noch dieses: Hannes Frank kehrte vom Dienst zurück und war zum erstenmal nicht selbstsicher und kühn, sondern im Gegenteil ausserordentlich zahm und fromm. Irgend etwas musste da vorgefallen sein, beim Manövrieren mit den Eisenbahnwagen. Möglicherweise eine falsche Weichenstellung oder ein falsches Signal. Möglicherweise pfiff Hannes Frank, der Obmann, ein paar Sekunden zu früh oder zu spät auf seiner Trillerpfeife. Der Möglichkeiten gibt es unzählige, wenn etwas geschehen soll. Hier endete es mit einem Zusammenstoss und einer Entgleisung mit ein paar verwundeten Menschen und beträchtlichem Sachschaden.
„Ich bin nicht schuld daran“, brüllte Hannes Frank in der herrschaftlichen Küche des Ritterhofs. Hannes Frank fand leicht die Schuld hier und dort und stets bei anderen.
Aufgeklärt wurde der Vorfall nicht. Vielleicht machten sie aus Hannes Frank den erforderlichen Sündenbock. So oder so — entlassen war er. Knall und Fall.
Es ging lebhaft zu in der Küche. Hannes Frank bekam einen Wutausbruch und fluchte grässlich.
„Was soll nun aus uns allen werden?“ jammerten die Frauen.
Hannes Frank schwor und heulte, warf seine Trillerpfeife zum Fenster hinaus und schrie: „Fahr zur Hölle!“ Die Mütze mit dem glänzenden Schild warf er auf den Marmorboden der herrschaftlichen Küche und zertrampelte sie mit seinen Plattfüssen.
Auf einem verzwickten Umwege geriet er dadurch mit seiner mündigen Schwägerin Elisa in den prächtigsten Streit, der zwar mit seiner Entlassung in keinem Zusammenhang stand, ihn jedoch vom eigenen Missgeschick ablenkte. Alles miteinander bedeutete das unrühmliche Ende von Hannes Franks Staatsdienst.
Zur Stunde, da in der Küche der Kampf gewaltig tobte, unterhielten sich auf der anderen Seite des grossen Hauses zwei Knaben über das Wunder der Liebe. In Wirklichkeit befanden sich drei Personen im Zimmer. Werner sass auf seinem Stuhl, Konrad lag in seinem Bett, und die Puppe stand auf der Decke. Die Puppe lehnte sich gegen den weissen Verbandhügel, ja sie stützte gefallsüchtig ihre Hand auf Konrads verwundeten Arm, lächelte mit ihrem himbeerroten Mund und starrte mit ihren Glasaugen hochmütig und kalt ins Leere.
Wenn die Knaben schwiegen, drang das Getöse aus der Küche schauerlich bis in die Stube. Aber das störte sie nicht. Konrad drehte seinen Kopf dem Fenster zu und seufzte: „Ich hätte so ungeheure Lust, ihr einen Brief zu schreiben.“
Das schien Werner ein vorzüglicher Gedanke. „Ja, gewiss musst du ihr schreiben“, sagte er eifrig.
„Aber das ist nicht so einfach, wie du dir wohl vorstellst. Denn vergiss nicht, dass es sich doch um eine richtige Dame handelt.“
„Ho — was nun dieses anbetrifft. Wir beide kennen sie doch schon lange. Wir kennen sie von der Zeit her, als sie noch mit Hängezöpfen zur Schule ging.“
„Das hat hier nicht das geringste zu bedeuten. Sobald ein vornehmes Mädchen sechzehn oder siebzehn Jahre alt wird, ist es eben eine Dame, verstehst du?“
„So? Meinetwegen! Mag sie eine Dame sein — schreiben darfst du ihr dennoch.“
„Das fragt sich sehr. Und ich weiss wirklich nicht, ob ich es wagen soll. Ein Brief an sie — ich kann es mir gar nicht vorstellen.“
„Weshalb solltest du nicht schreiben dürfen? Hast du ihr denn nicht den schönen Hut gerettet und nicht einmal Geld dafür genommen?“
Konrad bleibt trotzdem bedenklich. „Darauf kommt es heute längst nicht mehr an. Aber vielleicht, wenn ich ihr sagen würde, dass ich ihr nie mehr auf der Strasse begegnen werde und sie sich meinetwegen nicht zu schämen braucht, wird sie es mir nicht übelnehmen, sondern mir verzeihen. Denn es bleibt, das darfst du ruhig glauben, eine riesige Frechheit. Ja, das weiss ich doch.“
„Eine Frechheit? Wie sollte es sie beleidigen? Soviel muss sie doch verstehen.“
Schon holt Werner Papier und Bleistift. „Zuerst wollen wir den Brief dichten. Dann schreibe ich ihn auf mein schönstes Papier. Und wenn du willst, schreibe ich ihn mit roter Tinte.“
„Nein“, lächelt Konrad. „Was fällt dir ein? Das würde ihr bestimmt nicht gefallen.“
„Also los! Ich schreibe: Liebste Alma ...“
„Bist du verrückt, Mensch?“
„Ich? Nein — wo denn?“
„Wertes Fräulein Alma, musst du schreiben.“
„Gut — weiter!“
„O — Herrgott — weiter“, seufzt Konrad. ‚Es wird trotz allem nicht möglich sein. Nein.“
„Warum denn nicht? Fürchte dich nicht — ich schreibe: Einst habe ich Ihren Hut gerettet. Und es war ein schöner weisser Hut mit gelben Rosen darauf. Erinnern Sie sich noch daran? — Was meinst du dazu?“
„Das wäre wohl gar nicht so schlecht ...“
„Schlecht? Darauf muss sie dir auch gleich eine Antwort geben. Sie muss wenigstens sagen, ob sie sich erinnert oder nicht.“
„Sie wird mir niemals eine Antwort geben“, meint Konrad still und hoffnungslos. „Nein — das erwarte ich nicht.“
„Sie muss dir Antwort geben!“ erklärt Werner bestimmt. „Was soll ich jetzt noch schreiben?“
Auf einmal kommt ein Glimmen in Konrads Augen. Lange schaut er die Puppe an und sagt: „Schreibe, dass ich immer an sie denken musste seit jenem Tag. Und dass ich überall ihre Stimme hörte ... Schreibe: Und wenn ich Sie nachher auf der Strasse nicht grüsste, so war es doch nur deshalb, weil ich so schlechte Kleider anhatte, und ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen, wenn es jemand sah ... Schreibe: Und als wir in den Ritterhof zogen, fand ich im Wandschrank Ihres Zimmers Ihre Puppe, und ich versteckte sie. Und ich ging manchmal hin und schaute sie an, denn es war ein Stück von Ihnen. Ja, ich ging fast jeden Tag hin. Ich wollte sie Ihnen zurückbringen. Aber ich konnte mich nicht von ihr trennen. Bitte, verzeihen Sie mir! — Hier musst du drei Ausrufzeichen machen ...“
„Ich werde es noch unterstreichen. Dann wird sie dir nicht zürnen können.“
„Schreibe noch: Ich hätte diesen Brief nie gewagt, aber ich bin verunglückt, und ich muss bald sterben ...“
In einem Zuge sprach Konrad, zuweilen schloss er die Augen; die Worte flossen leicht über seine Lippen.
Während er schrieb, schoss Werner das Wasser in die Augen, so dass er seine eigene Schrift nicht mehr sehen konnte. Unausgesetzt fuhr er mit dem Handrücken über seine Wangen. Dann erklärte er: „Das wird ein ungeheuer schöner Brief! Du, Konrad, jetzt bin ich ganz sicher, dass sie dir darauf antworten wird.“
„Dann kannst du noch schreiben: Ich werde Sie nie mehr sehen. Aber ich liege jetzt still in meinem Bett und denke an Sie. Ich stelle mir vor, wie Sie einst auf der Strasse vor mir hergingen in Ihrem schwarzen Kleid. Und ich hätte Ihnen gern etwas geschenkt zum Abschied. Doch ich habe leider gar nichts, denn ich bin so furchtbar arm ...“
Werner, den Handrücken an der Wange, stöhnt: „So etwas Schönes und Trauriges habe ich noch nie gehört ...“
„Schreibe: Ich habe eine grosse Bitte an Sie. Wollen Sie mir Ihre Puppe noch solange lassen? Nachher wird Werner sie Ihnen zurückbringen ...“
„Ja, das will ich“, stöhnt Werner.
„Und nun weiss ich nichts mehr. Doch der Brief muss unterzeichnet werden. Schreibe also: Es grüsst Sie Ihr Konrad.“
In der Küche tobte das Gewitter. Aber in Konrads Gesicht strahlte himmlischer Friede. Noch drangen zu ihm die Laute dieser Erde, doch er vernahm ein leises Rauschen von Engelsfittichen, hoch über aller Not des Lebens.
„Das“, stammelt Werner, „das kann doch nichts anderes als ein Liebesbrief sein.“
„Nein, ich weiss nicht, was es ist ... Wenn sie mir nur nicht zürnt“, meint Konrad, aufs neue verzagt.
Werner schrieb den Brief auf sein schönstes Papier und malte in jede Ecke ein paar Blumen.
Er habe seine Sache vorzüglich gemacht, lobte ihn Konrad. Es sei kein Fehler darin. „Aber du musst ihr den Brief heimlich und persönlich bringen“, sagte er.
„Ja, wenn nur der böse Hund nicht wäre“, seufzte Werner. „Er bellt immer so rasend, wenn ich am Tor vorbeigehe. Wahrscheinlich beisst er.“
„Nein, nein, er beisst nicht. Er heisst Donna. Ruf ihn nur bei seinem Namen. Donna, vergiss das nicht. Übrigens ist er oft im Hause eingesperrt. Aber niemand darf dich sehen, wenn du ihr den Brief gibst. Denn das wäre eine Schande für sie.“
Nicht ohne schlimme Ahnungen macht Werner sich auf den Weg. Er fürchtet sich vor dem Hund. Aber was sein muss, das muss sein. Und so schreitet er denn vor Almas Haus hin und her und bewacht das Tor. Ein Herr und eine Dame treten auf die Strasse und entfernen sich. Nun muss sie allein zu Hause sein. Vom Hund ist nichts zu sehen.
Das Herz klopft Werner im Halse; aber er öffnet das eiserne Tor. Das Tor kreischt. Werner macht einen Schritt und schliesst es hinter sich; es kreischt abermals. Plötzlich schiesst hinter der Hausecke hervor der Hund, mit gesträubtem Nackenhaar, wütend. Da hat Werner natürlich vergessen, dass der Hund Donna heisst; er springt mit einem mächtigen Satz zum nächsten Baum und klettert daran empor. Donnas Zähne schlagen in seinen Schuh. Aber schon sitzt er oben zwischen den Ästen. Am Stamm springt der Hund hoch und vollführt einen gottlosen Lärm.
Die Haustür wird ein wenig geöffnet. Weiss Gott, sie selber, Alma, tritt erschreckt heraus, schaut sich um und ruft den Hund zurück. Aber Donna bellt nur noch wütender. Endlich bemerkt Alma den Knaben auf dem Baum, kommt zögernd näher.
„Ich habe nichts Böses getan. Kommen Sie nur“, ruft Werner.
Sie fasst den Hund beim Halsband und fragt: „Was treibst du dort oben?“
„Nichts. Ich warte auf Sie.“
Betroffen schaut Alma zu ihm auf. Überaus sein ist sie. Ihr Haar ist dunkel; ihre Augen sind gross und leuchtend. Zum erstenmal bemerkt Werner die Lieblichkeit eines Mädchengesichts. „Ich habe einen Brief“, sagt er geheimnisvoll. „Aber niemand darf es wissen.“
„Einen Brief?“ ruft sie in hilflosem Staunen.
„Einen Liebesbrief ...”
„Was?“ ruft sie überwältigt.
„An Sie. Aber wollen Sie den Hund nicht zuerst anbinden?“
Nun macht Alma Miene, zu fliehen. Ja, sie weicht ein paar Schritte zurück, und ihre Augen werden noch grösser. „Wer bist du?“ fragt sie ängstlich.
„Ich heisse Werner und kenne Sie gut. Wir wohnen jetzt in Ihrem Haus ...“
In Alma kämpfen Furcht und Neugier, das ist in ihrem Gesicht deutlich zu sehen. „Wer hat ihn denn geschrieben, den Brief?“
„Den hab’ ich schreiben müssen, denn Konrad hat keine Hände mehr.“
„Du mein Gott — was sagst du da — keine Hände? Komm endlich herunter!“
„Können Sie den Hund nicht wegnehmen? Ich werde Ihnen dann alles erzählen.“
Alma führt den Hund ins Haus und schliesst die Tür hinter ihm. Es geht wahrlich so gut, dass es gar nicht besser gehen könnte. Eine vornehme junge Dame ist sie, und sie trägt auch heute ihr schwarzes Kleid, das ihre wehmütige Zartheit noch zarter und wehmütiger macht. „Wir wollen hinters Haus gehen“, sagt sie und schreitet voran.
Da steht ein Tempelchen, von wildem Wein ganz eingesponnen. Sie lässt sich auf einer Bank nieder. „Setz dich dorthin“, sagt sie. „Aber ich verstehe kein Wort von allem, was du berichtest.“
Hierauf liest sie den Brief. Sicherlich ist es der erste Liebesbrief, den sie empfängt, dieser seltsame Gruss vom Rande eines offenen Grabes. Sie liest und schüttelt dabei den Kopf, von dem ein köstlicher Duft aufsteigt. „Nein, ich verstehe das alles nicht“, sagt sie leise und lässt den Brief in ihren Schoss sinken. „Konrad?“
„Als er Ihrem Hut nachlief, wurde er beinahe von einem Wagen überfahren. Er fiel hin und blutete ...“
„Ach ja — daran erinnere ich mich. Ja, wirklich. Aber sag mir, was meint er denn mit der Puppe?“
„Es ist Ihre Puppe! Er fand sie in Ihrem Zimmer.“
Sie legt den Kopf zurück, schliesst die Augen ein wenig und denkt nach. „Ich habe keine Puppe zurückgelassen. Ich habe nie gern mit Puppen gespielt. Nein ...“
„Wenn man sie hinlegt, schliesst sie ein Auge, aber das andere sieht offen. Sie hat dunkles Haar. Konrad meint, es müsse Ihr eigenes Haar sein.“
„Ich habe mein Haar nie für eine Puppe hergegeben ...“ Doch nun huscht ein scheues, wunderfeines Lächeln über ihr blasses Gesicht. „Wenn ich mich nicht täusche, muss das die Puppe meiner Mutter sein. Ja, ja, ganz gewiss muss es ihre alte, hässliche Puppe sein, die ich nicht leiden mochte. In ihrem Kopf war etwas zerbrochen, darum konnte sie nur noch ein Auge schliessen. Es kann nur diese Puppe sein.“
Auch in Werners Kopf zerbricht etwas. Und das schmerzt ihn so sehr, dass er seine beiden Augen schliessen muss und den Atem anhält. „Aber es ist seine letzte Freude“, sagt er leise und bittend.
„Nein, was fällt dir nur ein? Was habt ihr euch da nur ausgedacht?“ fragt sie mit einem Versuch zu lächeln. Doch als sie in Werners Gesicht blickt, in dieses Gesicht, das förmlich zerfällt vor Enttäuschung und Verzweiflung, wird sie auf einmal ernsthaft und beginnt ihn auszufragen.
Allmählich erfährt sie, Stück um Stück, Konrads kleine Geschichte und die Geschichte von Konrads heimlicher Liebe. Indessen sie Werner zuhört, senken sich ihre Lider tiefer und immer tiefer über die strahlenden Augensterne, und aus den langen Wimpern beginnen Tropfen zu sickern. Die Tropfen fallen auf Konrads Brief und auf ihre Hände, die darübergefaltet sind. „Grosser Gott, wie schwer und furchtbar ist doch das Leben für einige“, flüstert sie mit zuckenden Lippen. „Aber sag, was kann ich für ihn tun?“
„Oh, Sie können sehr viel tun!“ ruft Werner in jäh erwachter Zuversicht. „Sie könnten ihm zum Beispiel einen schönen Brief schreiben.“
„Nein“, wehrt sie sachte, doch bestimmt. „Nein, das kann ich nicht. Nein, das darf ich nicht.“
„Oder Sie könnten ihm ein paar Blumen schenken ...“
Sie besinnt sich. Ihr Kinn bebt. „Das will ich gern“, sagt sie und pflückt ein paar Fliederdolden von den nächsten Büschen. „Bring sie ihm und grüss ihn von mir. Sag ihm, wie furchtbar leid er mir tut in seinem Unglück.“
„Und die Puppe? Wollen Sie sie nicht wiederhaben?“
„Nein. Was soll ich damit?“
„Und darf er Ihnen wiederschreiben?“
„Nein, du. Das ist undenkbar. Sei jetzt ein lieber Bub und komm nicht wieder zu mir. Hörst du? Wenn mein Onkel dich sieht, wird er sehr böse, und er wird mich schelten. Und sieh, ich kann doch gar nichts, gar nichts für Konrad tun.“
„Aber Sie können doch wenigstens ein wenig an ihn denken, zuweilen ...“
„An ihn denken? Ja, das werde ich sicher. Auch das darfst du ihm ausrichten. Aber jetzt musst du gehen. Und komm also nicht wieder. Versprich mir das!“
Bittend streckt sie ihm ihre schmale, weisse Hand über den Tisch hin. Und er ergreift diese Hand mit seinen beiden Händen. Langsam erhebt sie sich, ein rätselhafter Ausdruck kommt in ihr Gesicht. Sie legt Werner ihre freie Hand auf den Scheitel, als wolle sie ihn segnen. „Sage Konrad, dass ich es selber nicht gut habe und nicht glücklich bin ... Und nun musst du wirklich gehen“, sagt sie in unbeschreiblicher Güte.
Werner geht.
Dieses Unternehmen verlief vielleicht nicht ganz so, wie er es gewünscht und erwartet. Nun hatte auch er ihn klar und scharf gesehen, den Graben zwischen Alma und Konrad. Nur Konrads Unglück war die klägliche Brücke, die von einem Ufer zum anderen führte. Sicherlich schickte sie ihn nicht weg mit leeren Händen und ohne ein gutes Wort des Trostes. Und gekränkt war sie nicht — oh, im Gegenteil —, aber er durfte ihr keine Botschaft mehr bringen; das stand fest.
In der Einfalt seines Herzens dachte Werner: Wenn sie nicht gar so vornehm wäre, würde sie vielleicht in den Ritterhof kommen und ihn besuchen. Und ich bin sicher, er würde dann sein grosses Weh vergessen ...
Leider durfte dieses nicht geschehen. Und Werner brachte nichts zurück als ihre Blumen. Sein Herz war traurig. Sein Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen, als er das Zimmer betrat und Konrad ihm mit fieberglänzenden Augen entgegenstarrte.
„Hast du sie getroffen?“ fragt Konrad, schlotternd vor Erwartung.
„Gewiss traf ich sie. Ich lieferte den Brief ab und erzählte ihr dann noch vieles. Ich durfte neben ihr sitzen in ihrem Gartentempelchen. Sie weinte ...“
„Ist das wahr, du? Weinte sie?“ fragt Konrad atemlos.
„Dein Brief wurde nass von ihren Tränen. Und dann gab sie mir die Blumen für dich. — ‚Grüsse ihn von mir‘, sagte sie.“
Dieses entspricht einigermassen der Wahrheit. Sowie aber Werner die Wirkung seiner Botschaft bemerkt, sowie er Konrads verklärtes Gesicht sieht, durchrieselt es ihn heiss, und in seinem Kopf entsteht jäh ein Gedanke. Ein ungeheuerlicher Gedanke. „Sei sicher — sie liebt dich“, sagt er.
Aber das ist wohl doch zuviel. Vor so grossen Worten wird Konrad misstrauisch. „Nein, du — das ist undenkbar. Das sagte sie gewiss nicht.“
„Vielleicht nicht so mit diesen Worten. Aber sie deutete es doch an, dass ich es verstehen musste. Sie will dir selber schreiben.“
Langsam öffnen sich Konrads Lippen und zittern vor unermesslicher Freude. Er fragt hastig: „Du hast wohl nicht einen Brief von ihr?“
„Nein, sie konnte doch nicht auf einmal schreiben, während sie bei mir sass und alles mögliche fragte und wissen wollte. Aber morgen oder übermorgen kann ich ihren Brief abholen. Sie will immer und ewig an dich denken, weil du ihr so leid tust ...“
Lieber Herr im Himmel — diesem Knaben Konrad ward viel Schweres auferlegt, und er wandelte im kalten Schatten von Anfang an. Ehe er aber aus dieser Welt scheiden musste, sollte ihm noch ein unerhörtes Glück beschieden werden — durch Werners Beistand, durch eine gottgefällige Lüge, durch hundert grosse und kleine Lügen, die sich als eine hohe Brücke über seinen Himmel spannten als strahlender Regenbogen. Nicht länger zögerte Werner, seinen besten, seinen einzigen Freund zu hintergehen.
Beim Anblick Konrads geriet Werner in einen wahren Taumel des Entzückens, in einen seligen Rausch des Schenkens. Bald konnte er selbst nicht mehr unterscheiden, wo die Wahrheit aufhörte und die Dichtung begann. Er, der bis zu diesen Tagen noch nie an Liebe und ähnliches gedacht und wenig oder gar nichts wusste vom geheimen Treiben der Menschenwesen, er ahnte in wunderbarer Weise zum voraus vieles von dem, was erst künftige Zeiten ihn lehren sollten. Ein goldenes Klingen flutete durch sein Blut.
Erregt sass er nun an Konrads Krankenlager und sprach mit begnadetem Mund. „Schon längst dachte sie an dich. Und sie hätte dich gern noch einmal gesehen. Sie wollte dich früher auf der Strasse anreden; aber du gingst so schnell an ihr vorbei. Und da durfte sie natürlich nicht stehenbleiben ...“
„Nein, das durfte sie nicht. Erzähl weiter! Trug sie wieder ein schwarzes Kleid?“
„Ein rabenschwarzes; ihre Tränen tropften darauf, und sie wischte sie nicht weg. Aber deinen Brief verbarg sie an ihrer Brust. Sie will ihn später noch viele Male lesen, wenn sie allein in ihrem Zimmer ist ...“
Unermesslich reich wird Konrad beschenkt. „Ist das nicht merkwürdig“, fragt er, von Werners Feuer erwärmt, „da ging ich also hundertmal an ihr vorbei und wusste nicht, dass sie mich beachtete ...“
„Wie hätte sie es dir nur zeigen können? Und den Weissen Handschuh mit dem Blutfleck hat sie aufbewahrt.“
Langes Schweigen.
Leise fragt Konrad: „Und ihre Puppe? Will sie sie nicht wiederhaben?“
„Nein, du darfst sie behalten — weil es doch ein Stück von ihr selber sei. Sie liebte sie sehr, ihre Puppe. Nur mit ihr spielte sie, solange sie in diesem Hause wohnte. Aber heute schenkt sie sie dir ein für allemal. Und etwas Besseres könne sie dir gar nicht schenken, meinte sie.“
„Nein, das kann sie gewiss nicht.“
Abermals ein inhaltschweres Schweigen.
Worauf Konrad das Gesicht Werner zuwendet. „Komm jetzt zu mir, Werner!“
Eine unerhörte Feierlichkeit schwingt in Konrads Stimme, ein heiliger Ernst. Langsam, klar und deutlich sagt er: „Du hast wahrlich schon viel für mich getan. Nun hab’ ich noch eine letzte grosse Bitte an dich. Wenn ich gestorben bin, dann legst du mir die Puppe in den Sarg. Versprich mir das! Du bist mutig und klug; du wirst auch dieses vollbringen, ohne dass jemand davon erfährt. Ich werde dann nicht allein sein im Grab.“
Erschüttert von Konrads Feierlichkeit, bis ins Innerste aufgewühlt und gleichzeitig erschreckt vom gefährlichen Spiel, das er da unternommen, verspricht Werner: „Verlasse dich auf mich in allen Stücken.“
„Sagtest du nicht vorhin, sie habe dir die Hand gegeben?“
„Doch, das tat sie.“
„Leg mir deine Hand auf die Stirn. Das ist genau so, als habe sie selber mich berührt ...“
Welch tolles, grauenhaftes, kindliches und göttliches Spiel! Zwei Knaben spielen es; und sie spielen es mit der ganzen Inbrunst ihrer unverbrauchten Herzen.
„Wann willst du ihren Brief abholen?“
„Morgen abend, nach der Schule, denk’ ich.“
„Nun wundre ich mich sehr, was für eine Handschrift sie hat.“
„Ich bin sicher, dass sie ungewöhnlich schön schreibt.“
„Das glaube ich auch“, nickt Konrad.
„Ich denke mir, sie wird kleine, zierliche Buchstaben machen. Was meinst du?“ Dieses fragt Werner nicht ohne Hintergedanken. „Gewiss wird sie nur auf allerfeinstes Briefpapier schreiben.“
„Ja, darauf kannst du dich verlassen“, pflichtet Konrad bei. „Und ihr Brief wird nach Veilchen oder Rosen duften.“
Solches hat Werner nun doch nicht erwartet. Verblüfft und ein wenig ungläubig fragt er: „Weshalb soll er denn duften?“
„Nun — so ... Bei einer jungen, feinen Dame duftet alles. Die tragen doch stets ein Fläschchen Wohlgeruch mit sich herum. Auch bei ihr wird es so sein, denk’ ich.“
„Und ob sie wohl Herr Konrad über ihren Brief setzen muss?“ erkundigt sich Werner schlau.
„Wo denkst du hin? Sie wird einfach Konrad sagen. Oder vielleicht, wenn es sehr viel sein soll, wird sie ‚lieber Konrad‘ sagen ...“
Den ganzen Abend besprechen sie diesen Briefwechsel. Es wird ein schöner Abend für sie beide. Etwas völlig Neues und Nieerlebtes ist in ihr Gespräch getreten; und sie geben sich ihm mit ganzer Seele hin.
Vor dem Fenster zieht die blaue Frühlingsnacht herauf. Aus dunklen Tannen kommt der schmelzende Lockruf der Amseln.
„Lass mich jetzt noch ein Weilchen allein“, bittet Konrad still und glücklich. Gar vieles hat sich an diesem Abend ereignet, an das er denken und worüber er sich freuen muss.
Es ist die erste wirkliche, klingende Freude seines Lebens.