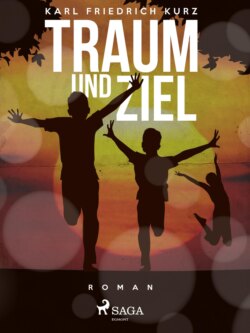Читать книгу Traum und Ziel - Karl Friedrich Kurz - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Schatten am Fenster
ОглавлениеDumpfglühend wie der aufgehende Mond schwebt ein Fenster durch die Nacht.
Es ist kühl hier und still. In den Wolkenhimmel ragt verwischt ein Dach, halbverdeckt von der schwarzen Krone des riesigen Kastanienbaumes, der sich reglos gegen das Haus hinneigt, als wolle er ein Geheimnis belauschen.
Ein Schatten gleitet über die Gardinen.
Dieses Fenster und dieser Schatten scheinen das letzte, das einzige, was von der Wirklichkeit der Dinge zurückblieb. Die übrige Welt zerfloss in Formlosigkeit. Alles Leben ging unter in einer drückenden, unheilvoll lauernden Stille, die erfüllt ist vom verhaltenen Brausen des Stroms.
Nur ein verhangenes Fenster, über das in regelmässigen Zwischenräumen ein Schatten gleitet. Nichts als ein Zimmer, in dem ein Licht brennt. Ein Zimmer, in dem ein Mensch ruhelos wandert.
Zuweilen kommen aus der nahen Stadt die Stundenschläge. Tiefe Glockentöne, sie springen irgendwo in der Finsternis auf und tauchen wieder in der Finsternis unter.
Der junge Gärtner Alois bemerkte das erleuchtete Fenster und den gleitenden Schatten an der Gardine schon am Abend, als er zu seiner Liebsten ging. Nun kehrt der Gärtner von seiner Liebsten zurück, und der Schatten gleitet immer noch über die Gardinen. Alois hat gute Augen und mancherlei Gedanken in seinem Kopf. Stark und süss duftet der Jasmin, und der Gärtner murmelt: „Dort marschiert er wieder ... Marschiere immerzu, grosser Mann ...“
Gegen drei Uhr erlischt das Licht hinter dem Fenster; es erlischt nicht jäh, auf einen Schlag, sondern mit einer zaudernden Gemächlichkeit.
In dieser Nacht nahm der lange Marsch des Herrn Bondorf ein Ende. Irgendwie kam es — vielleicht war der Herr geistesabwesend, oder es lag ein kleiner Fehler am Gashahn. Am Morgen erwachte Herr Bondorf nicht mehr. Ein wenig verkrümmt lag er in seinem prächtigen Mahagonibett, lag unter der gelben Seidendecke und hatte einen bläulichen Schimmer im Gesicht. Neben ihm lag seine Frau, die noch immer jugendliche und ungeheuer stolze Madame Bondorf, die nur Französisch sprechen wollte und eine verwegene Reiterin war. Ja, da lag nun auch sie, blauschimmernd und sonderbar.
Das Zimmermädchen entdeckte die Sache. Wie jeden Morgen ging es mit dem heissen Kaffee ins Schlafzimmer, trat leise ans Bett, stiess einen pfeifenden Schrei aus und lief zur Köchin. Die Köchin, eine alte, abergläubische Person, rannte fort, den Gärtner zu suchen. „Oh, meine arme, sündige Seele!“ heulte sie und riss die Haustür auf. Ein frischer Nordwind sprang sie an und presste ihr den Rock gegen Bauch und Beine. In den Tannen sauste und fauchte es. Da und dort erhob sich vom Boden ein vom Winter vergessenes Laubblatt wie eine kleine, dunkle Hand, die schnell nach etwas haschte und wieder in die Erde zurücksank. Das alles schien der Köchin befremdlich und unheilkündend; dazu die Gestalt des Gärtners, von dem sie nur den langen, schmalen Rücken sah und eckige Schultern ohne Kopf. „Nicht umsonst zeigte sich das graue Garnknäuel“, seufzte sie. „Das bedeutet Unglück ... Alo—is!“
Der Gärtner kniete vor einem Blumenbeet, hörte den Ruf der Köchin, hörte auch ihre Schritte. Ohne aufzublicken, brummte er: „Was will es schon wieder, das dicke Halleluja ...“
„Alois — schnell ...“
„Was plagt dich?“
„Schnell, um Gottes willen — vielleicht ist noch ein Restlein Leben in ihnen.“
„Jetzt glaube ich aber — alte Angstflasche ... Wo brennt es?“
„Diesmal handelt es sich um ein Verbrechen ...“
In seinen groben, schmutzigen Stiefeln stapft Alois über den Perserteppich, streckt überaus gespannt den Kopf vor, schnuppert: „Hier riecht es verdächtig nach Gas und anderer Pestilenz.“
„Ja“, flüstert das Zimmermädchen.
„Hast du das Fenster geöffnet, Sophie?“
„Ja.“
„Und der Gashahn?“
„Den schloss ich.“
„Dann bleibt weiter nichts mehr zu tun“, entscheidet der Gärtner.
Blass und verstört schielt das Zimmermädchen hinter seiner Schürze hervor. „Leise — leise“, mahnt es.
Alois richtet seine grauen, klugen Augen auf das Bett, hebt mit zwei Fingern Frau Bondorfs weisse Hand von der Decke auf; hölzern folgt von der Schulter an der ganze Arm mit. Im Niederfallen schlägt die Hand dumpf gegen den Bettrand.
„Lass das!“ ruft entsetzt das Zimmermädchen.
„Sie merkt nichts mehr davon. Und hier gibt es nichts mehr zu flüstern, Sophie. Von diesen beiden ist eins genau so tot wie das andere.“
„Tot?“
„Schon kalt und steif.“
„Tot?“ wiederholt die Zofe atemlos.
„Das kannst du wohl selber sehen. Dabei ist nichts mehr zu machen. Natürlich muss man den Arzt holen. Aber zu machen ist nichts. Dieses hier muss sich kurz nach zwei Uhr zugetragen haben.“
„Schweig!“ stöhnt die Zofe. „Stets bist du so frech ... Geh hinaus!“
Alois geht. Bei der Tür dreht er sich noch einmal um, lässt seinen Blick missbilligend durch das prächtige Zimmer schweifen und sagt: „Kann man denn in einem solchen Raum sterben? Sollten diese beiden je in den Himmel kommen, werden sie es dort nicht besser treffen.“
Alois holte den Arzt. Es war nichts mehr zu machen. Der grosse Weinhändler Bondorf und seine Frau hatten diese Welt still verlassen.
Ein blosser Zufall vielleicht, oder ein Unglück aus Unachtsamkeit? Als die Obrigkeit erschien und strenge Nachforschung hielt, kamen gar sonderbare Dinge zutage. Die Bücher stimmten nicht. Wo stimmte es in diesem vornehmen Haus? Es fehlte überhaupt an allem und jeglichem — keine Barschaft, kein Bankguthaben, keine Forderungen, dafür gewaltige Schulden. Es wurde ein fürchterlicher Zusammenbruch.
Alma, das einzige Töchterlein, wäre über Nacht zum ärmsten Bettelkind geworden, wenn Frau Bondorf diese Schande nicht im allerletzten Augenblicke noch verhindert hätte. Sie gab ihren Schmuck her und versicherte ihr Leben; dieserart verhinderte sie es.
Merkwürdige Menschen. Harte Menschen. Stolze Menschen. Geldmenschen — das Leben gefiel ihnen gut in dieser Welt, solange ihre Kasse gefüllt war. Sobald der Reichtum verlorenging, verzweifelten sie, und das Leben gefiel ihnen nicht länger.
Ein grosses Gerede und Gerate hub an. Die Leute können nachträglich urteilen und verdammen. Die Leute wissen vielleicht einiges. Doch sie wissen nicht, was diese beiden gelitten, bis sie sich zum letzten Entschlusse durchgerungen. Niemand erfuhr etwas von den langen Gesprächen in den Frühlingsnächten, als der Schatten am Fenster hin und her glitt. Aber da sie nun tot waren, begrub man sie.
Von den vielen Freunden ihrer Licht- und Glanzzeit gaben ihnen nur wenige das Geleit zum Friedhof. Die Bondorfs hatten vielleicht recht in ihrer Weise: sie wussten, dass sie mit Geld geachtet und mächtig waren. Ohne Geld waren sie nichts.
Das grosse Haus wurde völlig ausgeräumt, vom Keller bis zum Dachboden, und alles kam unter den Hammer, alle Möbel und Teppiche und die Gemälde an den Wänden. Alles wurde fortgeführt; auch das Mahagonibett. Der Weinhändler und seine Frau starben jung; sie standen kaum im Sommer ihres Lebens. Nachträglich hiess es, ihr Leben sei der unverschämteste Schwindel gewesen. Die vielen Fässer, die man aus den weitläufigen Kellern heraufholte, waren teils völlig leer, teils mit blankem Wasser gefüllt.
Auch das Haus und der grosse schöne Garten kamen unter den Hammer und wurden zu einem Spottpreis losgeschlagen; denn niemand wollte das Haus der Selbstmörder haben, obschon man einen prächtigeren Besitz in der Gegend kaum finden konnte. Seit alters her nannte man ihn Ritterhof. Es hiess, einmal habe hier ein gewaltiger Mann, ein Ritter, gelebt, der sei im Kampf mit den Bauern vor den Toren der Stadt erschlagen worden. Damals war der Ritterhof eine Burg mit Turm und starken Mauern. Später wurde daraus ein Dominikanerkloster.
Alte Häuser haben ihre Geschichte. In der Klosterzeit entstanden unter dem Ritterhof die ungeheuren Keller. Die Leute behaupten, es führe ein Gang unter dem Rhein von einem Ufer zum anderen; aber er sei längst verschüttet; und es gebe im letzten Keller eine Treppe, auf der einst viele Menschen niederstiegen, aber keiner mehr heraufkam. Ausserdem gab es die Geschichte von einem Mönch. Möglicherweise war das eine neue Geschichte, von der Köchin Margarete erfunden und in Umlauf gesetzt.
„Oh, oh — ein grauer Mönch in langer Kutte!“ sagte Margarete. „Er schritt über den Hof; er schritt am Haus vorüber und schaute von der Terrasse her ins Kontorfenster. Er lehnt am Fenster — und auf einmal ist er nicht mehr da. Aber von der Stelle aus rollt ein graues Garnknäuel, rollt über den Weg und verschwindet bei der Tujahecke ...“
Drei Abende hintereinander sah die Köchin Margarete sowohl Mönch als Garnknäuel. Darauf starb die Herrschaft. Gewiss nur sinnloses Geschwätz einer alten, abergläubischen Person; doch es erfüllte einen geheimen Zweck. Es brachte den Ritterhof in der ganzen Stadt in Verruf.
Das Töchterlein Alma zog zu ihrem Onkel, der ebenfalls ein Händler und grosser Herr war und in derselben Strasse wohnte. Alma zählte vierzehn Sommer, schmal und blond war sie und überaus fein, dabei schon etwas damenhaft. Man sah sie von dieser Zeit an nur noch in schwarzen Kleidern, als richtige Waise, blass, still und traurig. Man betrachtete sie scheu und hatte Mitleid mit ihr, weil ein hartes Schicksal sie so früh getroffen. Niemand trug dem Kind nach, was die Eltern gesündigt. Selbst die wilde Strassenjugend unterbrach ihre lärmenden Spiele, wenn Alma, wie ein Schatten der Nacht, an ihnen vorbeiglitt.
Der Ritterhof versank in Schweigen; verlassen lag der schöne Garten. Doch der Frühling brauste durch die Welt und lockte bunte Wunder aus der geheimnisvollen Tiefe der Erde, auch wenn die Blumen niemand zur Freude blühten.
Der neue Besitzer des Ritterhofs meinte, das sei ein sinnloser Zustand. Es gelang ihm, weder die Besitzung zu verkaufen noch zu vermieten. Kein einziger Liebhaber meldete sich für das Gespensterhaus.
Woche um Woche ging. Dieselbe Totenstille im Haus. Im Garten verwelkten die Blumen; das Unkraut machte sich frech über alle Wege und Plätze her. Nur die Obstbäume trugen in stiller Güte ihre Früchte.