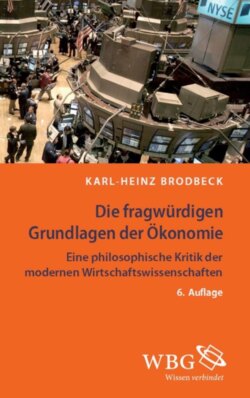Читать книгу Die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie - Karl-Heinz Brodbeck - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5 SUBJEKTIVE WAHRSCHEINLICHKEIT
ОглавлениеAus den Schwierigkeiten objektiver Deutungen hat man den Ausweg eines subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffs gewählt. Bei Cournot tritt die Beziehung zur Möglichkeit besonders deutlich hervor, denn er sagt, »daß der Ausdruck Möglichkeit eine objektive Bedeutung hat, während der Ausdruck Wahrscheinlichkeit in seinen gewöhnlichen Bedeutungen mehr einen subjektiven Sinn hat.«17 Der subjektive Ausweg ist zwar gangbar, behält aber gleichwohl die Grundvoraussetzung des Ereignisraumes bei. Bei der subjektiven Interpretation von Wahrscheinlichkeiten sagt man, die Wahrscheinlichkeiten seien subjektive Schätzungen für das Eintreten von Ereignissen.
Das läßt aber offen, wie man zu diesen »subjektiven Einschätzungen« gelangen soll. Wenn sie wirklich »subjektiv« im Sinne der Naturwissenschaften sind, sind sie zufällig und damit keine Entscheidungshilfe. Sind sie »begründet«, so wäre zu fragen: »Wodurch?« Cournots Bemerkung zeigt sehr deutlich, woher die Schwierigkeiten des Wahrscheinlichkeitsbegriffes stammen: Vom Begriff der Möglichkeit als eines vorhandendinglichen Zustands, der noch nicht eingetreten ist und dessen Eintreten wir vorhersagen. Dieser Möglichkeit korrespondiert eine subjektive Unsicherheit, die wir als Wahrscheinlichkeit bestimmen. Zwischen den formalen Extremen der Gewißheit aufgrund notwendiger Ursachen und dem völligen Nichtwissen gibt es graduelle Übergänge, »Graustufen«, die wir als Wahrscheinlichkeiten deuten.
Diese Probleme der Wahrscheinlichkeit tauchen nur dann auf, wenn wir die situativen Vorkommnisse begrifflich objektivieren, d.h. Grenzen einführen. Die Alternativen der Entscheidung, alternative Umweltzustände oder Elementarereignisse in einem Ereignisraum der Wahrscheinlichkeitstheorie, sind Einzelereignisse. Einzelereignisse sind historische Ereignisse und verweisen auf eine spezifische Situation. Wenn man einmal einen Würfel wirft, kann man gar nichts vorhersagen. Man kann nicht sagen, wann jemand stirbt, auch wenn eine Versicherungsgesellschaft mit einer großen Masse von Versicherten gleichsam »Wetten« abschließen kann (wie C. Huygens sich ausdrückt18) und dabei sicher gewinnt. Weshalb? Weil nicht der einzelne Mensch in die Wahrscheinlichkeitsrechnung einfließt, sondern ein Exemplar einer Begriffsklasse. Wahrscheinlichkeiten beziehen sich auf statistische Grundgesamtheiten, die aus sehr vielen gleichartigen Einzelereignissen und Elementen bestehen. »Die Statistik«, sagt von Hayek, »befaßt sich mit dem Problem der großen Zahl, wobei sie absichtlich die Komplexität eliminiert durch die Behandlung von einzelnen Elementen in einer Weise, als seien sie nicht systematisch miteinander verbunden. (…) Die statistische Methode ist deshalb nur dann nützlich, wenn wir absichtlich die Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen ignorieren oder uns ihrer nicht bewußt sind; das heißt, wenn wir uns der Struktur nicht bewußt sind, in der sie organisiert sind.«19 Diese Elemente, ihre »Einzelheit«, sind logische Einheiten oder Zahlen. Die Elemente einer statistischen Grundgesamtheit sind logisch gleichwertig und können numeriert werden. Die Einheit einer Handlung, die Einheit einer Entscheidungssituation dagegen ist keine zahlenmäßige Einzelheit. Deshalb gibt es zwischen den Möglichkeiten des Handelns und den Elementarereignissen einer Ereignisklasse keinen oder keinen wesentlichen Zusammenhang. Um von einem Einzelereignis sprechen zu können, muß zunächst ein Weltmodell entworfen worden sein, in dem eine Klasse oder ein Name für derartige Ereignisse überhaupt vorkommt.20
Zunächst begegnen uns Dinge, die wir stets schon als etwas interpretieren, dann stellen wir Fragen an die Dinge, und sie fügen sich daraufhin in unsere Fragen, d.h. erlauben Handlungen, die wir als erfolgreiche oder gescheiterte auslegen können. »Ob eine gegebene Aussage wahr oder falsch, sinnvoll oder sinnlos ist, hängt davon ab, welche Frage sie zu beantworten sucht.«21 Fragen eröffnen Möglichkeiten. »Jede Frage grenzt als Frage die Weite und die Art der in ihr beanspruchten Antwort aus. Sie umgrenzt damit zugleich den Umkreis der Möglichkeiten, sie zu beantworten.«22 Wahrscheinlichkeit wird als Mitte zwischen Wahrheit und Falschheit angesehen, als Grad der Wahrheit. Der Eintritt des Ereignisses »Es wird eine 6 geworfen« kann wahr oder falsch sein, und er ist als Einzelereignis nur wahr oder falsch. Aber man kann überhaupt nur von Wahrheit und Falschheit sprechen, wenn man weiß, was denn wahr sein soll, wenn man also die Frage kennt.
Die »Realität« ist »Fragen-relativ«. »Bevor wir nicht«, sagt von Hayek, »definitive Fragen stellen können, können wir unseren Verstand nicht benutzen; und Fragen unterstellen, daß wir einige provisorische Annahmen oder eine Theorie über die Ereignisse formuliert haben.«23 Und da jede Frage immer in einer Situation gestellt wird und insofern »eine historische Frage«24 ist, muß es auch in der Naturwissenschaft so etwas wie eine Geschichte geben. Weil die Fragen, die Aristoteles, Galilei, Newton, Einstein oder Heisenberg gestellt haben, je andere waren, deshalb sind ihre Theorien je andere. Sie sind nicht völlig verschieden und unvereinbar, weil auch die Geschichte der Situationen nicht völlig verschieden und unvereinbar, sondern eben eine Geschichte ist. Was aber jeweils als »real« beschrieben und erkannt ist, ist auf etwas anderes bezogen und von diesem ebenso abhängig wie von der Natur, der Antworten abgenötigt werden.