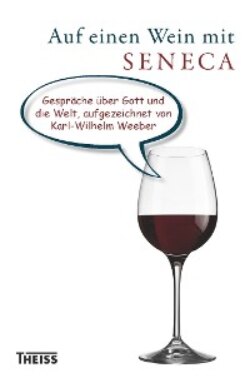Читать книгу Auf einen Wein mit Seneca - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 15
GOTT UND MENSCH
Оглавление„Keine Seele kann gut sein ohne Gott …“
Sprechen wir über Gott. Wie definieren Sie ihn?
Quid est deus? Mens universi. Quid est deus? Quod vides totum et quod non vides totum. Sic demum magnitudo illi redditur, qua nihil maius cogitari potest, si solus est omnia, si opus suum et intra et extra tenet. (NQ I pr. 13)
Was ist Gott? Die Vernunft des Universums. Was ist Gott? Alles, was du siehst, und alles, was du nicht siehst. Erst dann wird ihm seine Größe – nichts Größeres vermag sich unsere Einbildungskraft vorzustellen – zugestanden, wenn er allein alles verkörpert, wenn er sein Werk von innen wie von außen umfasst.
Stört es Sie, wenn man Gott oder das Göttliche oder, wie Sie sagen, „die Vernunft des Universums“ mit Jupiter als oberstem Gott des griechischrömischen Pantheons identifiziert? Darüber haben sich ja schon viele Philosophen vor Ihnen Gedanken gemacht.
Ne hoc quidem crediderunt Iovem, mittere manu sua fulmina, sed eundem quem nos Iovem intellegunt: rectorem custodemque universi, animum ac spiritum mundi, operis huius dominum et artificem, cui nomen omne convenit. Vis illum fatum vocare, non errabis. Hic est, ex quo suspensa sunt omnia, causa causarum. Vis illum providentiam dicere, recte dices; est enim, cuius consilio huic mundo providetur. Vis illum naturam vocare, non peccabis; hic est, ex quo nata sunt omnia, cuius spiritu vivimus. Vis illum vocare mundum, non falleris; ipse enim est hoc, quod vides totum, partibus suis inditus, et se sustinens et sua. (NQ II 45, 1ff.)
Sie haben ja auch nicht geglaubt, dass Jupiter mit eigener Hand Blitze schleudere, sondern hatten von ihm die gleiche Vorstellung wie wir: Er ist der Lenker und Hüter des Universums, die Seele und der Geist der Welt, der Meister und Künstler dieser Schöpfung, zu dem jeder Name passt. Willst du ihn Schicksal nennen, dann wirst du dich nicht irren: Er ist es, von dem alles abhängt, die Ursache aller Ursachen. Willst du ihn als Vorsehung bezeichnen, so wirst du ihn zuteffend so nennen: Er ist es nämlich, durch dessen Ratschluss für diese ganze Welt Vorsorge getroffen wird. Willst du ihn als Natur bezeichnen, so wirst du auch damit recht haben: Er ist es, von dem alles geschaffen wurde, durch dessen Atem wir leben. Willst du ihn Weltall nennen, so wirst du nicht in die Irre gehen: Er selbst ist nämlich das alles, was du siehst, in allen seinen Teilen präsent, sich selbst und seine Schöpfung erhaltend.
Wie soll der Mensch Gott – beziehungsweise den Göttern als „Teilerscheinungen“ des Göttlichen – begegnen? Die traditionelle Religion kennt ja feste Rituale eines Gottes-Dienstes.
Quomodo sint di colendi, solet praecipi. Vetemus salutationibus matutinis fungi et foribus adsidere templorum: humana ambitio istis officiis capitur, deum colit, qui novit. Vetemus lintea et strigiles Iovi ferre et speculum tenere Iunoni: non quaerit ministros deus. Quidni? Ipse humano generi ministrat, ubique et omnibus praesto est. (ep. 95, 47)
Wie man die Götter verehren soll, dafür gibt es gewöhnlich Vorschriften. Wir wollen morgendliche Besuche bei den Göttern und das Sitzen an Tempeltüren lieber verbieten: Pflichtübungen schmeicheln menschlichem Ehrgeiz; den Gott verehrt, wer ihn kennt. Wir wollen davon Abstand nehmen, Jupiter Leinengewänder und Striegel darzubringen und der Juno den Spiegel zu halten; Gott braucht keine Diener. Warum sollte er auch? Er selbst dient dem Menschengeschlecht, ist überall und für alle gegenwärtig.
Sie äußern sich jetzt skeptisch zu traditionellen Formen der Götterverehrung. Könnten Sie auch positiv formulieren, wie der Mensch den Göttern entgegentreten sollte?
Primus est deorum cultus deos credere, deinde reddere illis maiestatem suam, reddere bonitatem, sine qua nulla maiestas est, scire illos esse, qui praesident mundo, qui universa vi sua temperant, qui humani generis tutelam gerunt. Vis deos propitiare? Bonus esto! Satis illos coluit, quisquis imitatus est. (ep. 95, 50)
Die wichtigste Verehrung der Götter ist es, an die Götter zu glauben, dann ihre Erhabenheit anzuerkennen und ihr Gutsein, ohne das es keine Erhabenheit geben kann, ferner zu wissen, dass sie es sind, die die Welt lenken, die alles mit ihrer Kraft ordnen, die sich um den Schutz des Menschengeschlechts kümmern. Willst du die Götter gnädig stimmen? Dann sei gut! Jeder, der ihnen nacheifert, ehrt sie genug.
Sie hatten vorhin darauf hingewiesen, dass die Götter jederzeit für alle da seien. Wie ist das zu verstehen?
Quae causa est dis bene faciendi? Natura. Errat, si quis illos putat nocere nolle – non possunt! Nec accipere iniuriam queunt nec facere; laedere etenim laedique coniunctum est. (ep. 95, 49)
Welche Veranlassung haben die Götter, Wohltaten zu erweisen? Ihr Wesen. Es irrt, wer glaubt, sie wollten niemandem schaden – sie können es nicht! Sie können weder Unrecht erleiden noch tun; verletzen und verletzt werden ist ja eng miteinander verbunden.
Wenn das so ist, stellt sich eindringlich die Frage der Theodizee: Wieso lassen die Götter zu, dass so viel Unrecht und Schlechtes in der Welt ist?
In maiorem me quaestionem vocas, cui suus dies, suus locus dandus est. (NQ II 46)
Damit sprichst du ein ziemlich kompliziertes Problem an, dem man zu gegebener Zeit und an anderem Ort nachgehen muss.
Verzeihen Sie, dass wir trotzdem insistieren. Die Frage muss erlaubt sein, warum Gott auch die, die sich gut im Sinne der Nachahmung der Götter verhalten, mit Mühsal, Unglück und Ungerechtigkeit heimsucht.
Quia in castris quoque periculosa fortissimis imperantur. Item dicant quicumque iubentur pati timidis ignavisque flebilia: „Digni visi sumus deo, in quibus experiretur, quantum humana natura posset pati.“ (prov. 4, 8)
Weil auch im Militärlager die gefährlichsten Aufträge den tapfersten Soldaten befohlen werden. In gleicher Weise sollen die, denen befohlen wird, Leiden zu ertragen, die Ängstlichen und Feigen Weinen verursachen, sagen: „Wir sind Gott würdig erschienen, an uns zu erproben, wie viel die menschliche Natur auszuhalten vermag.“
Ein Leidenstraining für Gottes Lieblinge, wenn wir es etwas spöttisch formulieren dürfen?
Hos deus, quos probat, quos amat, indurat, recognoscit, exercet. (prov. 4, 7)
Wen Gott für gut befindet, wen er liebt, den härtet er ab, den prüft er, den bildet er aus.
Lassen wir das so stehen! Sie sprachen gerade von der menschlichen Natur. Hat sie in irgendeiner Hinsicht Anteil am Göttlichen?
Quid interest inter naturam dei et nostram? Nostri melior pars animus est; in illo nulla pars extra animum est. Quem in hoc mundo locum deus obtinet, hunc in homine animus. (NQ I pr. 14; ep. 65, 24)
Worin besteht der Unterschied zwischen der Natur Gottes und unserer Natur? Der bessere Teil von uns ist die Seele; bei Gott gibt es keinen anderen Teil als die Seele. Der Platz, den Gott in dieser Welt einnimmt, den nimmt beim Menschen die Seele ein.
Und diese gottgegebene Seele befähigt uns in gewisser Weise zur Gleichheit mit Gott?
Totum hoc, quo continemur, et unum est et deus; et socii sumus eius et membra. Capax est noster animus, perfertur illo, si vitia non deprimant. Quemadmodum corporum nostrorum habitus erigitur et spectat in caelum, ita animus, cui in quantum vult licet porrigi, in hoc a natura rerum formatus est, ut paria dis vellet. Et si utatur suis viribus ac se in spatium suum extendat, non aliena via ad summa nititur. (ep. 92, 30)
Das gesamte Weltall, das uns umschließt, ist das Eine oder der Gott in uns. Wir sind sowohl seine Gefährten als auch seine Glieder. Unsere Seele hat diese Fähigkeit, sie gelangt dorthin in die Höhe, wenn charakterliche Fehlhaltungen sie nicht niederdrücken. So wie der Bau unserer Körper nach oben strebt und zum Himmel schaut, so ist es auch unserer Seele erlaubt, sich so weit zu erstrecken, wie sie will. Sie ist von der Natur so gestaltet, dass sie Göttergleiches erreichen will. Wenn sie ihre Kräfte nutzt und sich so weit ausdehnt, wie es der ihr gewährte große Raum ermöglicht, strebt sie auf ihrem eigenen Weg dem Gipfel entgegen.
Welche Rolle spielt die Philosophie dabei?
Miraris hominem ad deos ire? Deus ad homines venit, immo, quod est propius, in homines venit: nulla sine deo mens bona est. Quis dubitare potest, quin deorum immortalium munus sit, quod vivimus, philosophiae, quod bene vivimus? Itaque tanto plus huic nos debere quam dis, quanto maius beneficium est bona vita quam vita, pro certo haberetur, nisi ipsam philosophiam di tribuissent: cuius scientiam nulli dederunt, facultatem omnibus. (ep. 73, 16; 90, 1)
Du wunderst dich, dass der Mensch zu den Göttern gelangt? Gott kommt selbst zu den Menschen, ja, was noch größere Nähe schafft, er kommt in die Menschen: Keine Seele kann gut sein ohne Gott. Wer kann daran zweifeln, dass es das Geschenk der unsterblichen Götter ist, dass wir leben, das Geschenk aber der Philosophie, dass wir sittlich gut leben? Deshalb verdanken wir ihr umso mehr als den Göttern, als das sittlich gute Leben ein größeres Geschenk ist als das Leben an sich. Das wäre sicher, wenn die Götter uns nicht gerade die Philosophie zugeteilt hätten. Deren Kenntnis haben sie niemandem gegeben, die Fähigkeit zur Philosophie aber allen.
Könnte man die Philosophie demnach als einen Kommunikationsstrang zwischen Gott und Mensch bezeichnen?
Haec adhortabitur, ut deo libenter pareamus, ut fortunae contumaciter; haec docebit, ut deum sequaris, feras casum. (ep. 16, 5)
Sie wird uns ermahnen, Gott gern zu gehorchen und dem Schicksal die Stirn zu bieten; sie wird uns lehren, Gott zu folgen und den Zufall zu ertragen.