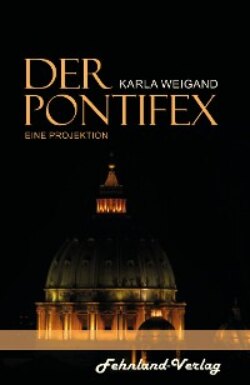Читать книгу Der Pontifex - Karla Weigand - Страница 10
„Gott wohnt auch im Tiger; aber das ist kein Grund, den Tiger zu umarmen.“ (Ramakrishna Paramahamsa, bedeutender hinduistischer Mystiker, 1836 – 1886)
ОглавлениеSeit Jahren schon treibt Maurice Obembe selbst so Einiges um, das für gewaltigen Wirbel sorgen könnte. Jetzt steht er kurz davor! Ist er endlich Papst, kann er die Dinge angehen.
‚Ach, was heißt Wirbel?’, denkt er, vor Vorfreude ganz außer sich, denn er zweifelt keinen Augenblick an einem, für ihn, positiven Wahlausgang. ‚Ein Erdbeben plus Tsunami wird es sein; und zwar von einem Ausmaß, wie man es noch bei keiner Religionsgemeinschaft jemals erlebt hat!’
Vorher wird er allerdings auf keinen Fall darüber sprechen. Und sobald er es tun wird, dann auch nur mit ganz wenigen Auserwählten, die er unbedingt zur Verwirklichung braucht und deren Loyalität er sich absolut sicher sein kann; denn seine Absichten kann man beim besten Willen nicht als „lauter“ bezeichnen …
Oh, nein! Seit langem schon brennt in seinem Herzen die heiße Flamme der Rachsucht und die schmerzliche Sehnsucht nach gnadenloser Vergeltung. Immer wieder hat er im Laufe seines Erwachsenenlebens die akribischen Aufzeichnungen eines Urahnen über das schreckliche Schicksal seiner Familie und seines Volkes und die nie gebüßte Schuld der Verursacher nachgelesen. Er kennt sie mittlerweile beinah auswendig. Und hin und wieder träumt er sogar davon; so auch in der vergangenen Nacht.
Der sechsjährige Junge, genannt Maurice, zitterte vor Angst und Schwäche. Im Juni des Jahres 1894 befand sich eine kleine Gruppe, bestehend aus einigen älteren Frauen und jungen Müttern mit ihren Kindern, etliche davon noch Säuglinge, sowie aus ein paar heranwachsenden Mädchen, schon seit zwei Tagen auf der Flucht durch das unwegsame, verbuschte Gelände, das sich unmittelbar an die Pflanzung des gefürchteten weißen Bwanas, nahe der Stadt Bagamojo am Fluss Ruwu Kirigani, im Osten Afrikas, anschloss.
Die Frauen waren übersät mit Abschürfungen und frischen blauen Flecken, die dem verwilderten Gelände, das sie durchquerten, geschuldet waren; dazu waren sie gezeichnet von Hinweisen auf länger zurückliegende Faust- und Peitschenhiebe, verabreicht als Strafe für angebliche „Faulheit“ oder weil sie versucht hatten, sich gegen die ausufernde sexuelle Gewalt der schwarzen Aufseher ihres weißen „Herrn“ zur Wehr zu setzen.
Der Bwana ließ den Kerlen das meiste ihrer Übergriffe ohne Sanktionen durchgehen, weil er sie brauchte und auf ihre Loyalität angewiesen war. Eine Situation, die die Aufseher weidlich ausnutzten. Auf diese Weise konnten sie sich den weiblichen Feld- und Haussklaven überlegen fühlen und vergessen, dass sie selbst auch bloß Dreck in den Augen des deutschen Plantagenbesitzers waren.
Ein ganz junges Mädchen, fast noch ein Kind, vermochte vor Schmerzen kaum mehr zu laufen; immer wieder lief ihm ein dünner Blutfaden zwischen den mageren Oberschenkeln herab. Ein betrunkener Besucher ihres „Besitzers“ aus Potsdam war in der Nacht vor der Flucht mit äußerster Brutalität gegen das noch unberührte Mädchen vorgegangen.
Der hässliche Vorfall reihte sich ein in eine ganze Serie dieser, inzwischen alltäglichen, Missbrauchsvergehen gegen schwarze Frauen. Kinder und jedes weibliche Wesen bis zu einem gewissen Alter hatten ständig damit zu rechnen, dass ein weißer „Herr“ sein „Recht“ einforderte, die „Sklavinnen“ und deren Nachwuchs, selbst kleine Jungen, missbrauchen zu dürfen.
Auf vielen Pflanzungen besaß dieses „Recht“ auch für die schwarzen Wächter stillschweigende Geltung, um sich ihrer Ergebenheit zu versichern.
Widersetzlichkeit der Rechtlosen wurde im Allgemeinen mit Prügeln geahndet. Wobei diese Art der Bestrafung nicht nur dem Herrn zustand, sondern auch seinen Söhnen oder Freunden, die zu Besuch weilten sowie den bereits erwähnten weißen und schwarzen Aufsehern.
Ältere Eingeborene und kleinere Kinder waren nicht selten von Unterernährung betroffen. Wer nicht mehr oder noch nicht die volle Arbeitsleistung auf einer Plantage erbrachte, hatte mitunter mit drastischer Reduzierung der zugeteilten Essensrationen zu rechnen; ganz nach dem Motto: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“
* * *
Es war bereits später Nachmittag. Die letzte Mahlzeit, ihm und seinen kleineren Geschwistern von ihrer Mutter Elisa zugeteilt, hatte Maurice am vergangenen Abend zu sich genommen. Es hatte sich um fette schwarze Raupen einer großen blauschillernden Käferart gehandelt, die sie und die anderen Frauen im nahezu undurchdringlichen Gebüsch am Rande des größtenteils überwucherten Dschungelpfads gesammelt hatten.
Sein Hunger war größer gewesen als der Ekel und er hatte das auf einer Lichtung über einem kleinen Feuerchen geröstete Viehzeug mit Todesverachtung in den Mund gesteckt und ohne viel zu kauen, heruntergeschluckt. Im Augenblick konnte sich der kleine Junge vor Hunger nur noch mühsam aufrecht halten; die von Insekten zerstochenen dünnen Beine, die in kurzen Hosen steckten, drohten dem Sechsjährigen den Dienst zu versagen.
Seit Stunden marschierten sie auch am zweiten Tag, jeweils zu zweien und hintereinander, schweigend im Gänsemarsch einen gewundenen schmalen Pfad entlang, der kein Ende zu nehmen schien. Die Vorausgehenden bedienten sich ihrer Macheten, um das Dickicht zu lichten und lösten einander dabei regelmäßig ab. Das Tempo war auch am Ende dieses Tages noch zügig und duldete keinerlei unnötige Verzögerung.
Maurice, beinahe im Halbschlaf, erinnerte sich an frühere Buschwanderungen, um ihre Nachbardörfer zu besuchen. Das war vor zwei Jahren gewesen, zu einer Zeit, als alles noch gut zu sein schien und er und seine Familie freie Menschen in ihrem eigenen Dorf gewesen waren. Da hatte man unterwegs gescherzt und gelacht und, um sich die Zeit zu vertreiben, während des Marschierens fröhliche Lieder gesungen.
Eines hatte er ganz besonders geliebt. Es handelte von einer Riesenschlange und ihrem Feind, dem Leoparden, der sie fressen wollte. Aber die listige Schlange wartete ab, bis die Raubkatze eingeschlafen war und erwürgte sie dann im Schlaf. Zur Strafe wurde das Kriechtier dann von einem tembo, einer hier lebenden Waldelefantenart, zertrampelt …
An diesem Tag jedoch sang niemand; man war auf der Flucht und es galt, unbedingte Ruhe walten zu lassen. „Keinen Laut, Freunde!“, hatte seine Mutter Elisa alle, aber besonders die kleineren Kinder ermahnt.
„Sonst findet uns der böse weiße Mann und bestraft uns hart, weil wir ihn unerlaubt verlassen haben! Unsere einstige Freiheit haben wir längst verloren, meine Lieben“, wiederholte sie für die Erwachsenen. „Für uns gilt:
‚Deus dedit, Deus obstulit!’ – ‚Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen!’“, zitierte Elisa einen Spruch des Hiob aus dem Alten Testament, den sie von einem weißen Missionsbenediktiner gelernt hatte, der sie und ihre Kinder neulich getauft hatte.
Diese Taufe war zwar nicht ausdrücklich gegen ihren Willen erfolgt – zu ernsthaftem Widerstand hatte ihr in ihrer Lage der Mut gefehlt. Aber als Christin empfand sich die schöne stolze Frau vom Stamm der Wahehe ihr ganzes Leben lang nicht.
„Wer, wie wir, auf der Flucht ist, muss sich sputen und darf dem Feind keine Gelegenheit zum Einholen bieten“, hatte die Mutter all jenen eingeschärft, die entschlossen waren, mit ihr zu gehen und heimlich die Plantage des weißen Mannes, dessen „Schützlinge“ sie allesamt waren, zu verlassen.
Einer der vornehmsten Häuptlingsfamilien des Landes entstammend und vor kurzem noch die Ehefrau, jetzt aber die Witwe Mkwas, des tapferen Wahehe-Oberhäuptlings, genoss Elisa den Respekt und das Vertrauen der anderen Schwarzen.
Mtaga, so ihr ursprünglicher Name, später nach der heiligen Elisabeth „Elisa“ getauft, war es auch gewesen, die eine Gelegenheit gesucht und gefunden hatte, die schwarzen Wachtposten auf der Farm auszutricksen und der Knechtschaft zu entkommen – bis jetzt jedenfalls.
Maurice registrierte trotz seines Alters sehr genau, dass die Gruppe es sorgsam vermied, auch nur in die Reichweite von weißen Kolonisatoren oder katholischen Missionsstationen zu gelangen, weil nach Elisas Erfahrung die Mönche und Nonnen meistens mit den deutschen Kolonialherren kollaborierten.
Die Deutschen selbst, Offiziere und Siedler, nannten ihr Vorgehen dreist „Inobhutnahme“ oder „Schutzhaft“, welche sie der „heidnischen“ und „geistig und kulturell zurückgebliebenen Ureinwohnerschaft“ angedeihen ließen, während die frommen Missionare es vorzogen, beschönigend von „barmherziger Fürsorge im Geiste Jesu Christi“ zu sprechen …
Als Maurice hilfesuchend nach der Hand seiner neben ihm ausschreitenden Mutter Elisa greifen wollte, wurde ihm bewusst, dass er ausnahmsweise von ihr keine Unterstützung erhoffen durfte. Die stolze junge Frau, wie selbstverständlich die Anführerin der Flüchtigen, trug nicht nur ihr vor sieben Monaten geborenes Baby, das noch gestillt werden musste, in einem Tragetuch auf dem Rücken; sie schleppte außerdem neben einem schäbigen Bündel mit dem spärlichen Gepäck der Familie noch seine zwei Jahre alte Schwester auf der Hüfte.
Sein jüngstes Kind hatte Maurices Vater Mkwa Obembe gezeugt, nachdem es ihm gelungen war, nachts heimlich seine bereits in Obhut genommene, sprich versklavte Frau Mtaga in einer Arbeiterhütte auf der Plantage aufzusuchen, ehe er sich erneut mit seinen Kriegern in den Kampf gegen die deutschen Okkupanten gestürzt hatte. Es sollte sein letzter Waffengang werden.
Gestorben war der Vater des Jungen als Heide, da er sich noch unter dem Galgen standhaft gegen die von einem Priester penetrant „empfohlene“ Taufe zur Wehr gesetzt hatte. Es war ihm sogar gelungen, zu fliehen, während die übrigen gefangenen Kämpfer sich widerspruchslos in ihr Schicksal gefügt hatten, als Christen hingerichtet zu werden.
Genützt hatte ihm die Flucht allerdings nichts, da man ihn bald wieder aufgespürt und kurzen Prozess mit ihm gemacht hatte.
Trotz seiner Erschöpfung bekam Maurice mit, dass Elisa sehr aufmerksam auf ihre Umgebung achtete, soweit das undurchdringliche Laubwerk des den Pfad säumenden Gesträuchs dies zuließ. Vor allem hatte sie ein scharfes Auge auf ihren zweiten Sohn Heinrich, genannt Henri, der am vergangenen Tag seinen vierten Geburtstag begangen hatte. Ihn ließ Elisa ein paar Schritte vor sich herlaufen, um jederzeit beobachten zu können, wie es dem Kleinen erging.
Den sperrigen Namen hatte man dem Jungen in der katholischen Missionsstation verpasst, wo er getauft worden war, genau wie Elisa, Maurice und seine jüngeren Geschwister.
Maurices zweijährige Schwester Margarethe hörte auf den Namen Greta und das Baby, Andreas getauft, würde später als Andi durchs Leben gehen, während er den Namen Mauritz erhalten hatte und von allen Maurice gerufen wurde, weil es sich leichter aussprechen ließ.
Henri war nicht ganz gesund. Schon vor der Flucht hatte er wochenlang gekränkelt; er litt an Halsweh und hatte geschwollene Rachenmandeln.
Maurice, 1888 als Erbe und Nachfolger des stolzen Häuptlings Mkwa Obembe im Dorf Tangwelule in Ghanumbia geboren, einem großen, von den Weißen zwar eroberten, aber noch immer ziemlich unerforschten Land im Osten des riesigen Kontinents Afrika, schämte sich plötzlich.
‚Mein Bruder Henri ist zwei Jahre jünger als ich. Er ist krank, hat ein bisschen Fieber, sagt Mama, und er ist sehr schwach. Er muss Bauchschmerzen haben vor lauter Hunger, denn er hat sich gestern geweigert, diese ekligen Raupen zu essen. Und trotzdem: Er beklagt sich nicht, jammert nicht einmal, sondern stapft einfach tapfer weiter. Ich, als sein großer Bruder, müsste ihm eigentlich ein Vorbild sein!’
„Soll ich dir Andi eine Weile abnehmen, Mama?“, fragte er schüchtern und schaute seiner Mutter, einer hochgewachsenen schönen Wahehe-Frau, in die großen, ausdrucksstarken, schwarzen Augen. Ihr erschöpfter und tieftrauriger Ausdruck rührte ihn um ein Haar zu Tränen, weshalb ihn nicht zum ersten Mal ein Gefühl unbändigen Hasses auf die weißen Eroberer aus Europa erfasste.
‚Sobald ich groß bin und ein starker Mann’, schwor er sich, ‚werde ich, als Nachfolger meines Vaters, Anführer von tapferen Wahehe-Kriegern sein und alle weißen Teufel aus unserem Land jagen! Viele von ihnen werde ich töten zur Strafe, weil sie meinen Vater ermordet, unser Dorf zerstört und meine Mama, mich und unsere ganze Sippe zu Sklaven gemacht haben!’
„Der Kleine ist zu schwer für dich, mein Sohn! Aber bis zu unserem nächsten Rastplatz könntest du das Bündel übernehmen, das unsere Kleidung und noch anderes Wichtige enthält, Maurice! Das wäre sehr lieb von dir!“
Damit reichte sie ihm, ohne im Gehen innezuhalten, ein buntes Tuch, das, zusammengeknotet, eine Stofftasche bildete, in der sich die wenigen Habseligkeiten der einst wohlhabenden Häuptlingsfamilie befanden.
Maurice hängte sich das Ding um den Hals und ging beinahe in die Knie infolge des Gewichts, welches man dem Bündel äußerlich gar nicht ansah. Er würde wohl noch langsamer gehen müssen.
‚Hoffentlich verliere ich nicht den Anschluss an die Gruppe’, machte der kleine Junge sich Sorgen, als ein Flüchtiger nach dem anderen ihn auf dem mit Gras überwucherten und für ihn beinahe unsichtbaren Dschungelpfad überholte.
Nur Elisa vermochte unbeirrt mit sicherem Instinkt den richtigen Weg durch diese grüne, bereits dämmrig-dunkle, feuchtheiße Hölle zu erkennen. Ohne Zweifel war sie die beste und erfahrenste Fährtenleserin. Hier in der Gegend sollte es immerhin wilde Tiere geben neben den allgegenwärtigen giftigen Schlangen und Skorpionen …
‚Gut, dass mein Vater uns nicht mehr sehen kann’, überlegte Maurice nach einer Weile, während er den Schleim in seiner Nase hochzog. In der vergangenen Nacht im Freien hatte er sich einen Schnupfen geholt. Nach Sonnenuntergang konnte es nämlich empfindlich kalt werden.
‚Unsere stolze Familie, seit fast einem Jahrhundert Herrscher über die Wahehes, auf der Flucht vor den weißen Eroberern: Was für eine Schmach!’
Bitterer Groll erfüllte den kleinen Jungen.
* * *
Den Aufenthalt in der Sixtinischen Kapelle scheint Kardinal Obembe außerordentlich zu genießen. Obwohl er die päpstliche Hauskapelle im Vatikan, erbaut von Papst Sixtus IV. von 1473 bis 1481, nicht zum ersten Mal besucht, ist er genau wie einst als junger Priester bezaubert von dem einmaligen Kunstgenuss.
Ihn stört nicht, dass bereits sechzehn Wahlgänge abgehalten worden sind und in Kürze der siebzehnte Urnengang ansteht. Er könnte an diesem Ort gerne noch eine lange Zeit verweilen, nur um in aller Ruhe die grandiosen Fresken zu Themen des Alten und des Neuen Testamentes zu bewundern von so bedeutenden Künstlern wie Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Ghirlandaio, Rosselli und Signorelli an den Längswänden sowie die Fresken Michelangelos:
Schöpfungsgeschichte, Propheten, Sybillen et cetera an der gewölbten Decke und natürlich das Nonplusultra, das Jüngste Gericht an der Altarwand. Auch die imposante Architektur der weiträumigen Kapelle lässt er mit Genuss auf sich einwirken.
‚Meine Kapelle’, jubelt es in seinem Inneren und wieder wandert der entzückte Blick des Kardinals hinauf zu Michelangelos „Erschaffung des Adam“.
Dass sowohl der Schöpfer der Welt wie sein Geschöpf, das er angeblich nach seinem eigenen Bild geschaffen hatte, der weißen Rasse angehören, belustigt ihn nur. Ist man sich doch seit längerem sicher, dass die Menschwerdung in Wahrheit in Afrika stattgefunden hat … Dem begnadeten Künstler nimmt er es nicht übel: Der konnte das damals, als er sein Werk schuf, nicht wissen.
‚Im Übrigen sollen sich die Weißen bloß nicht so überheben’, denkt er bei sich. ‚Einer vor zwei Jahrzehnten durchgeführten Studie zufolge sind die Nordeuropäer länger dunkelhäutig gewesen, als sie bis dahin für möglich gehalten haben – und als ihnen lieb ist.’
Obembe hatte diese Studie sehr aufmerksam gelesen.
Den Sachverhalt legte eine DNA-Analyse nahe, durchgeführt von Londoner Wissenschaftlern an Resten eines 10 000 Jahre alten männlichen Skeletts aus Großbritannien. Die Knochen waren bereits im Jahr 1903 im Südwesten Englands gefunden worden. DNA-Analysten des britischen Naturhistorischen Museums und des University College of London befassten sich allerdings erst 2018 damit und „seien überrascht gewesen, dass ein Bewohner der britischen Insel damals zwar blaue Augen, aber dazu richtig dunkle Haut haben konnte.“
Zu Kardinal Obembes großer Freude fand man noch mehr heraus: Der Stamm dieses Mannes war am Ende der letzten Eiszeit auf die Insel gezogen. Die Forscher konnten die DNA des Skeletts mit menschlichen Relikten aus Ungarn, Luxemburg und Überresten aus Spanien in Verbindung setzen.
Vor zwanzig Jahren eine Nachricht, die nicht nur Maurice Obembe, sondern auch viele andere gebildete Afrikaner mit Genugtuung erfüllt hatte. In europäischen Ländern machte man hingegen keinerlei Aufhebens davon; es war leider bloß ein Fall für Anthropologen und Naturhistoriker geblieben.
„Anscheinend passte die Entdeckung nicht ins ‚weiße’ Weltbild“, sagt sich der Kardinal mit einem zynischen Lächeln.
Wie ein x-beliebiger Rom-Tourist hatte er sich am Flughafen den neuesten Führer der Sixtina gekauft. Den blättert er durch, während der nächste Wahlgang vorbereitet wird. Er weiß jetzt zum Beispiel, dass sie exakt über die gleichen Maße verfügt wie der im Alten Testament erwähnte Tempel König Salomons mit einer Länge von 40,23 m, einer Breite von 13,41 m und einer beeindruckenden Höhe von immerhin 20,70 m.
Eigentlich eine Information, die die wenigsten, die das Büchlein durchblättern, interessieren wird. Aber für den Kardinal bedeutet sie schlichtweg alles: sieht er die Sixtina mittlerweile doch längst als „seine“ Kapelle an.